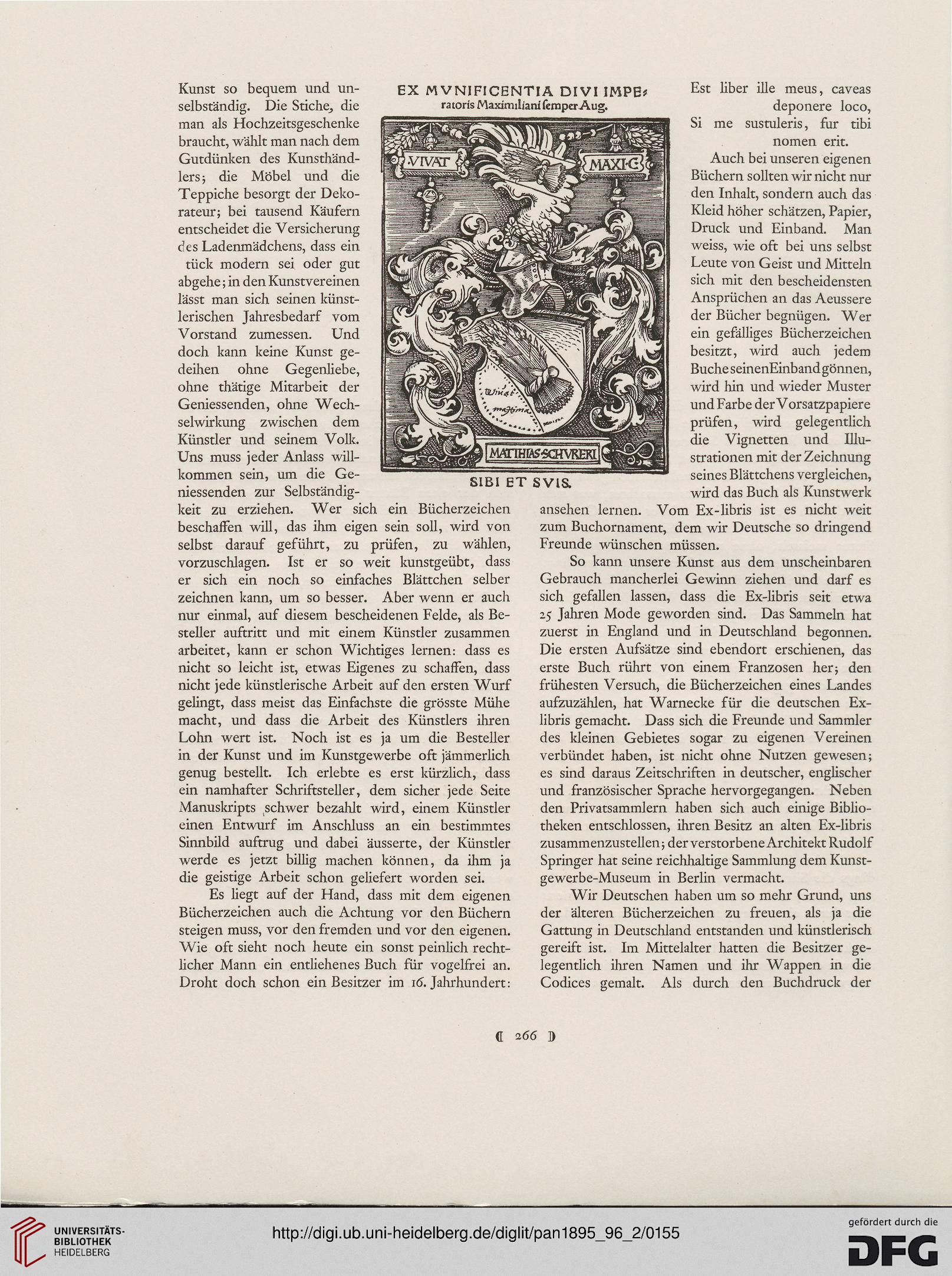Kunst so bequem und un-
selbständig. Die Stiche., die
man als Hochzeitsgeschenke
braucht, wählt man nach dem
Gutdünken des Kunsthänd-
lers j die Möbel und die
Teppiche besorgt der Deko-
rateur; bei tausend Käufern
entscheidet die Versicherung
des Ladenmädchens, dass ein
tück modern sei oder gut
abgehe; in den Kunstvereinen
lässt man sich seinen künst-
lerischen Jahresbedarf vom
Vorstand zumessen. Und
doch kann keine Kunst ge-
deihen ohne Gegenliebe,
ohne thätige Mitarbeit der
Geniessenden, ohne Wech-
selwirkung zwischen dem
Künstler und seinem Volk.
Uns muss jeder Anlass will-
kommen sein, um die Ge-
niessenden zur Selbständig-
keit zu erziehen. Wer sich
EX MVNIFICENTIA DIVI IMPB*
ratoris MaximiiianifemperAug.
SIBI ET svia
ein Bücherzeichen
beschaffen will, das ihm eigen sein soll, wird von
selbst darauf geführt, zu prüfen, zu wählen,
vorzuschlagen. Ist er so weit kunstgeübt, dass
er sich ein noch so einfaches Blättchen selber
zeichnen kann, um so besser. Aber wenn er auch
nur einmal, auf diesem bescheidenen Felde, als Be-
steller auftritt und mit einem Künstler zusammen
arbeitet, kann er schon Wichtiges lernen: dass es
nicht so leicht ist, etwas Eigenes zu schaffen, dass
nicht jede künstlerische Arbeit auf den ersten Wurf
gelingt, dass meist das Einfachste die grösste Mühe
macht, und dass die Arbeit des Künstlers ihren
Lohn wert ist. Noch ist es ja um die Besteller
in der Kunst und im Kunstgewerbe oft jämmerlich
genug bestellt. Ich erlebte es erst kürzlich, dass
ein namhafter Schriftsteller, dem sicher jede Seite
iManuskripts schwer bezahlt wird, einem Künstler
einen Entwurf im Anschluss an ein bestimmtes
Sinnbild auftrug und dabei äusserte, der Künstler
werde es jetzt billig machen können, da ihm ja
die geistige Arbeit schon geliefert worden sei.
Es liegt auf der Hand, dass mit dem eigenen
Bücherzeichen auch die Achtung vor den Büchern
steigen muss, vor den fremden und vor den eigenen.
Wie oft sieht noch heute ein sonst peinlich recht-
licher Mann ein entliehenes Buch für vogelfrei an.
Droht doch schon ein Besitzer im 16". Jahrhundert:
Est über ille meus, caveas
deponere loco,
Si me sustuleris, für tibi
nomen erit.
Auch bei unseren eigenen
Büchern sollten wir nicht nur
den Inhalt, sondern auch das
Kleid höher schätzen, Papier,
Druck und Einband. Man
weiss, wie oft bei uns selbst
Leute von Geist und Mitteln
sich mit den bescheidensten
Ansprüchen an das Aeussere
der Bücher begnügen. Wer
ein gefälliges Bücherzeichen
besitzt, wird auch jedem
Buche seinenEinband gönnen,
wird hin und wieder Muster
und Farbe der Vorsatzpapiere
prüfen, wird gelegentlich
die Vignetten und Illu-
strationen mit der Zeichnung
seines Blättchens vergleichen,
wird das Buch als Kunstwerk
ansehen lernen. Vom Ex-libris ist es nicht weit
zum Buchornament, dem wir Deutsche so dringend
Freunde wünschen müssen.
So kann unsere Kunst aus dem unscheinbaren
Gebrauch mancherlei Gewinn ziehen und darf es
sich gefallen lassen, dass die Ex-libris seit etwa
25 Jahren Mode geworden sind. Das Sammeln hat
zuerst in England und in Deutschland begonnen.
Die ersten Aufsätze sind ebendort erschienen, das
erste Buch rührt von einem Franzosen her; den
frühesten Versuch, die Bücherzeichen eines Landes
aufzuzählen, hat Warnecke für die deutschen Ex-
libris gemacht. Dass sich die Freunde und Sammler
des kleinen Gebietes sogar zu eigenen Vereinen
verbündet haben, ist nicht ohne Nutzen gewesen;
es sind daraus Zeitschriften in deutscher, englischer
und französischer Sprache hervorgegangen. Neben
den Privatsammlern haben sich auch einige Biblio-
theken entschlossen, ihren Besitz an alten Ex-libris
zusammenzustellen; der verstorbene Architekt Rudolf
Springer hat seine reichhaltige Sammlung dem Kunst-
gewerbe-Museum in Berlin vermacht.
Wir Deutschen haben um so mehr Grund, uns
der älteren Bücherzeichen zu freuen, als ja die
Gattung in Deutschland entstanden und künstlerisch
gereift ist. Im Mittelalter hatten die Besitzer ge-
legentlich ihren Namen und ihr Wappen in die
Codices gemalt. Als durch den Buchdruck der
C 266 D
selbständig. Die Stiche., die
man als Hochzeitsgeschenke
braucht, wählt man nach dem
Gutdünken des Kunsthänd-
lers j die Möbel und die
Teppiche besorgt der Deko-
rateur; bei tausend Käufern
entscheidet die Versicherung
des Ladenmädchens, dass ein
tück modern sei oder gut
abgehe; in den Kunstvereinen
lässt man sich seinen künst-
lerischen Jahresbedarf vom
Vorstand zumessen. Und
doch kann keine Kunst ge-
deihen ohne Gegenliebe,
ohne thätige Mitarbeit der
Geniessenden, ohne Wech-
selwirkung zwischen dem
Künstler und seinem Volk.
Uns muss jeder Anlass will-
kommen sein, um die Ge-
niessenden zur Selbständig-
keit zu erziehen. Wer sich
EX MVNIFICENTIA DIVI IMPB*
ratoris MaximiiianifemperAug.
SIBI ET svia
ein Bücherzeichen
beschaffen will, das ihm eigen sein soll, wird von
selbst darauf geführt, zu prüfen, zu wählen,
vorzuschlagen. Ist er so weit kunstgeübt, dass
er sich ein noch so einfaches Blättchen selber
zeichnen kann, um so besser. Aber wenn er auch
nur einmal, auf diesem bescheidenen Felde, als Be-
steller auftritt und mit einem Künstler zusammen
arbeitet, kann er schon Wichtiges lernen: dass es
nicht so leicht ist, etwas Eigenes zu schaffen, dass
nicht jede künstlerische Arbeit auf den ersten Wurf
gelingt, dass meist das Einfachste die grösste Mühe
macht, und dass die Arbeit des Künstlers ihren
Lohn wert ist. Noch ist es ja um die Besteller
in der Kunst und im Kunstgewerbe oft jämmerlich
genug bestellt. Ich erlebte es erst kürzlich, dass
ein namhafter Schriftsteller, dem sicher jede Seite
iManuskripts schwer bezahlt wird, einem Künstler
einen Entwurf im Anschluss an ein bestimmtes
Sinnbild auftrug und dabei äusserte, der Künstler
werde es jetzt billig machen können, da ihm ja
die geistige Arbeit schon geliefert worden sei.
Es liegt auf der Hand, dass mit dem eigenen
Bücherzeichen auch die Achtung vor den Büchern
steigen muss, vor den fremden und vor den eigenen.
Wie oft sieht noch heute ein sonst peinlich recht-
licher Mann ein entliehenes Buch für vogelfrei an.
Droht doch schon ein Besitzer im 16". Jahrhundert:
Est über ille meus, caveas
deponere loco,
Si me sustuleris, für tibi
nomen erit.
Auch bei unseren eigenen
Büchern sollten wir nicht nur
den Inhalt, sondern auch das
Kleid höher schätzen, Papier,
Druck und Einband. Man
weiss, wie oft bei uns selbst
Leute von Geist und Mitteln
sich mit den bescheidensten
Ansprüchen an das Aeussere
der Bücher begnügen. Wer
ein gefälliges Bücherzeichen
besitzt, wird auch jedem
Buche seinenEinband gönnen,
wird hin und wieder Muster
und Farbe der Vorsatzpapiere
prüfen, wird gelegentlich
die Vignetten und Illu-
strationen mit der Zeichnung
seines Blättchens vergleichen,
wird das Buch als Kunstwerk
ansehen lernen. Vom Ex-libris ist es nicht weit
zum Buchornament, dem wir Deutsche so dringend
Freunde wünschen müssen.
So kann unsere Kunst aus dem unscheinbaren
Gebrauch mancherlei Gewinn ziehen und darf es
sich gefallen lassen, dass die Ex-libris seit etwa
25 Jahren Mode geworden sind. Das Sammeln hat
zuerst in England und in Deutschland begonnen.
Die ersten Aufsätze sind ebendort erschienen, das
erste Buch rührt von einem Franzosen her; den
frühesten Versuch, die Bücherzeichen eines Landes
aufzuzählen, hat Warnecke für die deutschen Ex-
libris gemacht. Dass sich die Freunde und Sammler
des kleinen Gebietes sogar zu eigenen Vereinen
verbündet haben, ist nicht ohne Nutzen gewesen;
es sind daraus Zeitschriften in deutscher, englischer
und französischer Sprache hervorgegangen. Neben
den Privatsammlern haben sich auch einige Biblio-
theken entschlossen, ihren Besitz an alten Ex-libris
zusammenzustellen; der verstorbene Architekt Rudolf
Springer hat seine reichhaltige Sammlung dem Kunst-
gewerbe-Museum in Berlin vermacht.
Wir Deutschen haben um so mehr Grund, uns
der älteren Bücherzeichen zu freuen, als ja die
Gattung in Deutschland entstanden und künstlerisch
gereift ist. Im Mittelalter hatten die Besitzer ge-
legentlich ihren Namen und ihr Wappen in die
Codices gemalt. Als durch den Buchdruck der
C 266 D