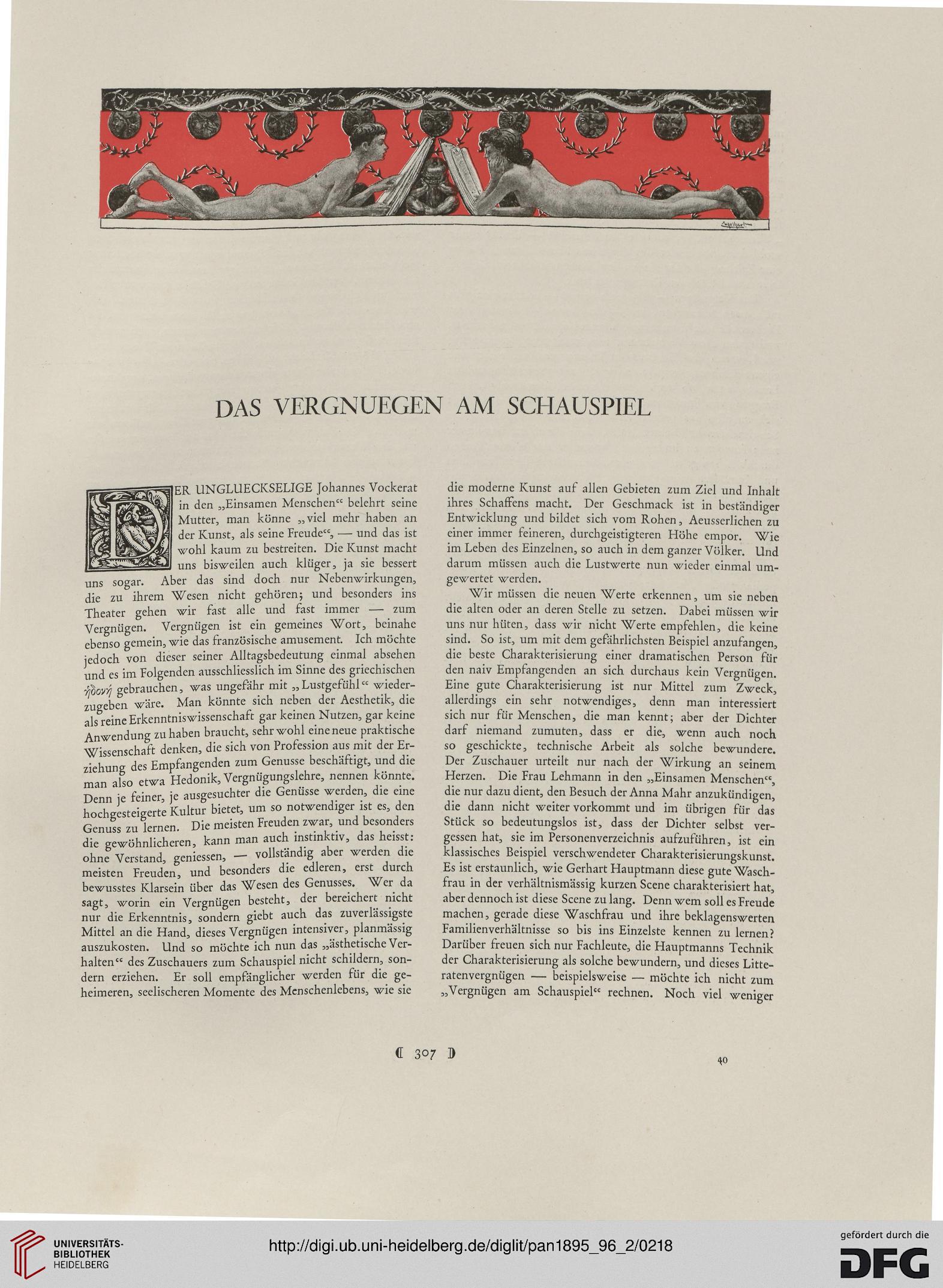DAS VERGNUEGEN AM SCHAUSPIEL
ER UNGLUECKSELIGE Johannes Vockerat
in den „Einsamen Menschen" belehrt seine
Mutter, man könne „viel mehr haben an
der Kunst, als seine Freude", — und das ist
wohl kaum zu bestreiten. Die Kunst macht
_ uns bisweilen auch klüger, ja sie bessert
uns sogar. Aber das sind doch nur Nebenwirkungen,
die zu ihrem Wesen nicht gehören5 und besonders ins
Theater gehen wir fast alle und fast immer — zum
Vergnügen. Vergnügen ist ein gemeines Wort, beinahe
ebenso gemein, wie das französische amusement. Ich möchte
jedoch von dieser seiner Alltagsbedeutung einmal absehen
und es im Folgenden ausschliesslich im Sinne des griechischen
■fjbovvj gebrauchen, was ungefähr mit „Lustgefühl" wieder-
zugeben wäre. Man könnte sich neben der Aesthetik, die
als reine Erkenntniswissenschaft gar keinen Nutzen, gar keine
Anwendung zuhaben braucht, sehr wohl eine neue praktische
Wissenschaft denken, die sich von Profession aus mit der Er-
ziehung des Empfangenden zum Genüsse beschäftigt, und die
man also etwa Hedonik, Vergnügungslehre, nennen könnte.
Denn je feiner, je ausgesuchter die Genüsse werden, die eine
hochgesteigerte Kultur bietet, um so notwendiger ist es, den
Genuss zu lernen. Die meisten Freuden zwar, und besonders
die gewöhnlicheren, kann man auch instinktiv, das heisst:
ohne Verstand, geniessen, - vollständig aber werden die
meisten Freuden, und besonders die edleren, erst durch
bewusstes Klarsein über das Wesen des Genusses. Wer da
sagt, worin ein Vergnügen besteht, der bereichert nicht
nur die Erkenntnis, sondern giebt auch das zuverlässigste
Mittel an die Hand, dieses Vergnügen intensiver, planmässig
auszukosten. Und so möchte ich nun das „ästhetische Ver-
halten" des Zuschauers zum Schauspiel nicht schildern, son-
dern erziehen. Er soll empfänglicher werden für die ge-
heimeren, seelischeren Momente des Menschenlebens, wie sie
die moderne Kunst auf allen Gebieten zum Ziel und Inhalt
ihres Schaffens macht. Der Geschmack ist in beständiger
Entwicklung und bildet sich vom Rohen, Aeusserlichen zu
einer immer feineren, durchgeistigteren Höhe empor. Wie
im Leben des Einzelnen, so auch in dem ganzer Völker. Und
darum müssen auch die Lustwerte nun wieder einmal um-
gewertet werden.
Wir müssen die neuen Werte erkennen, um sie neben
die alten oder an deren Stelle zu setzen. Dabei müssen wir
uns nur hüten, dass wir nicht Werte empfehlen, die keine
sind. So ist, um mit dem gefährlichsten Beispiel anzufangen,
die beste Charakterisierung einer dramatischen Person für
den naiv Empfangenden an sich durchaus kein Vergnügen.
Eine gute Charakterisierung ist nur Mittel zum Zweck,
allerdings ein sehr notwendiges, denn man interessiert
sich nur für Menschen, die man kennt; aber der Dichter
darf niemand zumuten, dass er die, wenn auch noch
so geschickte, technische Arbeit als solche bewundere.
Der Zuschauer urteilt nur nach der Wirkung an seinem
Herzen. Die Frau Lehmann in den „Einsamen Menschen",
die nur dazu dient, den Besuch der Anna Mahr anzukündigen,
die dann nicht weiter vorkommt und im übrigen für das
Stück so bedeutungslos ist, dass der Dichter selbst ver-
gessen hat, sie im Personenverzeichnis aufzuführen, ist ein
klassisches Beispiel verschwendeter Charakterisierungskunst.
Es ist erstaunlich, wie Gerhart Hauptmann diese gute Wasch-
frau in der verhältnismässig kurzen Scene charakterisiert hat,
aber dennoch ist diese Scene zu lang. Denn wem soll es Freude
machen, gerade diese Waschfrau und ihre beklagenswerten
Familienverhältnisse so bis ins Einzelste kennen zu lernen?
Darüber freuen sich nur Fachleute, die Hauptmanns Technik
der Charakterisierung als solche bewundern, und dieses Litte-
ratenvergnügen — beispielsweise — möchte ich nicht zum
„Vergnügen am Schauspiel" rechnen. Noch viel weniger
C 307 »
40
ER UNGLUECKSELIGE Johannes Vockerat
in den „Einsamen Menschen" belehrt seine
Mutter, man könne „viel mehr haben an
der Kunst, als seine Freude", — und das ist
wohl kaum zu bestreiten. Die Kunst macht
_ uns bisweilen auch klüger, ja sie bessert
uns sogar. Aber das sind doch nur Nebenwirkungen,
die zu ihrem Wesen nicht gehören5 und besonders ins
Theater gehen wir fast alle und fast immer — zum
Vergnügen. Vergnügen ist ein gemeines Wort, beinahe
ebenso gemein, wie das französische amusement. Ich möchte
jedoch von dieser seiner Alltagsbedeutung einmal absehen
und es im Folgenden ausschliesslich im Sinne des griechischen
■fjbovvj gebrauchen, was ungefähr mit „Lustgefühl" wieder-
zugeben wäre. Man könnte sich neben der Aesthetik, die
als reine Erkenntniswissenschaft gar keinen Nutzen, gar keine
Anwendung zuhaben braucht, sehr wohl eine neue praktische
Wissenschaft denken, die sich von Profession aus mit der Er-
ziehung des Empfangenden zum Genüsse beschäftigt, und die
man also etwa Hedonik, Vergnügungslehre, nennen könnte.
Denn je feiner, je ausgesuchter die Genüsse werden, die eine
hochgesteigerte Kultur bietet, um so notwendiger ist es, den
Genuss zu lernen. Die meisten Freuden zwar, und besonders
die gewöhnlicheren, kann man auch instinktiv, das heisst:
ohne Verstand, geniessen, - vollständig aber werden die
meisten Freuden, und besonders die edleren, erst durch
bewusstes Klarsein über das Wesen des Genusses. Wer da
sagt, worin ein Vergnügen besteht, der bereichert nicht
nur die Erkenntnis, sondern giebt auch das zuverlässigste
Mittel an die Hand, dieses Vergnügen intensiver, planmässig
auszukosten. Und so möchte ich nun das „ästhetische Ver-
halten" des Zuschauers zum Schauspiel nicht schildern, son-
dern erziehen. Er soll empfänglicher werden für die ge-
heimeren, seelischeren Momente des Menschenlebens, wie sie
die moderne Kunst auf allen Gebieten zum Ziel und Inhalt
ihres Schaffens macht. Der Geschmack ist in beständiger
Entwicklung und bildet sich vom Rohen, Aeusserlichen zu
einer immer feineren, durchgeistigteren Höhe empor. Wie
im Leben des Einzelnen, so auch in dem ganzer Völker. Und
darum müssen auch die Lustwerte nun wieder einmal um-
gewertet werden.
Wir müssen die neuen Werte erkennen, um sie neben
die alten oder an deren Stelle zu setzen. Dabei müssen wir
uns nur hüten, dass wir nicht Werte empfehlen, die keine
sind. So ist, um mit dem gefährlichsten Beispiel anzufangen,
die beste Charakterisierung einer dramatischen Person für
den naiv Empfangenden an sich durchaus kein Vergnügen.
Eine gute Charakterisierung ist nur Mittel zum Zweck,
allerdings ein sehr notwendiges, denn man interessiert
sich nur für Menschen, die man kennt; aber der Dichter
darf niemand zumuten, dass er die, wenn auch noch
so geschickte, technische Arbeit als solche bewundere.
Der Zuschauer urteilt nur nach der Wirkung an seinem
Herzen. Die Frau Lehmann in den „Einsamen Menschen",
die nur dazu dient, den Besuch der Anna Mahr anzukündigen,
die dann nicht weiter vorkommt und im übrigen für das
Stück so bedeutungslos ist, dass der Dichter selbst ver-
gessen hat, sie im Personenverzeichnis aufzuführen, ist ein
klassisches Beispiel verschwendeter Charakterisierungskunst.
Es ist erstaunlich, wie Gerhart Hauptmann diese gute Wasch-
frau in der verhältnismässig kurzen Scene charakterisiert hat,
aber dennoch ist diese Scene zu lang. Denn wem soll es Freude
machen, gerade diese Waschfrau und ihre beklagenswerten
Familienverhältnisse so bis ins Einzelste kennen zu lernen?
Darüber freuen sich nur Fachleute, die Hauptmanns Technik
der Charakterisierung als solche bewundern, und dieses Litte-
ratenvergnügen — beispielsweise — möchte ich nicht zum
„Vergnügen am Schauspiel" rechnen. Noch viel weniger
C 307 »
40