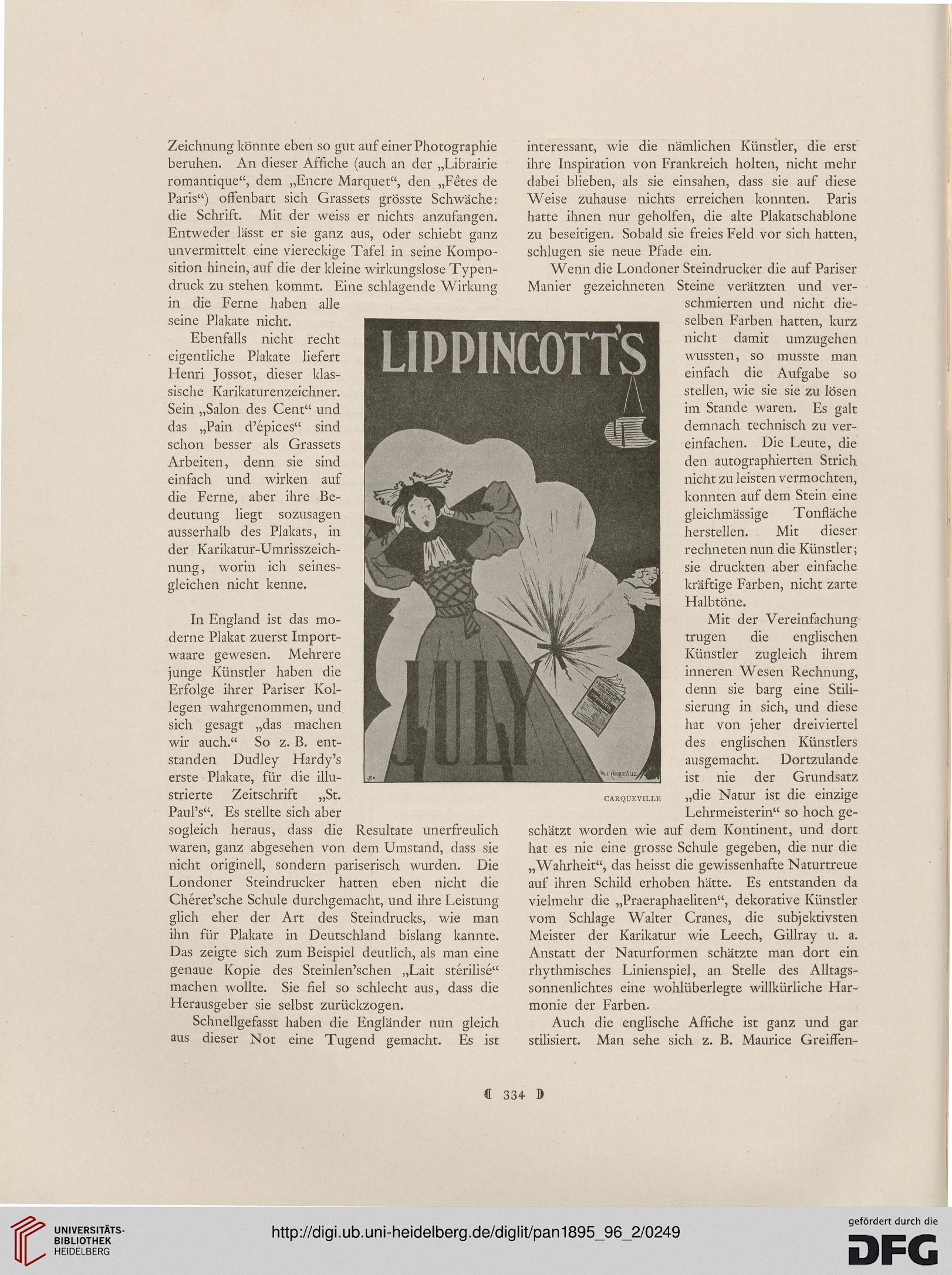Zeichnung könnte eben so gut auf einer Photographie
beruhen. An dieser Affiche (auch an der „Librairie
romantique", dem „Encre Marquet", den „Fetes de
Paris") offenbart sich Grassets grösste Schwäche:
die Schrift. Mit der weiss er nichts anzufangen.
Entweder lässt er sie ganz aus, oder schiebt ganz
unvermittelt eine viereckige Tafel in seine Kompo-
sition hinein, auf die der kleine wirkungslose Typen-
druck zu stehen kommt. Eine schlagende Wirkung
in die Ferne haben alle
seine Plakate nicht.
Ebenfalls nicht recht
eigentliche Plakate liefert
Henri Jossot, dieser klas-
sische Karikaturenzeichner.
Sein „Salon des Cent" und
das „Pain d'epices" sind
schon besser als Grassets
Arbeiten, denn sie sind
einfach und wirken auf
die Ferne, aber ihre Be-
deutung liegt sozusagen
ausserhalb des Plakats, in
der Karikatur-Umrisszeich-
nung, worin ich seines-
gleichen nicht kenne.
In England ist das mo-
derne Plakat zuerst Import-
waare gewesen. Mehrere
junge Künstler haben die
Erfolge ihrer Pariser Kol-
legen wahrgenommen, und
sich gesagt „das machen
wir auch." So z. B. ent-
standen Dudley Hardy's
erste Plakate, für die illu-
strierte Zeitschrift „St.
PauPs". Es stellte sich aber
sogleich heraus, dass die Resultate unerfreulich
waren, ganz abgesehen von dem Umstand, dass sie
nicht originell, sondern pariserisch wurden. Die
Londoner Steindrucker hatten eben nicht die
Cheret'sche Schule durchgemacht, und ihre Leistung
glich eher der Art des Steindrucks, wie man
ihn für Plakate in Deutschland bislang kannte.
Das zeigte sich zum Beispiel deutlich, als man eine
genaue Kopie des Steinlen'schen „Lait sterilise"
machen wollte. Sie fiel so schlecht aus, dass die
Herausgeber sie selbst zurückzogen.
Schnellgefasst haben die Engländer nun gleich
aus dieser Not eine Tugend gemacht. Es ist
interessant, wie die nämlichen Künstler, die erst
ihre Inspiration von Frankreich holten, nicht mehr
dabei blieben, als sie einsahen, dass sie auf diese
Weise zuhause nichts erreichen konnten. Paris
hatte ihnen nur geholfen, die alte Plakatschablone
zu beseitigen. Sobald sie freies Feld vor sich hatten,
schlugen sie neue Pfade ein.
Wenn die Londoner Steindrucker die auf Pariser
Manier gezeichneten Steine verätzten und ver-
schmierten und nicht die-
selben Farben hatten, kurz
nicht damit umzugehen
wussten, so musste man
einfach die Aufgabe so
stellen, wie sie sie zu lösen
im Stande waren. Es galt
demnach technisch zu ver-
einfachen. Die Leute, die
den autographierten Strich
nicht zu leisten vermochten,
konnten auf dem Stein eine
gleichmässige Tonfläche
herstellen. Mit dieser
rechneten nun die Künstler;
sie druckten aber einfache
kräftige Farben, nicht zarte
Halbtöne.
Mit der Vereinfachung
trugen die englischen
Künstler zugleich ihrem
inneren Wesen Rechnung,
denn sie barg eine Stili-
sierung in sich, und diese
hat von jeher dreiviertel
des englischen Künstlers
ausgemacht. Dortzulande
ist nie der Grundsatz
„die Natur ist die einzige
Lehrmeisterin" so hoch ge-
schätzt worden wie auf dem Kontinent, und dort
hat es nie eine grosse Schule gegeben, die nur die
„Wahrheit", das heisst die gewissenhafte Naturtreue
auf ihren Schild erhoben hätte. Es entstanden da
vielmehr die „Praeraphaeliten", dekorative Künstler
vom Schlage Walter Cranes, die subjektivsten
Meister der Karikatur wie Leech, Gillray u. a.
Anstatt der Naturformen schätzte man dort ein
rhythmisches Linienspiel, an Stelle des Alltags-
sonnenlichtes eine wohlüberlegte willkürliche Har-
monie der Farben.
Auch die englische Affiche ist ganz und gar
stilisiert. Man sehe sich z. B. Maurice Greiffen-
CARQUEVILLE
€ 334 D
beruhen. An dieser Affiche (auch an der „Librairie
romantique", dem „Encre Marquet", den „Fetes de
Paris") offenbart sich Grassets grösste Schwäche:
die Schrift. Mit der weiss er nichts anzufangen.
Entweder lässt er sie ganz aus, oder schiebt ganz
unvermittelt eine viereckige Tafel in seine Kompo-
sition hinein, auf die der kleine wirkungslose Typen-
druck zu stehen kommt. Eine schlagende Wirkung
in die Ferne haben alle
seine Plakate nicht.
Ebenfalls nicht recht
eigentliche Plakate liefert
Henri Jossot, dieser klas-
sische Karikaturenzeichner.
Sein „Salon des Cent" und
das „Pain d'epices" sind
schon besser als Grassets
Arbeiten, denn sie sind
einfach und wirken auf
die Ferne, aber ihre Be-
deutung liegt sozusagen
ausserhalb des Plakats, in
der Karikatur-Umrisszeich-
nung, worin ich seines-
gleichen nicht kenne.
In England ist das mo-
derne Plakat zuerst Import-
waare gewesen. Mehrere
junge Künstler haben die
Erfolge ihrer Pariser Kol-
legen wahrgenommen, und
sich gesagt „das machen
wir auch." So z. B. ent-
standen Dudley Hardy's
erste Plakate, für die illu-
strierte Zeitschrift „St.
PauPs". Es stellte sich aber
sogleich heraus, dass die Resultate unerfreulich
waren, ganz abgesehen von dem Umstand, dass sie
nicht originell, sondern pariserisch wurden. Die
Londoner Steindrucker hatten eben nicht die
Cheret'sche Schule durchgemacht, und ihre Leistung
glich eher der Art des Steindrucks, wie man
ihn für Plakate in Deutschland bislang kannte.
Das zeigte sich zum Beispiel deutlich, als man eine
genaue Kopie des Steinlen'schen „Lait sterilise"
machen wollte. Sie fiel so schlecht aus, dass die
Herausgeber sie selbst zurückzogen.
Schnellgefasst haben die Engländer nun gleich
aus dieser Not eine Tugend gemacht. Es ist
interessant, wie die nämlichen Künstler, die erst
ihre Inspiration von Frankreich holten, nicht mehr
dabei blieben, als sie einsahen, dass sie auf diese
Weise zuhause nichts erreichen konnten. Paris
hatte ihnen nur geholfen, die alte Plakatschablone
zu beseitigen. Sobald sie freies Feld vor sich hatten,
schlugen sie neue Pfade ein.
Wenn die Londoner Steindrucker die auf Pariser
Manier gezeichneten Steine verätzten und ver-
schmierten und nicht die-
selben Farben hatten, kurz
nicht damit umzugehen
wussten, so musste man
einfach die Aufgabe so
stellen, wie sie sie zu lösen
im Stande waren. Es galt
demnach technisch zu ver-
einfachen. Die Leute, die
den autographierten Strich
nicht zu leisten vermochten,
konnten auf dem Stein eine
gleichmässige Tonfläche
herstellen. Mit dieser
rechneten nun die Künstler;
sie druckten aber einfache
kräftige Farben, nicht zarte
Halbtöne.
Mit der Vereinfachung
trugen die englischen
Künstler zugleich ihrem
inneren Wesen Rechnung,
denn sie barg eine Stili-
sierung in sich, und diese
hat von jeher dreiviertel
des englischen Künstlers
ausgemacht. Dortzulande
ist nie der Grundsatz
„die Natur ist die einzige
Lehrmeisterin" so hoch ge-
schätzt worden wie auf dem Kontinent, und dort
hat es nie eine grosse Schule gegeben, die nur die
„Wahrheit", das heisst die gewissenhafte Naturtreue
auf ihren Schild erhoben hätte. Es entstanden da
vielmehr die „Praeraphaeliten", dekorative Künstler
vom Schlage Walter Cranes, die subjektivsten
Meister der Karikatur wie Leech, Gillray u. a.
Anstatt der Naturformen schätzte man dort ein
rhythmisches Linienspiel, an Stelle des Alltags-
sonnenlichtes eine wohlüberlegte willkürliche Har-
monie der Farben.
Auch die englische Affiche ist ganz und gar
stilisiert. Man sehe sich z. B. Maurice Greiffen-
CARQUEVILLE
€ 334 D