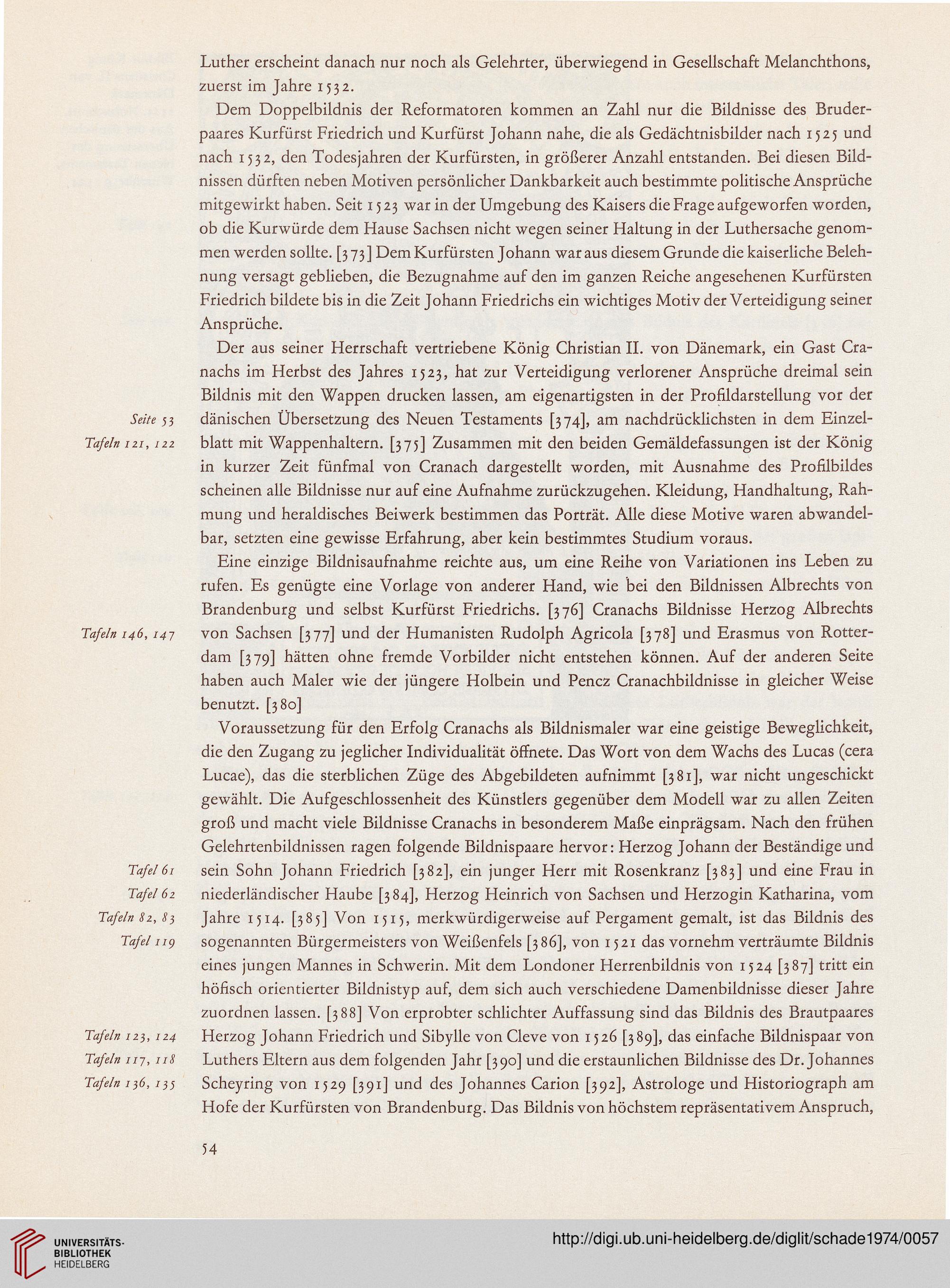Luther erscheint danach nur noch als Gelehrter, überwiegend in Gesellschaft Melanchthons,
zuerst im Jahre 1532.
Dem Doppelbildnis der Reformatoren kommen an Zahl nur die Bildnisse des Bruder-
paares Kurfürst Friedrich und Kurfürst Johann nahe, die als Gedächtnisbilder nach 1525 und
nach 1532, den Todesjahren der Kurfürsten, in größerer Anzahl entstanden. Bei diesen Bild-
nissen dürften neben Motiven persönlicher Dankbarkeit auch bestimmte politische Ansprüche
mitgewirkt haben. Seit 1523 war in der Umgebung des Kaisers die Frage aufgeworfen worden,
ob die Kurwürde dem Hause Sachsen nicht wegen seiner Haltung in der Luthersache genom-
men werden sollte. [373] Dem Kurfürsten Johann war aus diesem Grunde die kaiserliche Beleh-
nung versagt geblieben, die Bezugnahme auf den im ganzen Reiche angesehenen Kurfürsten
Friedrich bildete bis in die Zeit Johann Friedrichs ein wichtiges Motiv der Verteidigung seiner
Ansprüche.
Der aus seiner Herrschaft vertriebene König Christian II. von Dänemark, ein Gast Cra-
nachs im Herbst des Jahres 1523, hat zur Verteidigung verlorener Ansprüche dreimal sein
Bildnis mit den Wappen drucken lassen, am eigenartigsten in der Profildarstellung vor der
Seite 53 dänischen Übersetzung des Neuen Testaments [374], am nachdrücklichsten in dem Einzel-
Tafeln 121, izz blatt mit Wappenhaltern. [375] Zusammen mit den beiden Gemäldefassungen ist der König
in kurzer Zeit fünfmal von Cranach dargestellt worden, mit Ausnahme des Profilbildes
scheinen alle Bildnisse nur auf eine Aufnahme zurückzugehen. Kleidung, Handhaltung, Rah-
mung und heraldisches Beiwerk bestimmen das Porträt. Alle diese Motive waren abwandel-
bar, setzten eine gewisse Erfahrung, aber kein bestimmtes Studium voraus.
Eine einzige Bildnisaufnahme reichte aus, um eine Reihe von Variationen ins Leben zu
rufen. Es genügte eine Vorlage von anderer Hand, wie bei den Bildnissen Albrechts von
Brandenburg und selbst Kurfürst Friedrichs. [376] Cranachs Bildnisse Herzog Albrechts
Tafeln 146, 147 von Sachsen [377] und der Humanisten Rudolph Agricola [378] und Erasmus von Rotter-
dam [379] hätten ohne fremde Vorbilder nicht entstehen können. Auf der anderen Seite
haben auch Maler wie der jüngere Holbein und Pencz Cranachbildnisse in gleicher Weise
benutzt. [380]
Voraussetzung für den Erfolg Cranachs als Bildnismaler war eine geistige Beweglichkeit,
die den Zugang zu jeglicher Individualität öffnete. Das Wort von dem Wachs des Lucas (cera
Lucae), das die sterblichen Züge des Abgebildeten aufnimmt [381], war nicht ungeschickt
gewählt. Die Aufgeschlossenheit des Künstlers gegenüber dem Modell war zu allen Zeiten
groß und macht viele Bildnisse Cranachs in besonderem Maße einprägsam. Nach den frühen
Gelehrtenbildnissen ragen folgende Bildnispaare hervor: Herzog Johann der Beständige und
Tafel 61 sein Sohn Johann Friedrich [382], ein junger Herr mit Rosenkranz [383] und eine Frau in
Tafel 62 niederländischer Haube [384], Herzog Heinrich von Sachsen und Herzogin Katharina, vom
Tafeln 82, 8$ Jahre 1514. [385] Von 1515, merkwürdigerweise auf Pergament gemalt, ist das Bildnis des
Tafel ng sogenannten Bürgermeisters von Weißenfels [386], von 1521 das vornehm verträumte Bildnis
eines jungen Mannes in Schwerin. Mit dem Londoner Herrenbildnis von 1524 [387] tritt ein
höfisch orientierter Bildnistyp auf, dem sich auch verschiedene Damenbildnisse dieser Jahre
zuordnen lassen. [388] Von erprobter schlichter Auffassung sind das Bildnis des Brautpaares
Tafeln 12$, 124 Herzog Johann Friedrich und Sibylle von Cleve von 1526 [389], das einfache Bildnispaar von
Tafeln 117, 118 Luthers Eltern aus dem folgenden Jahr [390] und die erstaunlichen Bildnisse des Dr. Johannes
Tafeln 136, 735 Scheyring von 1529 [391] und des Johannes Carion [392], Astrologe und Historiograph am
Hofe der Kurfürsten von Brandenburg. Das Bildnis von höchstem repräsentativem Anspruch,
54
zuerst im Jahre 1532.
Dem Doppelbildnis der Reformatoren kommen an Zahl nur die Bildnisse des Bruder-
paares Kurfürst Friedrich und Kurfürst Johann nahe, die als Gedächtnisbilder nach 1525 und
nach 1532, den Todesjahren der Kurfürsten, in größerer Anzahl entstanden. Bei diesen Bild-
nissen dürften neben Motiven persönlicher Dankbarkeit auch bestimmte politische Ansprüche
mitgewirkt haben. Seit 1523 war in der Umgebung des Kaisers die Frage aufgeworfen worden,
ob die Kurwürde dem Hause Sachsen nicht wegen seiner Haltung in der Luthersache genom-
men werden sollte. [373] Dem Kurfürsten Johann war aus diesem Grunde die kaiserliche Beleh-
nung versagt geblieben, die Bezugnahme auf den im ganzen Reiche angesehenen Kurfürsten
Friedrich bildete bis in die Zeit Johann Friedrichs ein wichtiges Motiv der Verteidigung seiner
Ansprüche.
Der aus seiner Herrschaft vertriebene König Christian II. von Dänemark, ein Gast Cra-
nachs im Herbst des Jahres 1523, hat zur Verteidigung verlorener Ansprüche dreimal sein
Bildnis mit den Wappen drucken lassen, am eigenartigsten in der Profildarstellung vor der
Seite 53 dänischen Übersetzung des Neuen Testaments [374], am nachdrücklichsten in dem Einzel-
Tafeln 121, izz blatt mit Wappenhaltern. [375] Zusammen mit den beiden Gemäldefassungen ist der König
in kurzer Zeit fünfmal von Cranach dargestellt worden, mit Ausnahme des Profilbildes
scheinen alle Bildnisse nur auf eine Aufnahme zurückzugehen. Kleidung, Handhaltung, Rah-
mung und heraldisches Beiwerk bestimmen das Porträt. Alle diese Motive waren abwandel-
bar, setzten eine gewisse Erfahrung, aber kein bestimmtes Studium voraus.
Eine einzige Bildnisaufnahme reichte aus, um eine Reihe von Variationen ins Leben zu
rufen. Es genügte eine Vorlage von anderer Hand, wie bei den Bildnissen Albrechts von
Brandenburg und selbst Kurfürst Friedrichs. [376] Cranachs Bildnisse Herzog Albrechts
Tafeln 146, 147 von Sachsen [377] und der Humanisten Rudolph Agricola [378] und Erasmus von Rotter-
dam [379] hätten ohne fremde Vorbilder nicht entstehen können. Auf der anderen Seite
haben auch Maler wie der jüngere Holbein und Pencz Cranachbildnisse in gleicher Weise
benutzt. [380]
Voraussetzung für den Erfolg Cranachs als Bildnismaler war eine geistige Beweglichkeit,
die den Zugang zu jeglicher Individualität öffnete. Das Wort von dem Wachs des Lucas (cera
Lucae), das die sterblichen Züge des Abgebildeten aufnimmt [381], war nicht ungeschickt
gewählt. Die Aufgeschlossenheit des Künstlers gegenüber dem Modell war zu allen Zeiten
groß und macht viele Bildnisse Cranachs in besonderem Maße einprägsam. Nach den frühen
Gelehrtenbildnissen ragen folgende Bildnispaare hervor: Herzog Johann der Beständige und
Tafel 61 sein Sohn Johann Friedrich [382], ein junger Herr mit Rosenkranz [383] und eine Frau in
Tafel 62 niederländischer Haube [384], Herzog Heinrich von Sachsen und Herzogin Katharina, vom
Tafeln 82, 8$ Jahre 1514. [385] Von 1515, merkwürdigerweise auf Pergament gemalt, ist das Bildnis des
Tafel ng sogenannten Bürgermeisters von Weißenfels [386], von 1521 das vornehm verträumte Bildnis
eines jungen Mannes in Schwerin. Mit dem Londoner Herrenbildnis von 1524 [387] tritt ein
höfisch orientierter Bildnistyp auf, dem sich auch verschiedene Damenbildnisse dieser Jahre
zuordnen lassen. [388] Von erprobter schlichter Auffassung sind das Bildnis des Brautpaares
Tafeln 12$, 124 Herzog Johann Friedrich und Sibylle von Cleve von 1526 [389], das einfache Bildnispaar von
Tafeln 117, 118 Luthers Eltern aus dem folgenden Jahr [390] und die erstaunlichen Bildnisse des Dr. Johannes
Tafeln 136, 735 Scheyring von 1529 [391] und des Johannes Carion [392], Astrologe und Historiograph am
Hofe der Kurfürsten von Brandenburg. Das Bildnis von höchstem repräsentativem Anspruch,
54