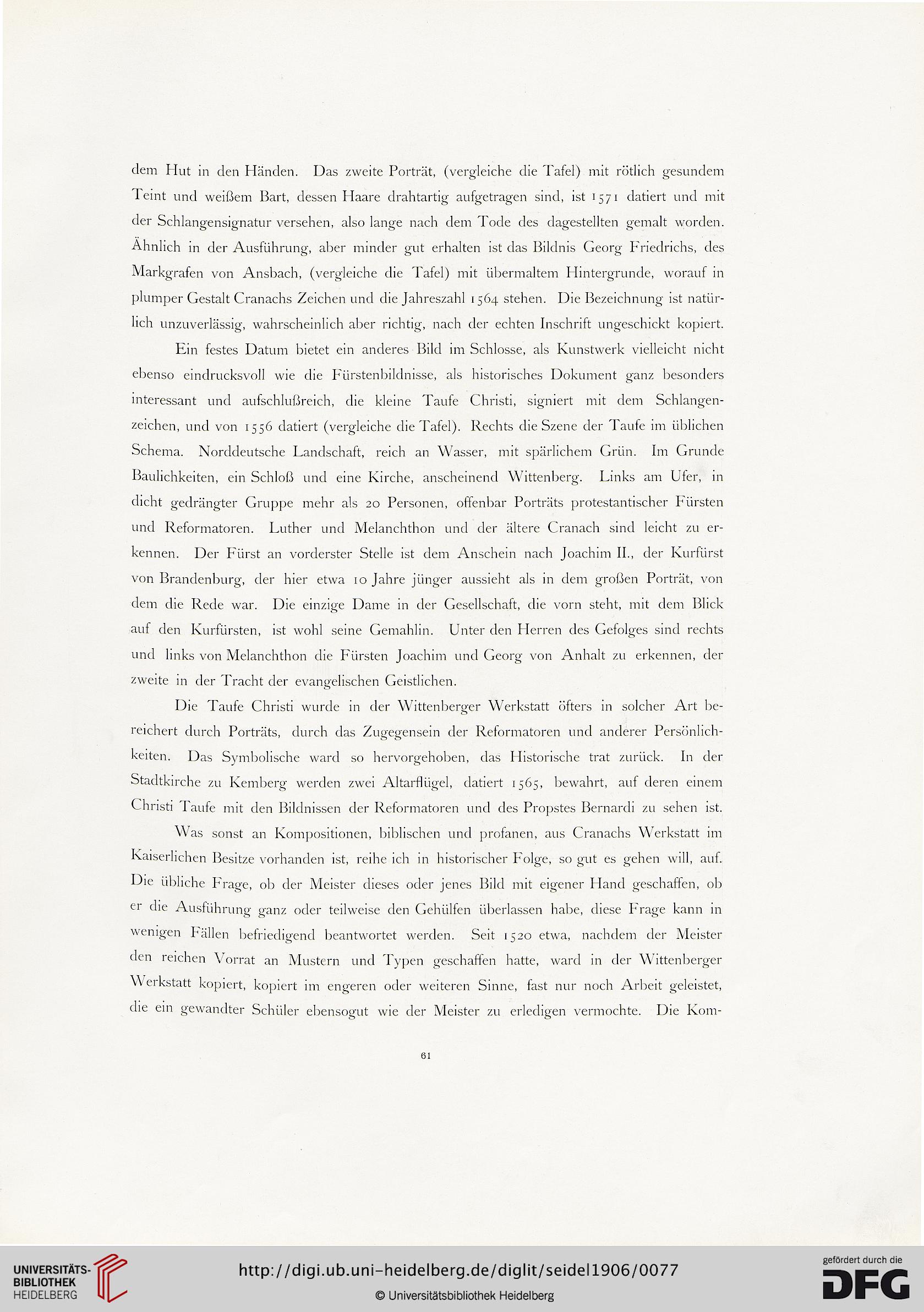dem Hut in den Händen. Das zweite Porträt, (vergleiche die Tafel) mit rötlich gesundem
Teint und weißem Bart, dessen Haare drahtartig aufgetragen sind, ist 1571 datiert und mit
der Schlangensignatur versehen, also lange nach dem Tode des dagestellten gemalt worden.
Ähnlich in der Ausführung, aber minder gut erhalten ist das Bildnis Georg Friedrichs, des
Markgrafen von Ansbach, (vergleiche die Tafel) mit übermaltem Hintergrunde, worauf in
plumper Gestalt Cranachs Zeichen und die Jahreszahl 1564 stehen. Die Bezeichnung ist natür-
lich unzuverlässig, wahrscheinlich aber richtig, nach der echten Inschrift ungeschickt kopiert.
Ein festes Datum bietet ein anderes Bild im Schlosse, als Kunstwerk vielleicht nicht
ebenso eindrucksvoll wie die Fürstenbildnisse, als historisches Dokument ganz besonders
interessant und aufschlußreich, die kleine Taufe Christi, signiert mit dem Schlangen-
zeichen, und von 1556 datiert (vergleiche die Tafel). Rechts die Szene der Taufe im üblichen
Schema. Norddeutsche Landschaft, reich an Wasser, mit spärlichem Grün. Im Grunde
Baulichkeiten, ein Schloß und eine Kirche, anscheinend Wittenberg. Links am Ufer, in
dicht gedrängter Gruppe mehr als 20 Personen, offenbar Porträts protestantischer Fürsten
und Reformatoren. Luther und Melanchthon und der ältere Cranach sind leicht zu er-
kennen. Der Fürst an vorderster Stelle ist dem Anschein nach Joachim IL, der Kurfürst
von Brandenburg, der hier etwa 10 Jahre jünger aussieht als in dem großen Porträt, von
dem die Rede war. Die einzige Dame in der Gesellschaft, die vorn steht, mit dem Blick
auf den Kurfürsten, ist wohl seine Gemahlin. Unter den Herren des Gefolges sind rechts
und links von Melanchthon die Fürsten Joachim und Georg von Anhalt zu erkennen, der
zweite in der Tracht der evangelischen Geistlichen.
Die Taufe Christi wurde in der Wittenberger Werkstatt öfters in solcher Art be-
reichert durch Porträts, durch das Zugegensein der Reformatoren und anderer Persönlich-
keiten. Das Symbolische ward so hervorgehoben, das Historische trat zurück. In der
Stadtkirche zu Remberg werden zwei Altarflügel, datiert 1565, bewahrt, auf deren einem
Christi Taufe mit den Bildnissen der Reformatoren und des Propstes Bernardi zu sehen ist.
Was sonst an Kompositionen, biblischen und profanen, aus Cranachs Werkstatt im
Kaiserlichen Besitze vorhanden ist, reihe ich in historischer Folge, so gut es gehen will, auf.
Die übliche Frage, ob der Meister dieses oder jenes Bild mit eigener Hand geschaffen, ob
er die Ausführung ganz oder teilweise den Gehülfen überlassen habe, diese Präge kann in
wenigen p allen befriedigend beantwortet werden. Seit 1520 etwa, nachdem der Meister
den reichen Vorrat an Mustern und Typen geschaffen hatte, ward in der Wittenberger
Werkstatt kopiert, kopiert im engeren oder weiteren Sinne, fast nur noch Arbeit geleistet,
die ein gewandter Schüler ebensogut wie der Meister zu erledigen vermochte. Die Kom-
61
Teint und weißem Bart, dessen Haare drahtartig aufgetragen sind, ist 1571 datiert und mit
der Schlangensignatur versehen, also lange nach dem Tode des dagestellten gemalt worden.
Ähnlich in der Ausführung, aber minder gut erhalten ist das Bildnis Georg Friedrichs, des
Markgrafen von Ansbach, (vergleiche die Tafel) mit übermaltem Hintergrunde, worauf in
plumper Gestalt Cranachs Zeichen und die Jahreszahl 1564 stehen. Die Bezeichnung ist natür-
lich unzuverlässig, wahrscheinlich aber richtig, nach der echten Inschrift ungeschickt kopiert.
Ein festes Datum bietet ein anderes Bild im Schlosse, als Kunstwerk vielleicht nicht
ebenso eindrucksvoll wie die Fürstenbildnisse, als historisches Dokument ganz besonders
interessant und aufschlußreich, die kleine Taufe Christi, signiert mit dem Schlangen-
zeichen, und von 1556 datiert (vergleiche die Tafel). Rechts die Szene der Taufe im üblichen
Schema. Norddeutsche Landschaft, reich an Wasser, mit spärlichem Grün. Im Grunde
Baulichkeiten, ein Schloß und eine Kirche, anscheinend Wittenberg. Links am Ufer, in
dicht gedrängter Gruppe mehr als 20 Personen, offenbar Porträts protestantischer Fürsten
und Reformatoren. Luther und Melanchthon und der ältere Cranach sind leicht zu er-
kennen. Der Fürst an vorderster Stelle ist dem Anschein nach Joachim IL, der Kurfürst
von Brandenburg, der hier etwa 10 Jahre jünger aussieht als in dem großen Porträt, von
dem die Rede war. Die einzige Dame in der Gesellschaft, die vorn steht, mit dem Blick
auf den Kurfürsten, ist wohl seine Gemahlin. Unter den Herren des Gefolges sind rechts
und links von Melanchthon die Fürsten Joachim und Georg von Anhalt zu erkennen, der
zweite in der Tracht der evangelischen Geistlichen.
Die Taufe Christi wurde in der Wittenberger Werkstatt öfters in solcher Art be-
reichert durch Porträts, durch das Zugegensein der Reformatoren und anderer Persönlich-
keiten. Das Symbolische ward so hervorgehoben, das Historische trat zurück. In der
Stadtkirche zu Remberg werden zwei Altarflügel, datiert 1565, bewahrt, auf deren einem
Christi Taufe mit den Bildnissen der Reformatoren und des Propstes Bernardi zu sehen ist.
Was sonst an Kompositionen, biblischen und profanen, aus Cranachs Werkstatt im
Kaiserlichen Besitze vorhanden ist, reihe ich in historischer Folge, so gut es gehen will, auf.
Die übliche Frage, ob der Meister dieses oder jenes Bild mit eigener Hand geschaffen, ob
er die Ausführung ganz oder teilweise den Gehülfen überlassen habe, diese Präge kann in
wenigen p allen befriedigend beantwortet werden. Seit 1520 etwa, nachdem der Meister
den reichen Vorrat an Mustern und Typen geschaffen hatte, ward in der Wittenberger
Werkstatt kopiert, kopiert im engeren oder weiteren Sinne, fast nur noch Arbeit geleistet,
die ein gewandter Schüler ebensogut wie der Meister zu erledigen vermochte. Die Kom-
61