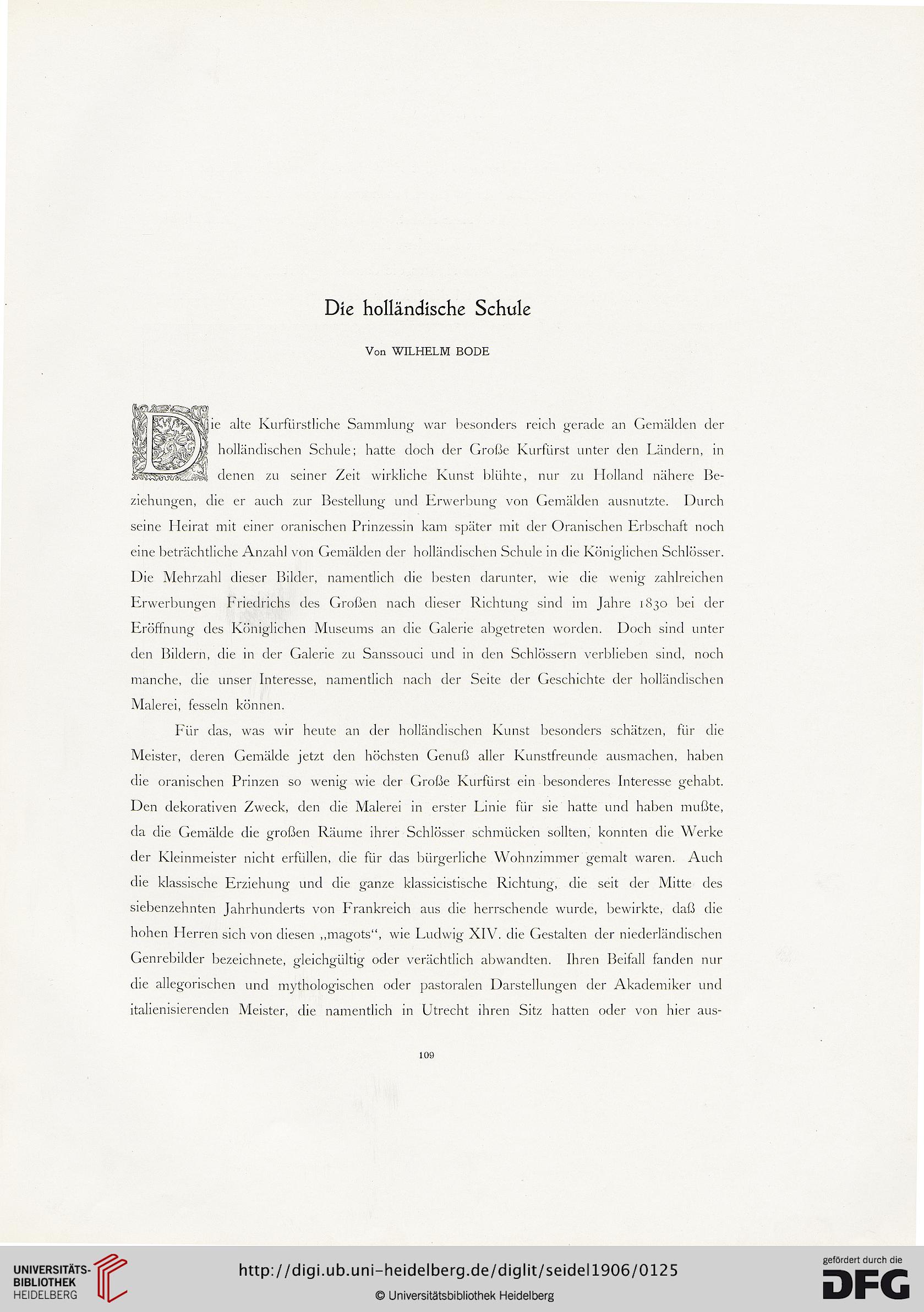Die holländische Schule
Von WILHELM BODE
lie alte Kurfürstliche Sammlung war besonders reich gerade an Gemälden der
>^MSBm holländischen Schule; hatte doch der Große Kurfürst unter den Ländern, in
t&$k denen zu seiner Zeit wirkliche Kunst blühte, nur zu Holland nähere Be-
ziehungen, die er auch zur Bestellung und Erwerbung von Gemälden ausnutzte. Durch
seine Heirat mit einer oranischen Prinzessin kam später mit der Oranischen Erbschaft noch
eine beträchtliche Anzahl von Gemälden der holländischen Schule in die Königlichen Schlösser.
Die Mehrzahl dieser Bilder, namentlich die besten darunter, wie die wenig zahlreichen
Erwerbungen Friedrichs des Großen nach dieser Richtung sind im Jahre 1830 bei der
Eröffnung des Königlichen Museums an die Galerie abgetreten worden. Doch sind unter
den Bildern, die in der Galerie zu Sanssouci und in den Schlössern verblieben sind, noch
manche, die unser Interesse, namentlich nach der Seite der Geschichte der holländischen
Malerei, fesseln können.
Für das, was wir heute an der holländischen Kunst besonders schätzen, für die
Meister, deren Gemälde jetzt den höchsten Genuß aller Kunstfreunde ausmachen, haben
die oranischen Prinzen so wenig wie der Große Kurfürst ein besonderes Interesse gehabt.
Den dekorativen Zweck, den die Malerei in erster Linie für sie hatte und haben mußte,
da die Gemälde die großen Räume ihrer Schlösser schmücken sollten, konnten die Werke
der Kleinmeister nicht erfüllen, die für das bürgerliche Wohnzimmer gemalt waren. Auch
die klassische Erziehung und die ganze klassicistische Richtung, die seit der Mitte des
siebenzehnten Jahrhunderts von Frankreich aus die herrschende wurde, bewirkte, daß die
hohen Herren sich von diesen „magots", wie Ludwig XIV. die Gestalten der niederländischen
Genrebilder bezeichnete, gleichgültig oder verächtlich abwandten. Ihren Beifall fanden nur
die allegorischen und mythologischen oder pastoralen Darstellungen der Akademiker und
italienisierenden Meister, die namentlich in Utrecht ihren Sitz hatten oder von hier aus-
109
Von WILHELM BODE
lie alte Kurfürstliche Sammlung war besonders reich gerade an Gemälden der
>^MSBm holländischen Schule; hatte doch der Große Kurfürst unter den Ländern, in
t&$k denen zu seiner Zeit wirkliche Kunst blühte, nur zu Holland nähere Be-
ziehungen, die er auch zur Bestellung und Erwerbung von Gemälden ausnutzte. Durch
seine Heirat mit einer oranischen Prinzessin kam später mit der Oranischen Erbschaft noch
eine beträchtliche Anzahl von Gemälden der holländischen Schule in die Königlichen Schlösser.
Die Mehrzahl dieser Bilder, namentlich die besten darunter, wie die wenig zahlreichen
Erwerbungen Friedrichs des Großen nach dieser Richtung sind im Jahre 1830 bei der
Eröffnung des Königlichen Museums an die Galerie abgetreten worden. Doch sind unter
den Bildern, die in der Galerie zu Sanssouci und in den Schlössern verblieben sind, noch
manche, die unser Interesse, namentlich nach der Seite der Geschichte der holländischen
Malerei, fesseln können.
Für das, was wir heute an der holländischen Kunst besonders schätzen, für die
Meister, deren Gemälde jetzt den höchsten Genuß aller Kunstfreunde ausmachen, haben
die oranischen Prinzen so wenig wie der Große Kurfürst ein besonderes Interesse gehabt.
Den dekorativen Zweck, den die Malerei in erster Linie für sie hatte und haben mußte,
da die Gemälde die großen Räume ihrer Schlösser schmücken sollten, konnten die Werke
der Kleinmeister nicht erfüllen, die für das bürgerliche Wohnzimmer gemalt waren. Auch
die klassische Erziehung und die ganze klassicistische Richtung, die seit der Mitte des
siebenzehnten Jahrhunderts von Frankreich aus die herrschende wurde, bewirkte, daß die
hohen Herren sich von diesen „magots", wie Ludwig XIV. die Gestalten der niederländischen
Genrebilder bezeichnete, gleichgültig oder verächtlich abwandten. Ihren Beifall fanden nur
die allegorischen und mythologischen oder pastoralen Darstellungen der Akademiker und
italienisierenden Meister, die namentlich in Utrecht ihren Sitz hatten oder von hier aus-
109