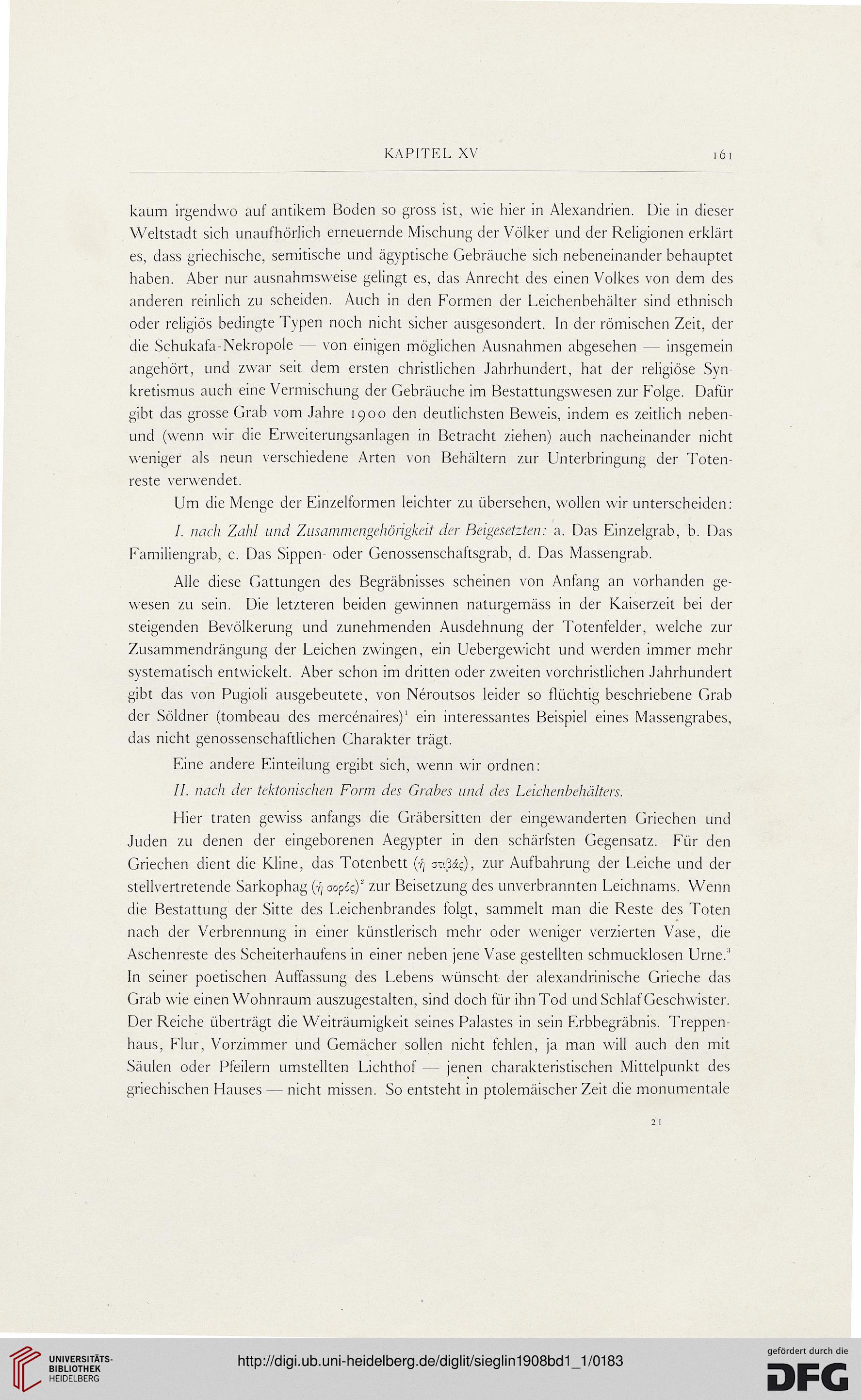KAPITEL XV
i 6 i
kaum irgendwo auf antikem Boden so gross ist, wie hier in Alexandrien. Die in dieser
Weltstadt sich unaufhörlich erneuernde Mischung der Völker und der Religionen erklärt
es, dass griechische, semitische und ägyptische Gebräuche sich nebeneinander behauptet
haben. Aber nur ausnahmsweise gelingt es, das Anrecht des einen Volkes von dem des
anderen reinlich zu scheiden. Auch in den Formen der Leichenbehälter sind ethnisch
oder religiös bedingte Typen noch nicht sicher ausgesondert. In der römischen Zeit, der
die Schukafa-Nekropole — von einigen möglichen Ausnahmen abgesehen - insgemein
angehört, und zwar seit dem ersten christlichen Jahrhundert, hat der religiöse Syn-
kretismus auch eine Vermischung der Gebräuche im Bestattungswesen zur Folge. Dafür
gibt das grosse Grab vom Jahre 1900 den deutlichsten Beweis, indem es zeitlich neben-
und (wenn wir die Erweiterungsanlagen in Betracht ziehen) auch nacheinander nicht
weniger als neun verschiedene Arten von Behältern zur Unterbringung der Toten-
reste verwendet.
Um die Menge der Einzelformen leichter zu übersehen, wollen wir unterscheiden:
I. nach Zahl und Zusammengehörigkeit der Beigesetzten: a. Das Einzelgrab, b. Das
Familiengrab, c. Das Sippen- oder Genossenschaftsgrab, d. Das Massengrab.
Alle diese Gattungen des Begräbnisses scheinen von Anfang an vorhanden ge-
wesen zu sein. Die letzteren beiden gewinnen naturgemäss in der Kaiserzeit bei der
steigenden Bevölkerung und zunehmenden Ausdehnung der Totenfelder, welche zur
Zusammendrängung der Leichen zwingen, ein Uebergewicht und werden immer mehr
systematisch entwickelt. Aber schon im dritten oder zweiten vorchristlichen Jahrhundert
gibt das von Pugioli ausgebeutete, von Neroutsos leider so flüchtig beschriebene Grab
der Söldner (tombeau des mercenaires)1 ein interessantes Beispiel eines Massengrabes,
das nicht genossenschaftlichen Charakter trägt.
Eine andere Einteilung ergibt sich, wenn wir ordnen:
II. nach der tektonischen Form des Grabes und des Leichenbehälters.
Hier traten gewiss anfangs die Gräbersitten der eingewanderten Griechen und
Juden zu denen der eingeborenen Aegypter in den schärfsten Gegensatz. Für den
Griechen dient die Kline, das Totenbett (vj ar.ßdg), zur Aufbahrung der Leiche und der
stellvertretende Sarkophag (rj aop6?)2 zur Beisetzung des unverbrannten Leichnams. Wenn
die Bestattung der Sitte des Leichenbrandes folgt, sammelt man die Reste des Toten
nach der Verbrennung in einer künstlerisch mehr oder weniger verzierten Vase, die
Aschenreste des Scheiterhaufens in einer neben jene Vase gestellten schmucklosen Urne.1
In seiner poetischen Auffassung des Lebens wünscht der alexandrinische Grieche das
Grab wie einen Wohnraum auszugestalten, sind doch für ihn Tod und Schlaf Geschwister.
Der Reiche überträgt die Weiträumigkeit seines Palastes in sein Erbbegräbnis. Treppen-
haus, Flur, Vorzimmer und Gemächer sollen nicht fehlen, ja man will auch den mit
Säulen oder Pfeilern umstellten Lichthof jenen charakteristischen Mittelpunkt des
griechischen Hauses — nicht missen. So entsteht in ptolemäischer Zeit die monumentale
i 6 i
kaum irgendwo auf antikem Boden so gross ist, wie hier in Alexandrien. Die in dieser
Weltstadt sich unaufhörlich erneuernde Mischung der Völker und der Religionen erklärt
es, dass griechische, semitische und ägyptische Gebräuche sich nebeneinander behauptet
haben. Aber nur ausnahmsweise gelingt es, das Anrecht des einen Volkes von dem des
anderen reinlich zu scheiden. Auch in den Formen der Leichenbehälter sind ethnisch
oder religiös bedingte Typen noch nicht sicher ausgesondert. In der römischen Zeit, der
die Schukafa-Nekropole — von einigen möglichen Ausnahmen abgesehen - insgemein
angehört, und zwar seit dem ersten christlichen Jahrhundert, hat der religiöse Syn-
kretismus auch eine Vermischung der Gebräuche im Bestattungswesen zur Folge. Dafür
gibt das grosse Grab vom Jahre 1900 den deutlichsten Beweis, indem es zeitlich neben-
und (wenn wir die Erweiterungsanlagen in Betracht ziehen) auch nacheinander nicht
weniger als neun verschiedene Arten von Behältern zur Unterbringung der Toten-
reste verwendet.
Um die Menge der Einzelformen leichter zu übersehen, wollen wir unterscheiden:
I. nach Zahl und Zusammengehörigkeit der Beigesetzten: a. Das Einzelgrab, b. Das
Familiengrab, c. Das Sippen- oder Genossenschaftsgrab, d. Das Massengrab.
Alle diese Gattungen des Begräbnisses scheinen von Anfang an vorhanden ge-
wesen zu sein. Die letzteren beiden gewinnen naturgemäss in der Kaiserzeit bei der
steigenden Bevölkerung und zunehmenden Ausdehnung der Totenfelder, welche zur
Zusammendrängung der Leichen zwingen, ein Uebergewicht und werden immer mehr
systematisch entwickelt. Aber schon im dritten oder zweiten vorchristlichen Jahrhundert
gibt das von Pugioli ausgebeutete, von Neroutsos leider so flüchtig beschriebene Grab
der Söldner (tombeau des mercenaires)1 ein interessantes Beispiel eines Massengrabes,
das nicht genossenschaftlichen Charakter trägt.
Eine andere Einteilung ergibt sich, wenn wir ordnen:
II. nach der tektonischen Form des Grabes und des Leichenbehälters.
Hier traten gewiss anfangs die Gräbersitten der eingewanderten Griechen und
Juden zu denen der eingeborenen Aegypter in den schärfsten Gegensatz. Für den
Griechen dient die Kline, das Totenbett (vj ar.ßdg), zur Aufbahrung der Leiche und der
stellvertretende Sarkophag (rj aop6?)2 zur Beisetzung des unverbrannten Leichnams. Wenn
die Bestattung der Sitte des Leichenbrandes folgt, sammelt man die Reste des Toten
nach der Verbrennung in einer künstlerisch mehr oder weniger verzierten Vase, die
Aschenreste des Scheiterhaufens in einer neben jene Vase gestellten schmucklosen Urne.1
In seiner poetischen Auffassung des Lebens wünscht der alexandrinische Grieche das
Grab wie einen Wohnraum auszugestalten, sind doch für ihn Tod und Schlaf Geschwister.
Der Reiche überträgt die Weiträumigkeit seines Palastes in sein Erbbegräbnis. Treppen-
haus, Flur, Vorzimmer und Gemächer sollen nicht fehlen, ja man will auch den mit
Säulen oder Pfeilern umstellten Lichthof jenen charakteristischen Mittelpunkt des
griechischen Hauses — nicht missen. So entsteht in ptolemäischer Zeit die monumentale