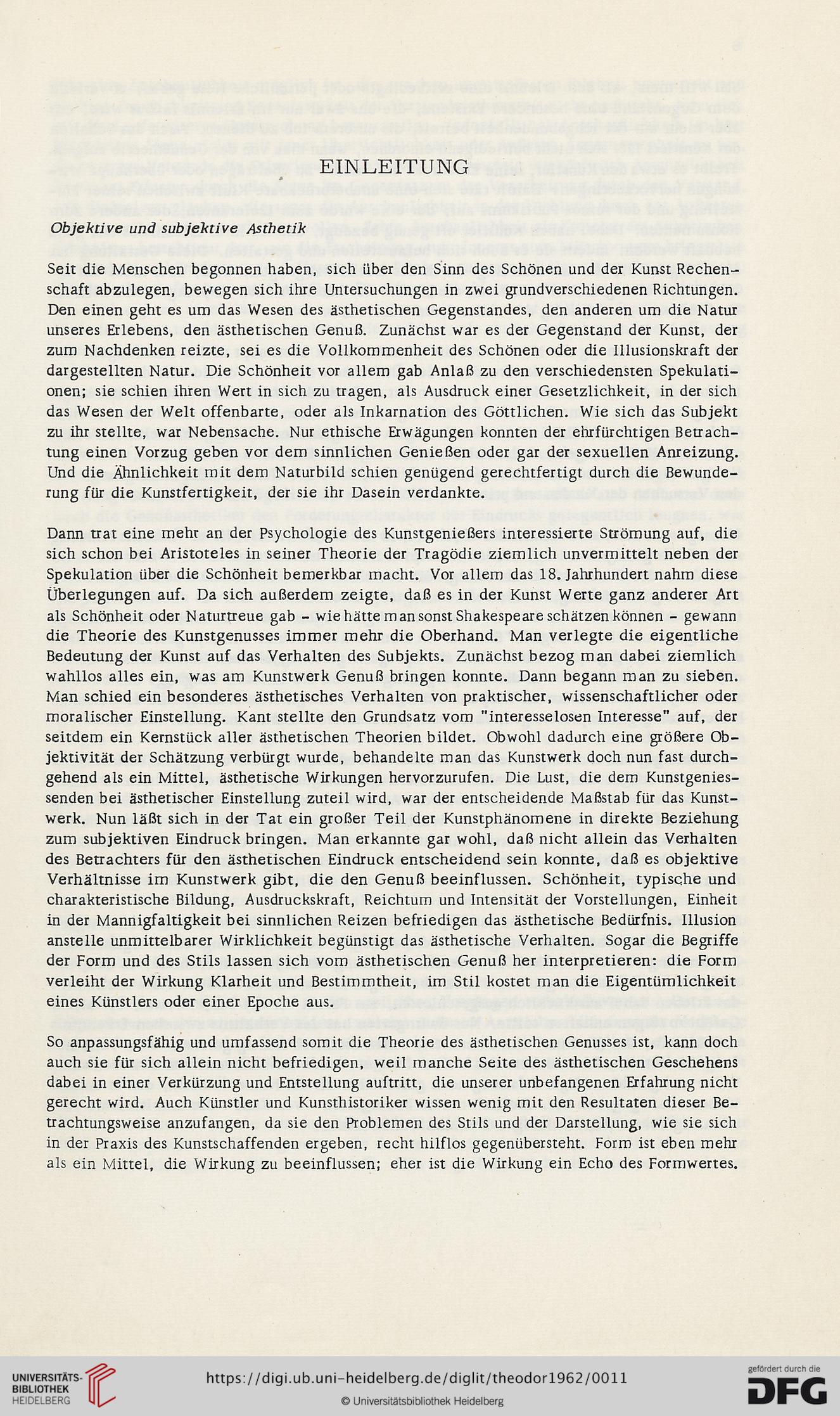EINLEITUNG
Objektive unä subjektive Ästhetik
Seit die Menschen begonnen haben, sich über den Sinn des Schönen und der Kunst Rechen-
schaft abzulegen, bewegen sich ihre Untersuchungen in zwei grundverschiedenen Richtungen.
Den einen geht es um das Wesen des ästhetischen Gegenstandes, den anderen um die Natur
unseres Erlebens, den ästhetischen Genuß. Zunächst war es der Gegenstand der Kunst, der
zum Nachdenken reizte, sei es die Vollkommenheit des Schönen oder die Illusionskraft der
dargestellten Natur. Die Schönheit vor allem gab Anlaß zu den verschiedensten Spekulati-
onen; sie schien ihren Wert in sich zu tragen, als Ausdruck einer Gesetzlichkeit, in der sich
das Wesen der Welt offenbarte, oder als Inkarnation des Göttlichen. Wie sich das Subjekt
zu ihr stellte, war Nebensache. Nur ethische Erwägungen konnten der ehrfürchtigen Betrach-
tung einen Vorzug geben vor dem sinnlichen Genießen oder gar der sexuellen Anreizung.
Und die Ähnlichkeit mit dem Naturbild schien genügend gerechtfertigt durch die Bewunde-
rung für die Kunstfertigkeit, der sie ihr Dasein verdankte.
Dann trat eine mehr an der Psychologie des Kunstgenießers interessierte Strömung auf, die
sich schon bei Aristoteles in seiner Theorie der Tragödie ziemlich unvermittelt neben der
Spekulation über die Schönheit bemerkbar macht. Vor allem das 18. Jahrhundert nahm diese
Überlegungen auf. Da sich außerdem zeigte, daß es in der Kunst Werte ganz anderer Art
als Schönheit oder Naturtreue gab - wie hätte man sonst Shakespeare schätzen können - gewann
die Theorie des Kunstgenusses immer mehr die Oberhand. Man verlegte die eigentliche
Bedeutung der Kunst auf das Verhalten des Subjekts. Zunächst bezog man dabei ziemlich
wahllos alles ein, was am Kunstwerk Genuß bringen konnte. Dann begann man zu sieben.
Man schied ein besonderes ästhetisches Verhalten von praktischer, wissenschaftlicher oder
moralischer Einstellung. Kant stellte den Grundsatz vom "interesselosen Interesse" auf, der
seitdem ein Kernstück aller ästhetischen Theorien bildet. Obwohl dadurch eine größere Ob-
jektivität der Schätzung verbürgt wurde, behandelte man das Kunstwerk doch nun fast durch-
gehend als ein Mittel, ästhetische Wirkungen hervorzurufen. Die Lust, die dem Kunstgenies-
senden bei ästhetischer Einstellung zuteil wird, war der entscheidende Maßstab für das Kunst-
werk. Nun läßt sich in der Tat ein großer Teil der Kunstphänomene in direkte Beziehung
zum subjektiven Eindruck bringen. Man erkannte gar wohl, daß nicht allein das Verhalten
des Betrachters für den ästhetischen Eindruck entscheidend sein konnte, daß es objektive
Verhältnisse im Kunstwerk gibt, die den Genuß beeinflussen. Schönheit, typische und
charakteristische Bildung, Ausdruckskraft, Reichtum und Intensität der Vorstellungen, Einheit
in der Mannigfaltigkeit bei sinnlichen Reizen befriedigen das ästhetische Bedürfnis. Illusion
anstelle unmittelbarer Wirklichkeit begünstigt das ästhetische Verhalten. Sogar die Begriffe
der Form und des Stils lassen sich vom ästhetischen Genuß her interpretieren: die Form
verleiht der Wirkung Klarheit und Bestimmtheit, im Stil kostet man die Eigentümlichkeit
eines Künstlers oder einer Epoche aus.
So anpassungsfähig und umfassend somit die Theorie des ästhetischen Genusses ist, kann doch
auch sie für sich allein nicht befriedigen, weil manche Seite des ästhetischen Geschehens
dabei in einer Verkürzung und Entstellung auftritt, die unserer unbefangenen Erfahrung nicht
gerecht wird. Auch Künstler und Kunsthistoriker wissen wenig mit den Resultaten dieser Be-
trachtungsweise anzufangen, da sie den Problemen des Stils und der Darstellung, wie sie sich
in der Praxis des Kunstschaffenden ergeben, recht hilflos gegenübersteht. Form ist eben mehr
als ein Mittel, die Wirkung zu beeinflussen; eher ist die Wirkung ein Echo des Formwertes.
Objektive unä subjektive Ästhetik
Seit die Menschen begonnen haben, sich über den Sinn des Schönen und der Kunst Rechen-
schaft abzulegen, bewegen sich ihre Untersuchungen in zwei grundverschiedenen Richtungen.
Den einen geht es um das Wesen des ästhetischen Gegenstandes, den anderen um die Natur
unseres Erlebens, den ästhetischen Genuß. Zunächst war es der Gegenstand der Kunst, der
zum Nachdenken reizte, sei es die Vollkommenheit des Schönen oder die Illusionskraft der
dargestellten Natur. Die Schönheit vor allem gab Anlaß zu den verschiedensten Spekulati-
onen; sie schien ihren Wert in sich zu tragen, als Ausdruck einer Gesetzlichkeit, in der sich
das Wesen der Welt offenbarte, oder als Inkarnation des Göttlichen. Wie sich das Subjekt
zu ihr stellte, war Nebensache. Nur ethische Erwägungen konnten der ehrfürchtigen Betrach-
tung einen Vorzug geben vor dem sinnlichen Genießen oder gar der sexuellen Anreizung.
Und die Ähnlichkeit mit dem Naturbild schien genügend gerechtfertigt durch die Bewunde-
rung für die Kunstfertigkeit, der sie ihr Dasein verdankte.
Dann trat eine mehr an der Psychologie des Kunstgenießers interessierte Strömung auf, die
sich schon bei Aristoteles in seiner Theorie der Tragödie ziemlich unvermittelt neben der
Spekulation über die Schönheit bemerkbar macht. Vor allem das 18. Jahrhundert nahm diese
Überlegungen auf. Da sich außerdem zeigte, daß es in der Kunst Werte ganz anderer Art
als Schönheit oder Naturtreue gab - wie hätte man sonst Shakespeare schätzen können - gewann
die Theorie des Kunstgenusses immer mehr die Oberhand. Man verlegte die eigentliche
Bedeutung der Kunst auf das Verhalten des Subjekts. Zunächst bezog man dabei ziemlich
wahllos alles ein, was am Kunstwerk Genuß bringen konnte. Dann begann man zu sieben.
Man schied ein besonderes ästhetisches Verhalten von praktischer, wissenschaftlicher oder
moralischer Einstellung. Kant stellte den Grundsatz vom "interesselosen Interesse" auf, der
seitdem ein Kernstück aller ästhetischen Theorien bildet. Obwohl dadurch eine größere Ob-
jektivität der Schätzung verbürgt wurde, behandelte man das Kunstwerk doch nun fast durch-
gehend als ein Mittel, ästhetische Wirkungen hervorzurufen. Die Lust, die dem Kunstgenies-
senden bei ästhetischer Einstellung zuteil wird, war der entscheidende Maßstab für das Kunst-
werk. Nun läßt sich in der Tat ein großer Teil der Kunstphänomene in direkte Beziehung
zum subjektiven Eindruck bringen. Man erkannte gar wohl, daß nicht allein das Verhalten
des Betrachters für den ästhetischen Eindruck entscheidend sein konnte, daß es objektive
Verhältnisse im Kunstwerk gibt, die den Genuß beeinflussen. Schönheit, typische und
charakteristische Bildung, Ausdruckskraft, Reichtum und Intensität der Vorstellungen, Einheit
in der Mannigfaltigkeit bei sinnlichen Reizen befriedigen das ästhetische Bedürfnis. Illusion
anstelle unmittelbarer Wirklichkeit begünstigt das ästhetische Verhalten. Sogar die Begriffe
der Form und des Stils lassen sich vom ästhetischen Genuß her interpretieren: die Form
verleiht der Wirkung Klarheit und Bestimmtheit, im Stil kostet man die Eigentümlichkeit
eines Künstlers oder einer Epoche aus.
So anpassungsfähig und umfassend somit die Theorie des ästhetischen Genusses ist, kann doch
auch sie für sich allein nicht befriedigen, weil manche Seite des ästhetischen Geschehens
dabei in einer Verkürzung und Entstellung auftritt, die unserer unbefangenen Erfahrung nicht
gerecht wird. Auch Künstler und Kunsthistoriker wissen wenig mit den Resultaten dieser Be-
trachtungsweise anzufangen, da sie den Problemen des Stils und der Darstellung, wie sie sich
in der Praxis des Kunstschaffenden ergeben, recht hilflos gegenübersteht. Form ist eben mehr
als ein Mittel, die Wirkung zu beeinflussen; eher ist die Wirkung ein Echo des Formwertes.