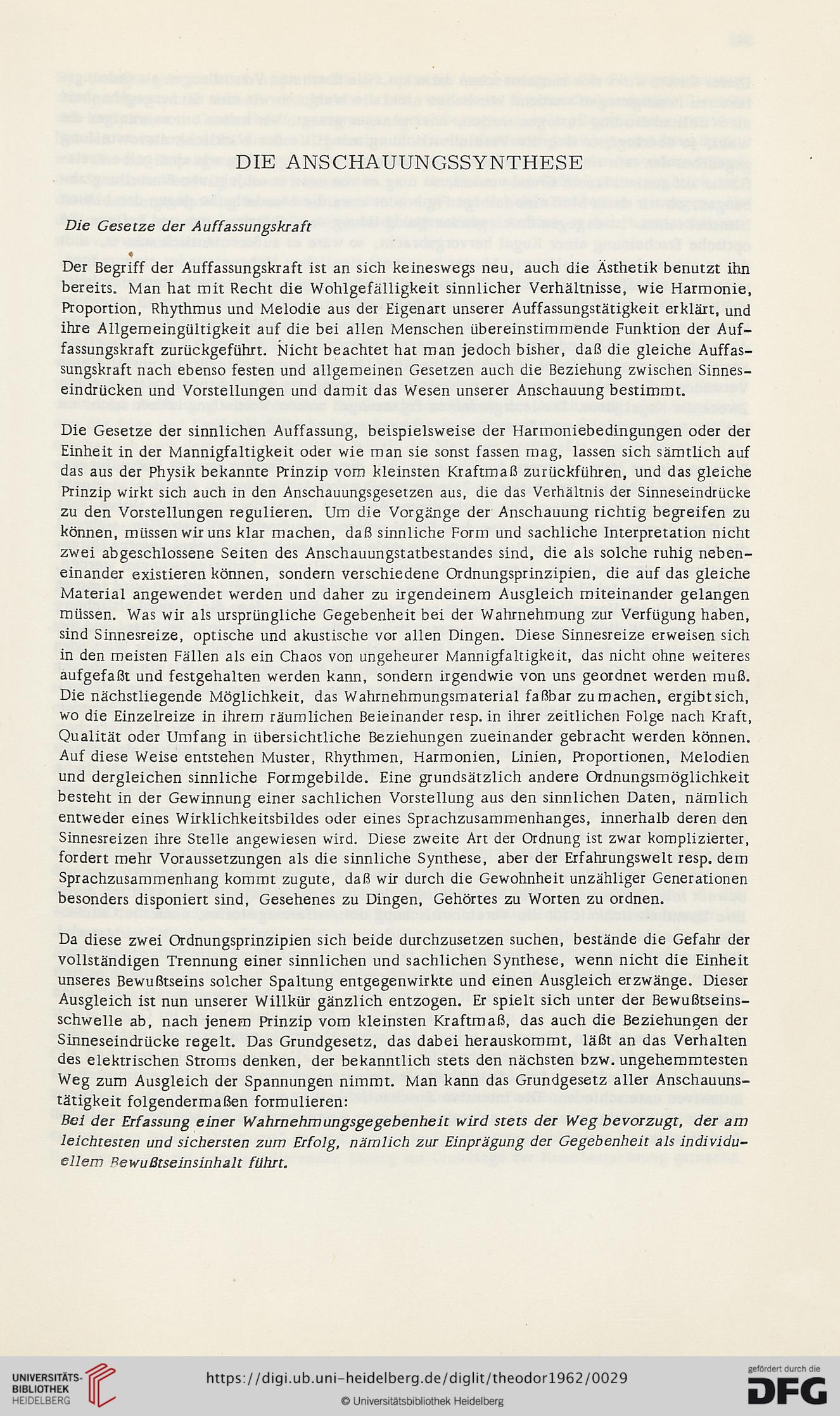DIE ANSCHAUUNGSSYNTHESE
Die Gesetze der Auffassungskraft
Der Begriff der Auffassungskraft ist an sich keineswegs neu, auch die Ästhetik benutzt ihn
bereits. Man hat mit Recht die Wohlgefälligkeit sinnlicher Verhältnisse, wie Harmonie,
Proportion, Rhythmus und Melodie aus der Eigenart unserer Auffassungstätigkeit erklärt, und
ihre Allgemeingültigkeit auf die bei allen Menschen übereinstimmende Funktion der Auf-
fassungskraft zurückgeführt. Nicht beachtet hat man jedoch bisher, daß die gleiche Auffas-
sungskraft nach ebenso festen und allgemeinen Gesetzen auch die Beziehung zwischen Sinnes-
eindrücken und Vorstellungen und damit das Wesen unserer Anschauung bestimmt.
Die Gesetze der sinnlichen Auffassung, beispielsweise der Harmoniebedingungen oder der
Einheit in der Mannigfaltigkeit oder wie man sie sonst fassen mag, lassen sich sämtlich auf
das aus der Physik bekannte Prinzip vom kleinsten Kraftmaß zurückführen, und das gleiche
Prinzip wirkt sich auch in den Anschauungsgesetzen aus, die das Verhältnis der Sinneseindrücke
zu den Vorstellungen regulieren. Um die Vorgänge der Anschauung richtig begreifen zu
können, müssen wir uns klar machen, daß sinnliche Form und sachliche Interpretation nicht
zwei abgeschlossene Seiten des Anschauungstatbestandes sind, die als solche ruhig neben-
einander existieren können, sondern verschiedene Ordnungsprinzipien, die auf das gleiche
Material angewendet werden und daher zu irgendeinem Ausgleich miteinander gelangen
müssen. Was wir als ursprüngliche Gegebenheit bei der Wahrnehmung zur Verfügung haben,
sind Sinnesreize, optische und akustische vor allen Dingen. Diese Sinnesreize erweisen sich
in den meisten Fällen als ein Chaos von ungeheurer Mannigfaltigkeit, das nicht ohne weiteres
aufgefaßt und festgehalten werden kann, sondern irgendwie von uns geordnet werden muß.
Die nächstliegende Möglichkeit, das Wahrnehmungsmaterial faßbar zumachen, ergibtsich,
wo die Einzelreize in ihrem räumlichen Beieinander resp. in ihrer zeitlichen Folge nach Kraft,
Qualität oder Umfang in übersichtliche Beziehungen zueinander gebracht werden können.
Auf diese Welse entstehen Muster, Rhythmen, Harmonien, Linien, Proportionen, Melodien
und dergleichen sinnliche Formgebilde. Eine grundsätzlich andere Ordnungsmöglichkeit
besteht in der Gewinnung einer sachlichen Vorstellung aus den sinnlichen Daten, nämlich
entweder eines Wirklichkeitsbildes oder eines Sprachzusammenhanges, innerhalb deren den
Sinnesreizen ihre Stelle angewiesen wird. Diese zweite Art der Ordnung ist zwar komplizierter,
fordert mehr Voraussetzungen als die sinnliche Synthese, aber der Erfahrungswelt resp. dem
Sprachzusammenhang kommt zugute, daß wir durch die Gewohnheit unzähliger Generationen
besonders disponiert sind, Gesehenes zu Dingen, Gehörtes zu Worten zu ordnen.
Da diese zwei Ordnungsprinzipien sich beide durchzusetzen suchen, bestände die Gefahr der
vollständigen Trennung einer sinnlichen und sachlichen Synthese, wenn nicht die Einheit
unseres Bewußtseins solcher Spaltung entgegenwirkte und einen Ausgleich erzwange. Dieser
Ausgleich ist nun unserer Willkür gänzlich entzogen. Er spielt sich unter der Bewußtseins-
schwelle ab, nach jenem Prinzip vom kleinsten Kraftmaß, das auch die Beziehungen der
Sinneseindrücke regelt. Das Grundgesetz, das dabei herauskommt, läßt an das Verhalten
des elektrischen Stroms denken, der bekanntlich stets den nächsten bzw. ungehemmtesten
Weg zum Ausgleich der Spannungen nimmt. Man kann das Grundgesetz aller Anschauuns-
tätigkeit folgendermaßen formulieren:
Bei der Erfassung einer Wahrnehmungsgegebenheit wird stets der Weg bevorzugt, der am
leichtesten und sichersten zum Erfolg, nämlich zur Einprägung der Gegebenheit als individu-
ellem Bewußtseinsinhalt fuhrt.
Die Gesetze der Auffassungskraft
Der Begriff der Auffassungskraft ist an sich keineswegs neu, auch die Ästhetik benutzt ihn
bereits. Man hat mit Recht die Wohlgefälligkeit sinnlicher Verhältnisse, wie Harmonie,
Proportion, Rhythmus und Melodie aus der Eigenart unserer Auffassungstätigkeit erklärt, und
ihre Allgemeingültigkeit auf die bei allen Menschen übereinstimmende Funktion der Auf-
fassungskraft zurückgeführt. Nicht beachtet hat man jedoch bisher, daß die gleiche Auffas-
sungskraft nach ebenso festen und allgemeinen Gesetzen auch die Beziehung zwischen Sinnes-
eindrücken und Vorstellungen und damit das Wesen unserer Anschauung bestimmt.
Die Gesetze der sinnlichen Auffassung, beispielsweise der Harmoniebedingungen oder der
Einheit in der Mannigfaltigkeit oder wie man sie sonst fassen mag, lassen sich sämtlich auf
das aus der Physik bekannte Prinzip vom kleinsten Kraftmaß zurückführen, und das gleiche
Prinzip wirkt sich auch in den Anschauungsgesetzen aus, die das Verhältnis der Sinneseindrücke
zu den Vorstellungen regulieren. Um die Vorgänge der Anschauung richtig begreifen zu
können, müssen wir uns klar machen, daß sinnliche Form und sachliche Interpretation nicht
zwei abgeschlossene Seiten des Anschauungstatbestandes sind, die als solche ruhig neben-
einander existieren können, sondern verschiedene Ordnungsprinzipien, die auf das gleiche
Material angewendet werden und daher zu irgendeinem Ausgleich miteinander gelangen
müssen. Was wir als ursprüngliche Gegebenheit bei der Wahrnehmung zur Verfügung haben,
sind Sinnesreize, optische und akustische vor allen Dingen. Diese Sinnesreize erweisen sich
in den meisten Fällen als ein Chaos von ungeheurer Mannigfaltigkeit, das nicht ohne weiteres
aufgefaßt und festgehalten werden kann, sondern irgendwie von uns geordnet werden muß.
Die nächstliegende Möglichkeit, das Wahrnehmungsmaterial faßbar zumachen, ergibtsich,
wo die Einzelreize in ihrem räumlichen Beieinander resp. in ihrer zeitlichen Folge nach Kraft,
Qualität oder Umfang in übersichtliche Beziehungen zueinander gebracht werden können.
Auf diese Welse entstehen Muster, Rhythmen, Harmonien, Linien, Proportionen, Melodien
und dergleichen sinnliche Formgebilde. Eine grundsätzlich andere Ordnungsmöglichkeit
besteht in der Gewinnung einer sachlichen Vorstellung aus den sinnlichen Daten, nämlich
entweder eines Wirklichkeitsbildes oder eines Sprachzusammenhanges, innerhalb deren den
Sinnesreizen ihre Stelle angewiesen wird. Diese zweite Art der Ordnung ist zwar komplizierter,
fordert mehr Voraussetzungen als die sinnliche Synthese, aber der Erfahrungswelt resp. dem
Sprachzusammenhang kommt zugute, daß wir durch die Gewohnheit unzähliger Generationen
besonders disponiert sind, Gesehenes zu Dingen, Gehörtes zu Worten zu ordnen.
Da diese zwei Ordnungsprinzipien sich beide durchzusetzen suchen, bestände die Gefahr der
vollständigen Trennung einer sinnlichen und sachlichen Synthese, wenn nicht die Einheit
unseres Bewußtseins solcher Spaltung entgegenwirkte und einen Ausgleich erzwange. Dieser
Ausgleich ist nun unserer Willkür gänzlich entzogen. Er spielt sich unter der Bewußtseins-
schwelle ab, nach jenem Prinzip vom kleinsten Kraftmaß, das auch die Beziehungen der
Sinneseindrücke regelt. Das Grundgesetz, das dabei herauskommt, läßt an das Verhalten
des elektrischen Stroms denken, der bekanntlich stets den nächsten bzw. ungehemmtesten
Weg zum Ausgleich der Spannungen nimmt. Man kann das Grundgesetz aller Anschauuns-
tätigkeit folgendermaßen formulieren:
Bei der Erfassung einer Wahrnehmungsgegebenheit wird stets der Weg bevorzugt, der am
leichtesten und sichersten zum Erfolg, nämlich zur Einprägung der Gegebenheit als individu-
ellem Bewußtseinsinhalt fuhrt.