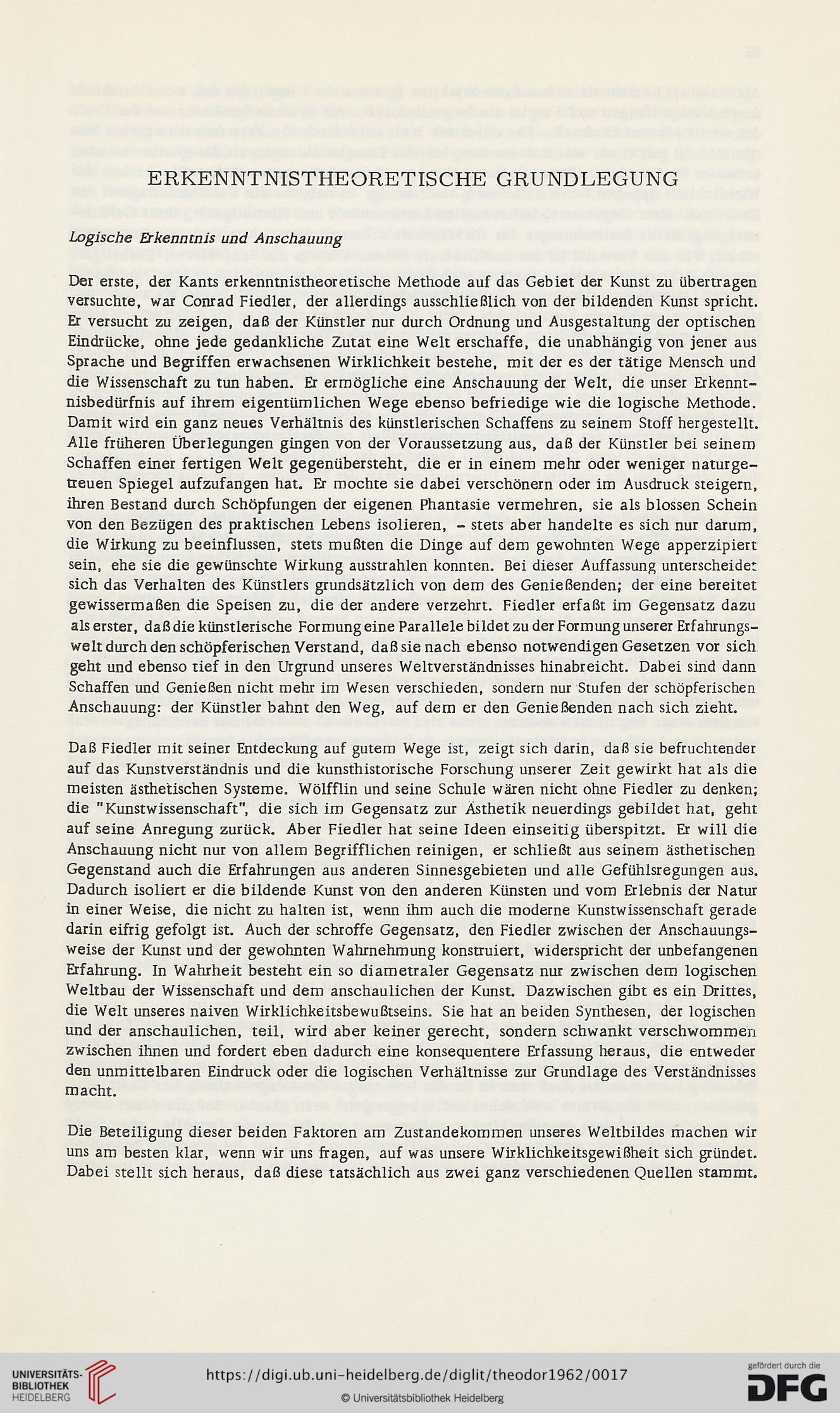ERKENNTNISTHEORETISCHE GRUNDLEGUNG
Logische Erkenntnis und Anschauung
Der erste, der Kants erkenntnistheoretische Methode auf das Gebiet der Kunst zu übertragen
versuchte, war Conrad Fiedler, der allerdings ausschließlich von der bildenden Kunst spricht.
Er versucht zu zeigen, daß der Künstler nur durch Ordnung und Ausgestaltung der optischen
Eindrücke, ohne jede gedankliche Zutat eine Welt erschaffe, die unabhängig von jener aus
Sprache und Begriffen erwachsenen Wirklichkeit bestehe, mit der es der tätige Mensch und
die Wissenschaft zu tun haben. Er ermögliche eine Anschauung der Welt, die unser Erkennt-
nisbedürfnis auf ihrem eigentümlichen Wege ebenso befriedige wie die logische Methode.
Damit wird ein ganz neues Verhältnis des künstlerischen Schaffens zu seinem Stoff hergestellt.
Alle früheren Überlegungen gingen von der Voraussetzung aus, daß der Künstler bei seinem
Schaffen einer fertigen Welt gegenübersteht, die er in einem mehr oder weniger naturge-
treuen Spiegel aufzufangen hat. Er mochte sie dabei verschönern oder im Ausdruck steigern,
ihren Bestand durch Schöpfungen der eigenen Phantasie vermehren, sie als blossen Schein
von den Bezügen des praktischen Lebens isolieren, - stets aber handelte es sich nur darum,
die Wirkung zu beeinflussen, stets mußten die Dinge auf dem gewohnten Wege apperzipiert
sein, ehe sie die gewünschte Wirkung ausstrahlen konnten. Bei dieser Auffassung unterscheidet
sich das Verhalten des Künstlers grundsätzlich von dem des Genießenden; der eine bereitet
gewissermaßen die Speisen zu, die der andere verzehrt. Fiedler erfaßt im Gegensatz dazu
als erster, daß die künstlerische Formung eine Parallele bildet zu der Formung unserer Erfahrungs-
welt durch den schöpferischen Verstand, daß sie nach ebenso notwendigen Gesetzen vor sich
geht und ebenso tief in den Urgrund unseres Weltverständnisses hinabreicht. Dabei sind dann
Schaffen und Genießen nicht mehr im Wesen verschieden, sondern nur Stufen der schöpferischen
Anschauung: der Künstler bahnt den Weg, auf dem er den Genießenden nach sich zieht.
Daß Fiedler mit seiner Entdeckung auf gutem Wege ist, zeigt sich darin, daß sie befruchtender
auf das Kunstverständnis und die kunsthistorische Forschung unserer Zeit gewirkt hat als die
meisten ästhetischen Systeme. Wölfflin und seine Schule wären nicht ohne Fiedler zu denken;
die "Kunstwissenschaft", die sich im Gegensatz zur Ästhetik neuerdings gebildet hat, geht
auf seine Anregung zurück. Aber Fiedler hat seine Ideen einseitig überspitzt. Er will die
Anschauung nicht nur von allem Begrifflichen reinigen, er schließt aus seinem ästhetischen
Gegenstand auch die Erfahrungen aus anderen Sinnesgebieten und alle Gefühlsregungen aus.
Dadurch isoliert er die bildende Kunst von den anderen Künsten und vom Erlebnis der Natur
in einer Weise, die nicht zu halten ist, wenn ihm auch die moderne Kunstwissenschaft gerade
darin eifrig gefolgt ist. Auch der schroffe Gegensatz, den Fiedler zwischen der Anschauungs-
weise der Kunst und der gewohnten Wahrnehmung konstruiert, widerspricht der unbefangenen
Erfahrung. In Wahrheit besteht ein so diametraler Gegensatz nur zwischen dem logischen
Weltbau der Wissenschaft und dem anschaulichen der Kunst. Dazwischen gibt es ein Drittes,
die Welt unseres naiven Wirklichkeitsbewußtseins. Sie hat an beiden Synthesen, der logischen
und der anschaulichen, teil, wird aber keiner gerecht, sondern schwankt verschwommen
zwischen ihnen und fordert eben dadurch eine konsequentere Erfassung heraus, die entweder
den unmittelbaren Eindruck oder die logischen Verhältnisse zur Grundlage des Verständnisses
macht.
Die Beteiligung dieser beiden Faktoren am Zustandekommen unseres Weltbildes machen wir
uns am besten klar, wenn wir uns fragen, auf was unsere Wirklichkeitsgewißheit sich gründet.
Dabei stellt sich heraus, daß diese tatsächlich aus zwei ganz verschiedenen Quellen stammt.
Logische Erkenntnis und Anschauung
Der erste, der Kants erkenntnistheoretische Methode auf das Gebiet der Kunst zu übertragen
versuchte, war Conrad Fiedler, der allerdings ausschließlich von der bildenden Kunst spricht.
Er versucht zu zeigen, daß der Künstler nur durch Ordnung und Ausgestaltung der optischen
Eindrücke, ohne jede gedankliche Zutat eine Welt erschaffe, die unabhängig von jener aus
Sprache und Begriffen erwachsenen Wirklichkeit bestehe, mit der es der tätige Mensch und
die Wissenschaft zu tun haben. Er ermögliche eine Anschauung der Welt, die unser Erkennt-
nisbedürfnis auf ihrem eigentümlichen Wege ebenso befriedige wie die logische Methode.
Damit wird ein ganz neues Verhältnis des künstlerischen Schaffens zu seinem Stoff hergestellt.
Alle früheren Überlegungen gingen von der Voraussetzung aus, daß der Künstler bei seinem
Schaffen einer fertigen Welt gegenübersteht, die er in einem mehr oder weniger naturge-
treuen Spiegel aufzufangen hat. Er mochte sie dabei verschönern oder im Ausdruck steigern,
ihren Bestand durch Schöpfungen der eigenen Phantasie vermehren, sie als blossen Schein
von den Bezügen des praktischen Lebens isolieren, - stets aber handelte es sich nur darum,
die Wirkung zu beeinflussen, stets mußten die Dinge auf dem gewohnten Wege apperzipiert
sein, ehe sie die gewünschte Wirkung ausstrahlen konnten. Bei dieser Auffassung unterscheidet
sich das Verhalten des Künstlers grundsätzlich von dem des Genießenden; der eine bereitet
gewissermaßen die Speisen zu, die der andere verzehrt. Fiedler erfaßt im Gegensatz dazu
als erster, daß die künstlerische Formung eine Parallele bildet zu der Formung unserer Erfahrungs-
welt durch den schöpferischen Verstand, daß sie nach ebenso notwendigen Gesetzen vor sich
geht und ebenso tief in den Urgrund unseres Weltverständnisses hinabreicht. Dabei sind dann
Schaffen und Genießen nicht mehr im Wesen verschieden, sondern nur Stufen der schöpferischen
Anschauung: der Künstler bahnt den Weg, auf dem er den Genießenden nach sich zieht.
Daß Fiedler mit seiner Entdeckung auf gutem Wege ist, zeigt sich darin, daß sie befruchtender
auf das Kunstverständnis und die kunsthistorische Forschung unserer Zeit gewirkt hat als die
meisten ästhetischen Systeme. Wölfflin und seine Schule wären nicht ohne Fiedler zu denken;
die "Kunstwissenschaft", die sich im Gegensatz zur Ästhetik neuerdings gebildet hat, geht
auf seine Anregung zurück. Aber Fiedler hat seine Ideen einseitig überspitzt. Er will die
Anschauung nicht nur von allem Begrifflichen reinigen, er schließt aus seinem ästhetischen
Gegenstand auch die Erfahrungen aus anderen Sinnesgebieten und alle Gefühlsregungen aus.
Dadurch isoliert er die bildende Kunst von den anderen Künsten und vom Erlebnis der Natur
in einer Weise, die nicht zu halten ist, wenn ihm auch die moderne Kunstwissenschaft gerade
darin eifrig gefolgt ist. Auch der schroffe Gegensatz, den Fiedler zwischen der Anschauungs-
weise der Kunst und der gewohnten Wahrnehmung konstruiert, widerspricht der unbefangenen
Erfahrung. In Wahrheit besteht ein so diametraler Gegensatz nur zwischen dem logischen
Weltbau der Wissenschaft und dem anschaulichen der Kunst. Dazwischen gibt es ein Drittes,
die Welt unseres naiven Wirklichkeitsbewußtseins. Sie hat an beiden Synthesen, der logischen
und der anschaulichen, teil, wird aber keiner gerecht, sondern schwankt verschwommen
zwischen ihnen und fordert eben dadurch eine konsequentere Erfassung heraus, die entweder
den unmittelbaren Eindruck oder die logischen Verhältnisse zur Grundlage des Verständnisses
macht.
Die Beteiligung dieser beiden Faktoren am Zustandekommen unseres Weltbildes machen wir
uns am besten klar, wenn wir uns fragen, auf was unsere Wirklichkeitsgewißheit sich gründet.
Dabei stellt sich heraus, daß diese tatsächlich aus zwei ganz verschiedenen Quellen stammt.