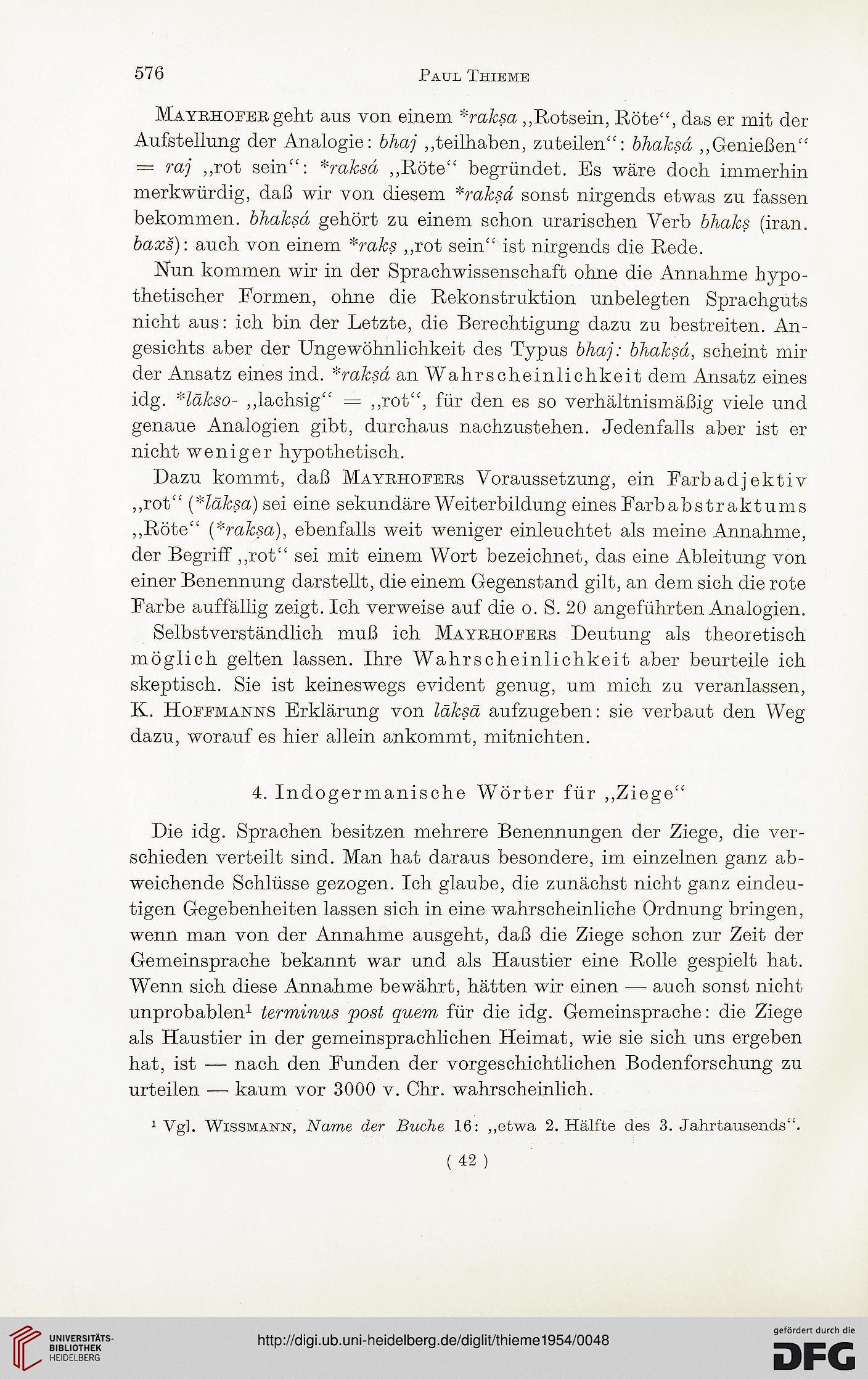576
Paul Thieme
Mayrhofer geht aus von einem *raksa „Rotsein, Röte“, das er mit der
Aufstellung der Analogie: bhaj „teilhaben, zuteilen“: bhaksä „Genießen“
= raj „rot sein“: *raksä „Röte“ begründet. Es wäre doch immerhin
merkwürdig, daß wir von diesem *raksd sonst nirgends etwas zu fassen
bekommen, bhaksä gehört zu einem schon manschen Verb bhaks (iran.
baxs): auch von einem *raks „rot sein“ ist nirgends die Rede.
Nun kommen wir in der Sprachwissenschaft ohne die Annahme hypo-
thetischer Formen, ohne die Rekonstruktion unbelegten Sprachguts
nicht aus: ich bin der Letzte, die Berechtigung dazu zu bestreiten. An-
gesichts aber der Ungewöhnlichkeit des Typus bhaj: bhaksä, scheint mir
der Ansatz eines ind. *raksä an Wahrscheinlichkeit dem Ansatz eines
idg. Häkso- „lachsig“ = „rot“, für den es so verhältnismäßig viele und
genaue Analogien gibt, durchaus nachzustehen. Jedenfalls aber ist er
nicht weniger hypothetisch.
Dazu kommt, daß Mayrhofers Voraussetzung, ein Farbadjektiv
„rot“ (Häksa) sei eine sekundäre Weiterbildung eines Farbabstraktums
„Röte“ (*raksa), ebenfalls weit weniger einleuchtet als meine Annahme,
der Begriff „rot“ sei mit einem Wort bezeichnet, das eine Ableitung von
einer Benennung darstellt, die einem Gegenstand gilt, an dem sich die rote
Farbe auffällig zeigt. Ich verweise auf die o. S. 20 angeführten Analogien.
Selbstverständlich muß ich Mayrhofers Deutung als theoretisch
möglich gelten lassen. Ihre Wahrscheinlichkeit aber beurteile ich
skeptisch. Sie ist keineswegs evident genug, um mich zu veranlassen,
K. Hoffmanns Erklärung von läksä aufzugeben: sie verbaut den Weg
dazu, worauf es hier ahein ankommt, mitnichten.
4. Indogermanische Wörter für „Ziege“
Die idg. Sprachen besitzen mehrere Benennungen der Ziege, die ver-
schieden verteilt sind. Man hat daraus besondere, im einzelnen ganz ab-
weichende Schlüsse gezogen. Ich glaube, die zunächst nicht ganz eindeu-
tigen Gegebenheiten lassen sich in eine wahrscheinliche Ordnung bringen,
wenn man von der Annahme ausgeht, daß die Ziege schon zur Zeit der
Gemeinsprache bekannt war und als Haustier eine Rolle gespielt hat.
Wenn sich diese Annahme bewährt, hätten wir einen — auch sonst nicht
unprobablen1 terminus post quem für die idg. Gemeinsprache: die Ziege
als Haustier in der gemeinsprachlichen Heimat, wie sie sich uns ergeben
hat, ist — nach den Funden der vorgeschichtlichen Bodenforschung zu
urteilen — kaum vor 3000 v. Chr. wahrscheinlich.
1 Vgl. Wissmann, Name der Buche 16: „etwa 2. Hälfte des 3. Jahrtausends1'.
( 42 )
Paul Thieme
Mayrhofer geht aus von einem *raksa „Rotsein, Röte“, das er mit der
Aufstellung der Analogie: bhaj „teilhaben, zuteilen“: bhaksä „Genießen“
= raj „rot sein“: *raksä „Röte“ begründet. Es wäre doch immerhin
merkwürdig, daß wir von diesem *raksd sonst nirgends etwas zu fassen
bekommen, bhaksä gehört zu einem schon manschen Verb bhaks (iran.
baxs): auch von einem *raks „rot sein“ ist nirgends die Rede.
Nun kommen wir in der Sprachwissenschaft ohne die Annahme hypo-
thetischer Formen, ohne die Rekonstruktion unbelegten Sprachguts
nicht aus: ich bin der Letzte, die Berechtigung dazu zu bestreiten. An-
gesichts aber der Ungewöhnlichkeit des Typus bhaj: bhaksä, scheint mir
der Ansatz eines ind. *raksä an Wahrscheinlichkeit dem Ansatz eines
idg. Häkso- „lachsig“ = „rot“, für den es so verhältnismäßig viele und
genaue Analogien gibt, durchaus nachzustehen. Jedenfalls aber ist er
nicht weniger hypothetisch.
Dazu kommt, daß Mayrhofers Voraussetzung, ein Farbadjektiv
„rot“ (Häksa) sei eine sekundäre Weiterbildung eines Farbabstraktums
„Röte“ (*raksa), ebenfalls weit weniger einleuchtet als meine Annahme,
der Begriff „rot“ sei mit einem Wort bezeichnet, das eine Ableitung von
einer Benennung darstellt, die einem Gegenstand gilt, an dem sich die rote
Farbe auffällig zeigt. Ich verweise auf die o. S. 20 angeführten Analogien.
Selbstverständlich muß ich Mayrhofers Deutung als theoretisch
möglich gelten lassen. Ihre Wahrscheinlichkeit aber beurteile ich
skeptisch. Sie ist keineswegs evident genug, um mich zu veranlassen,
K. Hoffmanns Erklärung von läksä aufzugeben: sie verbaut den Weg
dazu, worauf es hier ahein ankommt, mitnichten.
4. Indogermanische Wörter für „Ziege“
Die idg. Sprachen besitzen mehrere Benennungen der Ziege, die ver-
schieden verteilt sind. Man hat daraus besondere, im einzelnen ganz ab-
weichende Schlüsse gezogen. Ich glaube, die zunächst nicht ganz eindeu-
tigen Gegebenheiten lassen sich in eine wahrscheinliche Ordnung bringen,
wenn man von der Annahme ausgeht, daß die Ziege schon zur Zeit der
Gemeinsprache bekannt war und als Haustier eine Rolle gespielt hat.
Wenn sich diese Annahme bewährt, hätten wir einen — auch sonst nicht
unprobablen1 terminus post quem für die idg. Gemeinsprache: die Ziege
als Haustier in der gemeinsprachlichen Heimat, wie sie sich uns ergeben
hat, ist — nach den Funden der vorgeschichtlichen Bodenforschung zu
urteilen — kaum vor 3000 v. Chr. wahrscheinlich.
1 Vgl. Wissmann, Name der Buche 16: „etwa 2. Hälfte des 3. Jahrtausends1'.
( 42 )