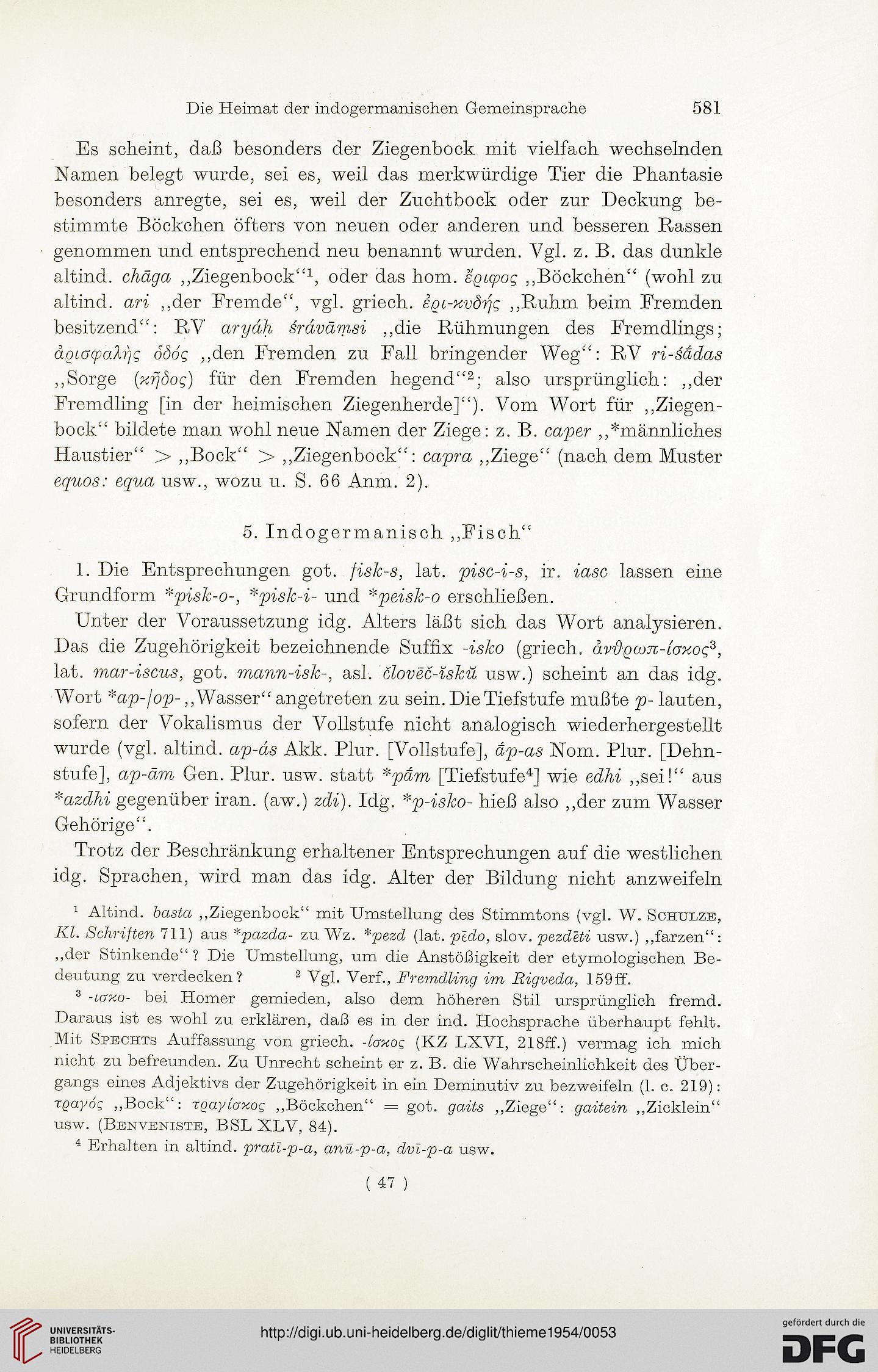Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache
581
Es scheint, daß besonders der Ziegenbock mit vielfach wechselnden
Namen belegt wurde, sei es, weil das merkwürdige Tier die Phantasie
besonders anregte, sei es, weil der Zuchtbock oder zur Deckung be-
stimmte Böckchen öfters von neuen oder anderen und besseren Rassen
genommen und entsprechend neu benannt wurden. Vgl. z. B. das dunkle
altind. chäga ,,Ziegenbock“1, oder das hom. εριφος „Böckchen“ (wohl zu
altind. ari „der Fremde“, vgl. griech. έρι-κνδής „Ruhm beim Fremden
besitzend“: RV arydh sravämsi „die Rühmungen des Fremdlings;
άρισφαλής οδός „den Fremden zu Fall bringender Weg“: RV ri-äädas
„Sorge (κήδος) für den Fremden hegend“2; also ursprünglich: „der
Fremdling [in der heimischen Ziegenherde]“). Vom Wort für „Ziegen-
bock“ bildete man wohl neue Namen der Ziege: z. B. caper „^männliches
Haustier“ > „Bock“ > „Ziegenbock“: capra „Ziege“ (nach dem Muster
equos: equa usw., wozu u. S. 66 Anm. 2).
5. Indogermanisch „Fisch“
1. Die Entsprechungen got. fisk-s, lat. pisc-i-s, ir. iasc lassen eine
Grundform *pisk-o-, *pisk-i- und *peisk-o erschließen.
Unter der Voraussetzung idg. Alters läßt sich das Wort analysieren.
Das die Zugehörigkeit bezeichnende Suffix -isho (griech. ανϋρωπ-ίοκοςζ,
lat. mar-iscus, got. mcmn-isk-, asl. clovec-iskü usw.) scheint an das idg.
Wort *ap-jop-,,Wasser“ angetreten zu sein. Die Tiefstufe mußte p- lauten,
sofern der Vokalismus der Vollstufe nicht analogisch wiederhergestellt
wurde (vgl. altind. ap-äs Akk. Plur. [Vollstufe], ap-as Nom. Plur. [Dehn-
stufe], ap-äm Gen. Plur. usw. statt *päm [Tiefstufe4] wie edhi „sei!“ aus
*azdhi gegenüber iran. (aw.) zdi). Idg. *p-isko- hieß also „der zum Wasser
Gehörige“.
Trotz der Beschränkung erhaltener Entsprechungen auf die westlichen
idg. Sprachen, wird man das idg. Alter der Bildung nicht anzweifeln
1 Altind. basta „Ziegenbock“ mit Umstellung des Stimmtons (vgl. W. Schulze,
Kl. Schriften 711) aus *pazda- zu Wz. *pezd (lat. plclo, slov. pezdeti usw.) „farzen“:
„der Stinkende“ ? Die Umstellung, um die Anstößigkeit der etymologischen Be-
deutung zu verdecken? 2 Vgl. Verf., Fremdling im Rigveda, 159ff.
3 -ισκο- bei Homer gemieden, also dem höheren Stil ursprünglich fremd.
Daraus ist es wohl zu erklären, daß es in der ind. Hochsprache überhaupt fehlt.
Mit Spechts Auffassung von griech. -ίσκος (KZ LXVI, 218ff.) vermag ich mich
nicht zu befreunden. Zu Unrecht scheint er z. B. die Wahrscheinlichkeit des Über-
gangs eines Adjektivs der Zugehörigkeit in ein Deminutiv zu bezweifeln (1. c. 219):
τραγός „Bock“: τραγίσκος „Böckchen“ = got. gaits „Ziege“: gaitein „Zicklein“
usw. (Benveniste, BSL XLV, 84).
4 Erhalten in altind. prati-p-a, anü-p-a, dvi-p-a usw.
( 47 )
581
Es scheint, daß besonders der Ziegenbock mit vielfach wechselnden
Namen belegt wurde, sei es, weil das merkwürdige Tier die Phantasie
besonders anregte, sei es, weil der Zuchtbock oder zur Deckung be-
stimmte Böckchen öfters von neuen oder anderen und besseren Rassen
genommen und entsprechend neu benannt wurden. Vgl. z. B. das dunkle
altind. chäga ,,Ziegenbock“1, oder das hom. εριφος „Böckchen“ (wohl zu
altind. ari „der Fremde“, vgl. griech. έρι-κνδής „Ruhm beim Fremden
besitzend“: RV arydh sravämsi „die Rühmungen des Fremdlings;
άρισφαλής οδός „den Fremden zu Fall bringender Weg“: RV ri-äädas
„Sorge (κήδος) für den Fremden hegend“2; also ursprünglich: „der
Fremdling [in der heimischen Ziegenherde]“). Vom Wort für „Ziegen-
bock“ bildete man wohl neue Namen der Ziege: z. B. caper „^männliches
Haustier“ > „Bock“ > „Ziegenbock“: capra „Ziege“ (nach dem Muster
equos: equa usw., wozu u. S. 66 Anm. 2).
5. Indogermanisch „Fisch“
1. Die Entsprechungen got. fisk-s, lat. pisc-i-s, ir. iasc lassen eine
Grundform *pisk-o-, *pisk-i- und *peisk-o erschließen.
Unter der Voraussetzung idg. Alters läßt sich das Wort analysieren.
Das die Zugehörigkeit bezeichnende Suffix -isho (griech. ανϋρωπ-ίοκοςζ,
lat. mar-iscus, got. mcmn-isk-, asl. clovec-iskü usw.) scheint an das idg.
Wort *ap-jop-,,Wasser“ angetreten zu sein. Die Tiefstufe mußte p- lauten,
sofern der Vokalismus der Vollstufe nicht analogisch wiederhergestellt
wurde (vgl. altind. ap-äs Akk. Plur. [Vollstufe], ap-as Nom. Plur. [Dehn-
stufe], ap-äm Gen. Plur. usw. statt *päm [Tiefstufe4] wie edhi „sei!“ aus
*azdhi gegenüber iran. (aw.) zdi). Idg. *p-isko- hieß also „der zum Wasser
Gehörige“.
Trotz der Beschränkung erhaltener Entsprechungen auf die westlichen
idg. Sprachen, wird man das idg. Alter der Bildung nicht anzweifeln
1 Altind. basta „Ziegenbock“ mit Umstellung des Stimmtons (vgl. W. Schulze,
Kl. Schriften 711) aus *pazda- zu Wz. *pezd (lat. plclo, slov. pezdeti usw.) „farzen“:
„der Stinkende“ ? Die Umstellung, um die Anstößigkeit der etymologischen Be-
deutung zu verdecken? 2 Vgl. Verf., Fremdling im Rigveda, 159ff.
3 -ισκο- bei Homer gemieden, also dem höheren Stil ursprünglich fremd.
Daraus ist es wohl zu erklären, daß es in der ind. Hochsprache überhaupt fehlt.
Mit Spechts Auffassung von griech. -ίσκος (KZ LXVI, 218ff.) vermag ich mich
nicht zu befreunden. Zu Unrecht scheint er z. B. die Wahrscheinlichkeit des Über-
gangs eines Adjektivs der Zugehörigkeit in ein Deminutiv zu bezweifeln (1. c. 219):
τραγός „Bock“: τραγίσκος „Böckchen“ = got. gaits „Ziege“: gaitein „Zicklein“
usw. (Benveniste, BSL XLV, 84).
4 Erhalten in altind. prati-p-a, anü-p-a, dvi-p-a usw.
( 47 )