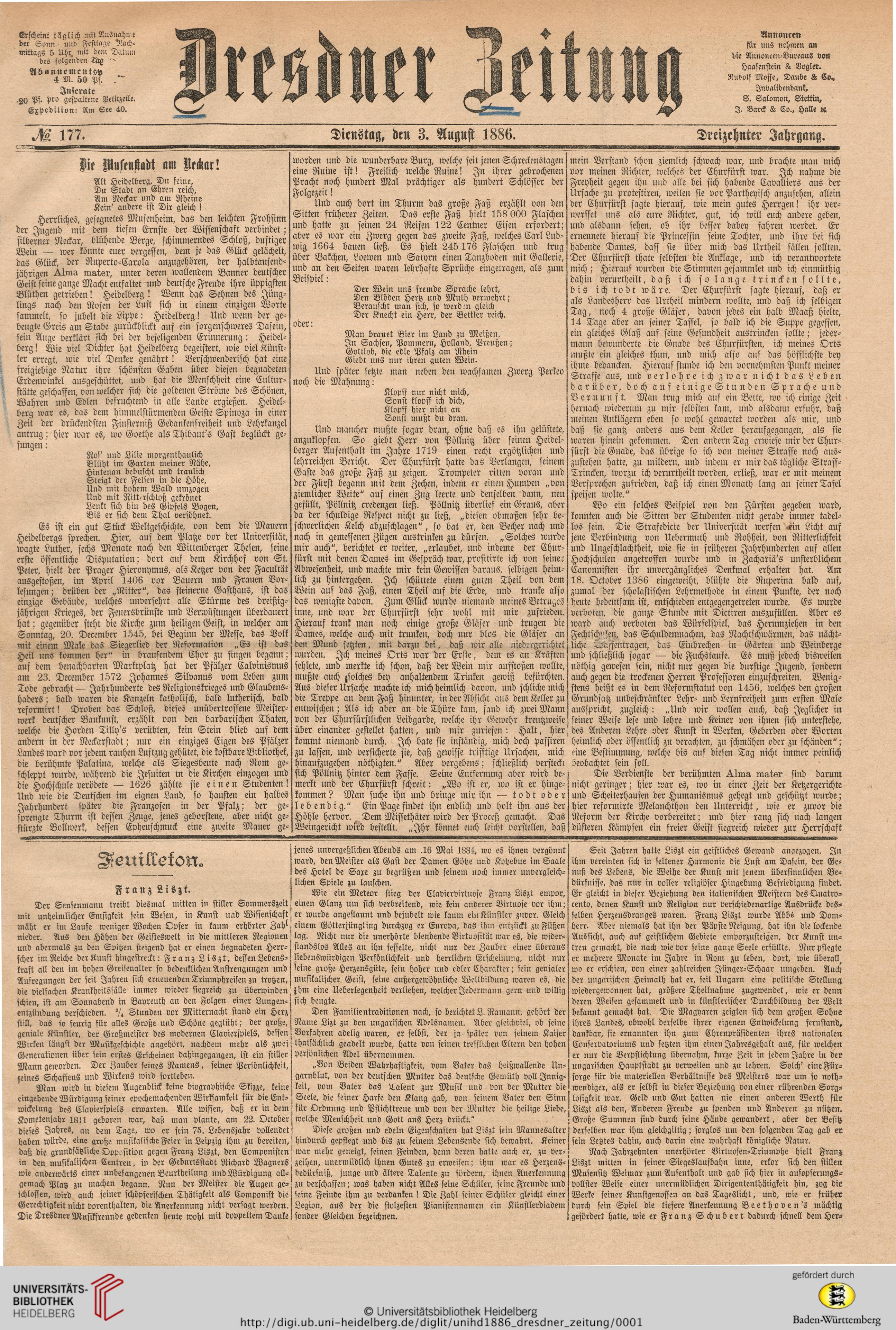Erscheini tZglich mit NuZnahn e
dkr Sonn und Fcstiage Htach-
v.ittags 5 Uhr. mit dem Datum
des folgenden Arg
ASnttnemcütsv
4 M. 5t> Pf.
Jiiscratc
'LV Ps- pro gespaltene Petitzeile.
Expedition: Am See 40.
Annottce»
für uns nchmen an
die Annoncen-Bureaus von
Haasenstein L Vogler.
Rudolf Mosse, Daube L Co«
Jnvalidendank,
S. Salomon, Stettin,
I. Barck L Co., Halle rc
177.
Dienstag, den 3. August 1886.
DreizehnLer JahrgMg.
Die Musknstadt llm Nkckar!
Alt Heidelberg, Du seine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein' andere ist Dir gleich!
Herrliches, gesegnetes Musenheim, das den leichten Frohsinn
der Jugend mit dem tiefen Ernste der Wissenschaft verbindet;
silberner Neckar, blüheude Berge, schimmerndes Schloß, duftiger
Wein — wer könnte euer vergessen, dem je das Glück gelächelt,
das Glück, der Ruperto-Carola anzugehören, der halbtausend-
jährigen ^.Iirm matsr, unter deren wallendem Banner deutscher
Geist seine ganze Macht entfaltet und deutsche Freude ihre üppigsten
Blüthen getrieben! Heidelberg! Wenn das Sehnen des Jüng-
lings nach den Rosen der Lust sich in einem einzigen Worte
sammelt, so jubelt die Lippe: Heidclberg! Und wenn der ge-
beugte Greis am Stabe zurückblickt auf ein sorgenschweres Dasein,
sein Auge verklärt sich bei der beseligenden Erinnerung: Heidel-
berg! Wie viel Dichter hat Heidelberg begeistert, wie viel Künst-
ler erregt, wie viel Denker genährt! Verschwenderisch hat eine
freigiebige Natur ihre schönsten Gaben über diesen begnadeten
Erdenwinkel ausgeschüttet, und hat die Menschheit eine Cnltur-
stätte geschaffen, vön welcher sich die goldenen Ströme des Schönen,
Wahren und Edlen befruchtend in alle Lande ergießen. Heidel-
berg war es, das dem himmelstürmenden Geiste Spinoza in einer
Zeit der drückendsten Finsterniß Gedankenfreiheit und Lehrkanzcl
antrug; hier war es, wo Goethe als Thibaut's Gast beglückt ge-
sungen:
Ros' und Lilie morzenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe,
Hintenan bebuschl und traulich
Steigt der Felsen in die Höhe,
Und mit bohem Wald nmzogen
Und mit Ritt'rschloß gekrönet
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen.
Bis er sich dem Thal versöhnet.
Es ist ein gut Stück Weltgeschichte, von dem die Mauern
Heidelbergs sprechen. Hier, auf dem Platze vor der Universität,
wagte Luther, sechs Monate nach den Wittenberger Thesen, seine
erste öffentliche Disputation; dort auf dem Kirchhof von St.
Peter, hielt der Prager Hieronymus, als Ketzer von der Facultät
ausgestoßen, im April 1406 vor Bauern und Frauen Bor-
lesungen; drüben der „Ritter", das steinerne Gasthaus, ist das
einzige Gebäude, welches unversehrt alle Stürme des dreißig-
jährigen Krieges, der Feuersbrünste und Verwüstungen überdauert
hat; gegenüber steht die Kirche zum heiligen Geist, in welcher am
Sonntag, 20. December 1545, bei Beginn der Messe, das Volk
mit einem Male das Siegerlied der Reformation „Es ist das
Heil uns kommen her" in brausendem Chor zu singen begann;
auf dem benachbarten Marktplatz hat der Pfälzer Calvinismus
am 23. December 1572 Johannes Silvanus vom Leben zum
Tode gebracht — Jahrhunderte des Religionskrieges und Glaubens-
haders; bald waren die Kanzeln katholisch, bald lutherisch, bald
reformirt! Droben das Schloß, dieses unübertroffene Meister-
werk deutscher Baukunst, erzählt von den barbarischen Thaten,
welche die Horden Tilly's verübten, kein Stein blieb auf dem
andern in der Neckarstadt; nur ein einziges Eigen des Pfälzer
Landes ward vor jedem rauhen Luftzug gehütet, die kostbare Bibliothek,
die berühmte Palatina, welche als Siegesbeute nach Rom ge-
schleppt wurde, während die Jesuiten m die Kirchen einzogen und
die Hochschule verödete — 1626 zählte sie einen Studenten!
Und°wie die Deutschen im eignen Land, so hausten ein halbes
Jahrhundert später die Franzosen in der Pfalz; der ge-
sprengte Thurm ist dessen Zeuge, jenes geborstene, aber nicht ge-
stürzte Bollwerk, dessen Epheuschmuck eine zweite Mauer ge-
worden und die wunderbare Burg, welche seit jenen Schreckenstagen
eine Ruine ist! Freilich welche Ruine! Jn ihrer gebrochenen
Pracht noch hundert Mal prächtiger als hundert Schlösser der
Folgezeit!
Und auch dort im Thurm das große Faß erzählt von den
Sitten früherer Zeiten. Das erste Faß hielt 158 000 Flaschen
und hatte zu seinen 24 Reifen 122 Centner Eisen erfordert;
aber es war ein Zwerg gegen das zweite Faß, welches Carl Lud-
wig 1664 bauen ließ. Es hielt 245176 Flaschen und trug
über Bakchen, Loewen und Satyrn einen Tanzboden mit Gallerie,
und an den Seiten waren lehrhafte Sprüche eingetragen, als zum
Beispiel:
Der Wein uns fremdc Svrache lehrt,
Den Blöden Hertz und Muth vermehrt;
Berauscht man sich, so werd.m gleich
Der Knecht ein Herr, der Bettler reich.
oder:
Mau brauet Bier im Land zu Meißen.
Jn Sachsen, Pommern, Holland, Preußen;
Gottlob, die edle Pfalz am Rhein
Giebt uns nur ihren guten Wein-
Und später setzte man neben den wachsamen Zwerg Perkeo
noch die Mahnung:
Klopff nur nicht mich,
Sonst klovff ich dich,
Klopff hier nicht an
Sonst mußt du dran.
Und mancher mußte sogar dran, ohne daß es ihn gelüstete,
anzuklopfen. So giebt Herr von Pöllnitz über seinen Heidcl-
berger Aufenthalt im Jahre 1719 einen recht ergötzlichen und
lehrreichen Bericht. Der Churfürst hatte das Verlangen, seinem
Gaste das große Faß zu zeigen. Trompeter ritten voran und
der Fürst begann mit dem Zechen, indem er einen Humpen „von
ziemlicher Weite" auf einen Zug leerte und densclben dann, neu
gefüllt, Pöllnitz credenzen ließ. Pöllnitz überlief ein Graus, aber
da der schuldige Respect nicht zu ließ, „diesen obmaßen sehr be-
schwerlichen Kelch abzuschlagen", so bat er, den Becher nach und
nach in gemessenen Zügen austrinken zu dürfen. „Solches wurde
mir auch", berichtet er weiter, „erlaubet, und indeme der Chur-
fürst mit denen Dames im Gesprüch war, profitirte ich von seinec
Abwesenheit, und machte mir kein Gewissen daraus, selbigen heim-
lich zu hintergehen. Jch schüttete einen guten Theil von dem
Wein auf das Faß, einen Theil auf die Erde, und tranke also
das weniqste davon. Zum Glück wurde niemand meines Betruges
inne, und war der Churfürst sehr wohl mit mir zufrieden.
Hierauf trank man noch einige große Gläser und trugen die
Dames, welche auch mit trunken, doch nur blos die Gläser an
dcn Mund setzten, mit darzu bei, daß wir alle niedergerichtet
wurden. Jch meines Orts war der Erste, dem es an Kräften
fehlete, und merkte ich schon, daß der Wein mir aufstoßen wollte,
mußte auch jsolches bey anhaltendem Trinken gewiß befürchten.
Aus dieser Ursache machte ich michheimlich davon, und schliche mich
die Treppe an dem Faß hinunter, in der Absicht aus dem Keller zu
entwischen; Als ich aber an die Thüre kam, fand ich zwei Mann
von der Churfürstlichcn Leibgarde, welche ihr Gewehr kreutzweise
über einander gestellet hatten, und mir zuriefen: Halt, hier
kommt niemand durch. Jch bate sie inständig, mich doch passiren
zu lassen, und versicherte sie, daß gewisse trifftige Ursachen, mich
hinaufzugehen nöthigten." Aber vergebens; schließlich verstecki
sich Pöllnitz hinter dem Fasse. Seine Entfernung aber wird be-
merkt und der Churfürst schreit: „Wo ist er, wo ist er hinge-
kommen? Man suche ihn und bringe mir ihn — todt oder
lebendig." Ein Page findet ihn endlich und holt ihn aus der
Höhle hervor. Dem Missethäter wird der Proceß gemacht. Das
Weingericht wird bestellt. „Jhr könnet euch leicht vorstellen, daß
mein Verstand schon ziemlich schwach war, und brachte man mich
vor meinen Richter, welches der Churfürst war. Jch nahme die
Freyheit gegen ihn und alle bei sich habende Cavalliers aus der
Ursache zu protestiren, weilen sie vor Partheyisch anzusehen, allein
der Churfürst sagte hierauf, wie mein gutes Herrgen! ihr ver-
werffet uns als eure Richter, gut, ich will euch andere geben,
und alsdann sehen, ob ihr besser dabey fahren werdet. Er
ernennete hierauf die Princessin seine Tochter, und ihre bei sich
habende Dames, daff sie über mich das Urtheil fällen sollten.
Der Churfürst thate selbsten die Anklage, und ich verantwortete
mich ; Hierauf wurden die Stimmen gesammlet und ich einmüthig
dahin verurtheilt, daß ich so lange trincken sollte,
bis ich todt wäre. Der Churfürst sagte hierauf, daß er
als Landesherr das Urtheil mindern wollte, und daß ich selbigen
Tag, noch 4 große Gläser, davon jedes ein halb Maaß hielte,
14 Tage aber an seiner Taffel, so bald ich die Suppe gegesscn,
ein gleiches Glaß auf seine Gesundheit austrincken sollte; jeder-
mann bewunderte die Gnade des Churfürsten, ich meines Orts
mußte cin gleiches thun, und mich also auf das hösflichste bey
ihme bedancken. Hierauf stunde ich den vornehmsten Punkt meiner
Straffe aus, und verlohre ich zwar nicht das Leben
darüber, doch auf einigeStunden Sprache und
Vernunft. Man trug mich auf ein Bette, wo ich einige Zeit
hernach wiederum zu mir selbsten kam, und alsdann erfuhr, daß
meinen Anklägern eben so wohl gewartet worden als mir, und
daß sie gantz anders aus dem Keller heraufgegangen, als sie
waren hinein gekommen. Den andern Tag erwiest mir der Chur-
fürst die Gnade, das übrige so ich von meiner Straffe noch aus-
zustehen hatte, zu mildern, und indem er mir das tägliche Straff-
Trincken, worzu ich verurtheilt worden, erließ, war er mit meinem
Versprechen zufrieden, daß ich einen Monath lang an seiner Tafel
speisen wolte."
Wo ein solches Beispiel von den Fürsten gegeben ward,
konnten auch die Sitten der Studenten nicht gerade immer tadel-
los sein. Die Strafedicte der Universität werfen -kin Licht auf
jene Verbindung von Uebermuth und Rohheit, von Ritterlichkeit
und Ungeschlachtheit, wie sie in früheren Jahrhunderten auf allen
Hochschulen angetrossen wurde und in Zachariä's unsterblichem
Canonnisten ihr unvergängliches Denkmal erhalten hat. Am
18. October 1386 eingeweiht, blühte die Ruperina bald auf,
zumal der scholastischen Lehrmethode in einem Punkte, der noch
heute bedeutsam ist, entschieden entgegengetreten wurde. Es wurde
verboten. die ganze Stunde mit Dictiren auszufüllen. Aber es
ward auch verboten das Würfelspiel, das Herumziehen in den
Fechtsch'ffen, das Schuldenmachen, das Nachtschwärmen, das nächt-
liche ^c>affentragen, das Eiubrechen in Gärtcu und Weinberge
und schließlich sogar — die Fuchstaufe. Es muß jedoch bisweilen
nöthig gewesen sein, nicht nur gegen die durstige Jugend, sondern
auch gegen die trockenen Herren Professoren einzuschreiten. Wenig-
stens heißt es in dem Reformstatut von 1456, welches den großen
Grundsatz unbeschränkter Lehr- und Lernfreiheit zum ersten Male
ausspricht, zugleich: „Und wir wollen auch, daß Jeglicher in
seiner Weise lese und lehre und Keiner von ihnen sich unterstehe,
des Anderen Lehre oder Kunst in Werken, Geberden oder Worten
heimlich oder öffentlich zu verachten, zu schmähen oder zu schänden";
eine Bestimmung, welche bis auf diesen Tag nicht immer peinlich
öeobachtet sein soll.
Die Verdienste der berühmten ^lmg. inatsr sind darum
nicht geringer; hier war es, wo in einer Zeit der Ketzergerichte
und Scheiterhaufen der Humanismus gehegt und geschützt wurde;
hier reformirte Melanchthon den Unterricht, wie er zuvor die
Reform der Kirche vorbereitet; und hier rang sich nach langen
düsteren Kämpfen ein freier Geist siegreich wieder zur Herrschaft
Aenrüelon..
Franz Liszt.
Der Se.nsenmann treibt diesmal mitten in stiller Sommerszeit l
mit unheimlicher Emsigkeit sein Wesen, in Kunst uad Wisienschaft!
mäht er im Laufe weniger Wochen Opser in kaum erhörter Zah^
nieder. Aus den Höhen der Geisteswelt in die mittleren Regionerw
und abermals zu den Spitzen steigend hat er einen begnadeten Herr-!
scher im Reiche der Kunst hingestreckt: Franz Liszt, desien Lebens-
kraft all den im hohen Greisenalter so bedenklichen Anstrengungen und
Aufregungen der seit Jahren sich erneuenden Triumphreisen zu trotzen,
die vielfachen Krankheitsfälle immer wieder siegreich zu überwinden,
schien, ist am Sonnabend in Bayreuth an den Folgen einer Lungen-
entzündung verschieden. °/« Stunden vor Mitternacht stand ein Herz
still, das w feurig für alles Große und Schöne geglüht; der große,
geniale KUnstler, der Großmeister dss modernen Clavierspiels, dessen
Wirken längst der Musikgeschichte angehört, nachdsm mehr als zwei
Generationen über sein erstes Erscheinen dahingegangen, ist ein stiller
Mann geworden. Der Zauber seines Namens, seiner Persönlichkeit,
seines Schaffens und Wirkens wird sortleben.
Man wird in diesem Augenblick keine biographische Skizze, keine
eingehende Würdigung seiner epochemachenden Wirksamkeit für die Ent-
wickelung des Clavierspiels erwarten. Alle wissen, daß er in dem
Kometenjahr 1811 geboren war, daß man plante, am 22. October
dieses Jahres, an dem Tage, wo er sein 76. Lebensjahr vollendet;
haben würde, eine große musikalische Feier in Leipzig ihm zu bereiten, §
daß die grundsätzliche Oppcsition gegen Franz Liszt, den Componisten'
in den musikalischen Centren, in dcr Geburtsstadt Richard Wagners^
wie anderwärts einer unbefangenen Beurtheilung und Würdigung all-
gemach Platz zu machen begann. Nun der Meister die Augen ge-
schloflen, wird auch seiner schöpferischen Thätigkeit als Componist die
Gerechtigkeit nicht vorenthalten, die Anerkennung nicht versagt werden.
Die Dresdner Musikfreunde gedenken heute wohl mit doppeltem Danke
jenes unvergeßlichen Abends am .16 Mai 1884, wo es ihnen vergönnt
ward, den Meister als Gast der Damen Götze und Kotzebue im Saale
des Hotel de Saxe zu begrüßen und seinem noch immer unvergleich-
lichen Spiele zu lauschen.
Wie ein Meteor stieg der Claviervirtuose Franz Liszt empor,
einen Glanz um sich verbreitend, wie kein anderer Virtuose Vor ihm;
er wurde angestaunt und bejubelt wie kaum ein Künstler zuvor. Gleich
einem Götterjüngüng durchzog er Europa, das ihm entzückt zu FUßen
lag. Nicht nur die unerhörte blendende Virtuosität war es, die wider-
standslos Alles an ihn fesselte, nicht nur der Zauber einer Lberaus
liebenswürdigen Perfönlichkeit und herrlichen Erscheinung, nicht nur
!eine große Herzensgüte, sein hoher und edler Charakter; sein genialer
musikalischer Geist, seine außergewöhnliche Weltbildung waren es, die
jhm eine Ueberlegenheit verliehen, welcherJedermann gern und willig
stch beugte.
Den Familientraditionen nach, so bsrichtet L. Ramann. gehört der
Name Lizt zu den ungarischen Adelsnamen. Aber gleichviel, ob seine
Vorfahren adelig waren, er selbst, der ja später von seinem Kaiser
thatsächlich geadelt wurde, hatte von seinen trefflichen Eltern den hohen
persönlichen Adel übernommen.
„Von Beiden Wahrhaftigkeit, vom Vater das heißwallende Un-
garnblut, von der deutschen Mutter das deutsche Gemüth voll Jnnig-
keit, vom Bater das Talent zur Musik und von der Mutter die
Seele, die seiner Harfe den Klang gab, von seinem Vater den Sinn
sür Ordnung und Pflichttreue und von der Mutter die heilige Liebe,
welche Menschheit und Gott ans Herz drückl."
Diese großen und edeln Eigenschaften hat Liszt sein Mannesalter
hindurch gepflegt und bis zu seinem Lebensende sich bewahrt. Keiner
war mehr geneigt, seinen Feinden, denn deren hatte auch er, zu ver-
zeihen, unermüdlich ihnen Gutes zu erweisen; ihm war es Herzens-
bedürfniß, junge und ältere Talsnte zu sördern, ihnen Anerkennung
zu verschaffen; was haben »icht Alles seine Schüler, seine Freunde und
seine Feinde ihm zu verdanken ! Die Zahl seiner Schüler gleicht einer
Legion, aus der die stolzesten Pianistennamen ein Künstlerdiadem
sonder Gleichen bezeichnen.
Seit Jahren hatte Liszt ein geistliches Gewand anaezogen. Jn
ihm vereinten sich in seltener Harmonie die Lust am Dasein, der Ge-
nuß des Lebens, die Weihe der Kunst mit jenem übersinnlichen Be-
dürfniffe, das nur in voller religiöser Hingebung Befriedigung flndet.
Er gleicht in dieser Beziehung den italienischen Meistern des Quatro-
cento, denen Kunst und Religion nur verschiedenartige Ausdrücke dcs-
selben Herzensdranges waren. Franz Liszt wurde Abbö und Dom-
herr. Aber niemals hat ihn der Päpste Neigung, hat ihn die lockende
AuLsicht, auch auf geistlichcm Gebiete emporzusteigen, dcr Kunst un-
treu gemacht, die nach wie vor seins ganze Seele erfüllte. Nurpflsgte
er mehrere Monate im Jahre in Rom zu leben, dort, wie Lberall
wo er erschien, von einer zahlreichen Jünger-Schaar umgeben. Auch
der ungarischen Heimath hat er, seit Ungarn eine politische Stellung
wiedergewonnen hat, größere Theilnahme zugewendet, wie er denn
deren Weisen gesammelt und in künstlerischer Durchbildung der Wclt
bekannt gemacht hat. Die Magyaren zeigten sich dem großen Sohne
ihres Landes, obwohl derselbe ihrer eigenen Entwickelung fernstand,
dankbar, sie ernannten ihn zum Chrenpräsidenlen ihres nationalen
Conservatoriums und setzten ihm einen Jahresgehalt aus, für welchen
er nur die Verpflichtung übernahm, kurze Zeit in jedem Jahre in der
ungarischen Hauptstadt zu verweilen und zu lehren. Solch' eineFür-
sorge für die materiellen Verhältnisie des Meisters war um so noth-
wendiger, als er selbst in dieser Beziehung von einer rührenden Sorg-
losigkeit war. Geld und Gut hatten nie einen anderen Werth für
Liszt als den, Anderen Freude zu spenden und Nnderen zu nützen.
Große Summen sind durch seine Hände gewandert, aber der Besitz
derselben war ihm gleichgiltig; sorglos um den folgcnden Tag gab er
sein Letztes dahin, auch darin eine wahrhaft königliche Natur.
Nach Jahrzehnten unerhörter Virtuosen-Triumphe hielt Franz
Liszt mitten in seiner Sicqeslaufbahn inne, erkor sich den stillen
Musensitz Weimar zum Aufenthalt und gab sich hier in aufopferungs-
Vollster Weise einer unermüdlichen Dirigententhärigkeit hin, zog die
Werke seiner Kunstgenosien an das Tageslicht, und, wie er früher
durch sein Spiel die tiefere Anerkennung Beethoven's mächtig
gefördert hatte, wie er Franz Schuberl dadurch schnell dem Hcr-
dkr Sonn und Fcstiage Htach-
v.ittags 5 Uhr. mit dem Datum
des folgenden Arg
ASnttnemcütsv
4 M. 5t> Pf.
Jiiscratc
'LV Ps- pro gespaltene Petitzeile.
Expedition: Am See 40.
Annottce»
für uns nchmen an
die Annoncen-Bureaus von
Haasenstein L Vogler.
Rudolf Mosse, Daube L Co«
Jnvalidendank,
S. Salomon, Stettin,
I. Barck L Co., Halle rc
177.
Dienstag, den 3. August 1886.
DreizehnLer JahrgMg.
Die Musknstadt llm Nkckar!
Alt Heidelberg, Du seine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein' andere ist Dir gleich!
Herrliches, gesegnetes Musenheim, das den leichten Frohsinn
der Jugend mit dem tiefen Ernste der Wissenschaft verbindet;
silberner Neckar, blüheude Berge, schimmerndes Schloß, duftiger
Wein — wer könnte euer vergessen, dem je das Glück gelächelt,
das Glück, der Ruperto-Carola anzugehören, der halbtausend-
jährigen ^.Iirm matsr, unter deren wallendem Banner deutscher
Geist seine ganze Macht entfaltet und deutsche Freude ihre üppigsten
Blüthen getrieben! Heidelberg! Wenn das Sehnen des Jüng-
lings nach den Rosen der Lust sich in einem einzigen Worte
sammelt, so jubelt die Lippe: Heidclberg! Und wenn der ge-
beugte Greis am Stabe zurückblickt auf ein sorgenschweres Dasein,
sein Auge verklärt sich bei der beseligenden Erinnerung: Heidel-
berg! Wie viel Dichter hat Heidelberg begeistert, wie viel Künst-
ler erregt, wie viel Denker genährt! Verschwenderisch hat eine
freigiebige Natur ihre schönsten Gaben über diesen begnadeten
Erdenwinkel ausgeschüttet, und hat die Menschheit eine Cnltur-
stätte geschaffen, vön welcher sich die goldenen Ströme des Schönen,
Wahren und Edlen befruchtend in alle Lande ergießen. Heidel-
berg war es, das dem himmelstürmenden Geiste Spinoza in einer
Zeit der drückendsten Finsterniß Gedankenfreiheit und Lehrkanzcl
antrug; hier war es, wo Goethe als Thibaut's Gast beglückt ge-
sungen:
Ros' und Lilie morzenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe,
Hintenan bebuschl und traulich
Steigt der Felsen in die Höhe,
Und mit bohem Wald nmzogen
Und mit Ritt'rschloß gekrönet
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen.
Bis er sich dem Thal versöhnet.
Es ist ein gut Stück Weltgeschichte, von dem die Mauern
Heidelbergs sprechen. Hier, auf dem Platze vor der Universität,
wagte Luther, sechs Monate nach den Wittenberger Thesen, seine
erste öffentliche Disputation; dort auf dem Kirchhof von St.
Peter, hielt der Prager Hieronymus, als Ketzer von der Facultät
ausgestoßen, im April 1406 vor Bauern und Frauen Bor-
lesungen; drüben der „Ritter", das steinerne Gasthaus, ist das
einzige Gebäude, welches unversehrt alle Stürme des dreißig-
jährigen Krieges, der Feuersbrünste und Verwüstungen überdauert
hat; gegenüber steht die Kirche zum heiligen Geist, in welcher am
Sonntag, 20. December 1545, bei Beginn der Messe, das Volk
mit einem Male das Siegerlied der Reformation „Es ist das
Heil uns kommen her" in brausendem Chor zu singen begann;
auf dem benachbarten Marktplatz hat der Pfälzer Calvinismus
am 23. December 1572 Johannes Silvanus vom Leben zum
Tode gebracht — Jahrhunderte des Religionskrieges und Glaubens-
haders; bald waren die Kanzeln katholisch, bald lutherisch, bald
reformirt! Droben das Schloß, dieses unübertroffene Meister-
werk deutscher Baukunst, erzählt von den barbarischen Thaten,
welche die Horden Tilly's verübten, kein Stein blieb auf dem
andern in der Neckarstadt; nur ein einziges Eigen des Pfälzer
Landes ward vor jedem rauhen Luftzug gehütet, die kostbare Bibliothek,
die berühmte Palatina, welche als Siegesbeute nach Rom ge-
schleppt wurde, während die Jesuiten m die Kirchen einzogen und
die Hochschule verödete — 1626 zählte sie einen Studenten!
Und°wie die Deutschen im eignen Land, so hausten ein halbes
Jahrhundert später die Franzosen in der Pfalz; der ge-
sprengte Thurm ist dessen Zeuge, jenes geborstene, aber nicht ge-
stürzte Bollwerk, dessen Epheuschmuck eine zweite Mauer ge-
worden und die wunderbare Burg, welche seit jenen Schreckenstagen
eine Ruine ist! Freilich welche Ruine! Jn ihrer gebrochenen
Pracht noch hundert Mal prächtiger als hundert Schlösser der
Folgezeit!
Und auch dort im Thurm das große Faß erzählt von den
Sitten früherer Zeiten. Das erste Faß hielt 158 000 Flaschen
und hatte zu seinen 24 Reifen 122 Centner Eisen erfordert;
aber es war ein Zwerg gegen das zweite Faß, welches Carl Lud-
wig 1664 bauen ließ. Es hielt 245176 Flaschen und trug
über Bakchen, Loewen und Satyrn einen Tanzboden mit Gallerie,
und an den Seiten waren lehrhafte Sprüche eingetragen, als zum
Beispiel:
Der Wein uns fremdc Svrache lehrt,
Den Blöden Hertz und Muth vermehrt;
Berauscht man sich, so werd.m gleich
Der Knecht ein Herr, der Bettler reich.
oder:
Mau brauet Bier im Land zu Meißen.
Jn Sachsen, Pommern, Holland, Preußen;
Gottlob, die edle Pfalz am Rhein
Giebt uns nur ihren guten Wein-
Und später setzte man neben den wachsamen Zwerg Perkeo
noch die Mahnung:
Klopff nur nicht mich,
Sonst klovff ich dich,
Klopff hier nicht an
Sonst mußt du dran.
Und mancher mußte sogar dran, ohne daß es ihn gelüstete,
anzuklopfen. So giebt Herr von Pöllnitz über seinen Heidcl-
berger Aufenthalt im Jahre 1719 einen recht ergötzlichen und
lehrreichen Bericht. Der Churfürst hatte das Verlangen, seinem
Gaste das große Faß zu zeigen. Trompeter ritten voran und
der Fürst begann mit dem Zechen, indem er einen Humpen „von
ziemlicher Weite" auf einen Zug leerte und densclben dann, neu
gefüllt, Pöllnitz credenzen ließ. Pöllnitz überlief ein Graus, aber
da der schuldige Respect nicht zu ließ, „diesen obmaßen sehr be-
schwerlichen Kelch abzuschlagen", so bat er, den Becher nach und
nach in gemessenen Zügen austrinken zu dürfen. „Solches wurde
mir auch", berichtet er weiter, „erlaubet, und indeme der Chur-
fürst mit denen Dames im Gesprüch war, profitirte ich von seinec
Abwesenheit, und machte mir kein Gewissen daraus, selbigen heim-
lich zu hintergehen. Jch schüttete einen guten Theil von dem
Wein auf das Faß, einen Theil auf die Erde, und tranke also
das weniqste davon. Zum Glück wurde niemand meines Betruges
inne, und war der Churfürst sehr wohl mit mir zufrieden.
Hierauf trank man noch einige große Gläser und trugen die
Dames, welche auch mit trunken, doch nur blos die Gläser an
dcn Mund setzten, mit darzu bei, daß wir alle niedergerichtet
wurden. Jch meines Orts war der Erste, dem es an Kräften
fehlete, und merkte ich schon, daß der Wein mir aufstoßen wollte,
mußte auch jsolches bey anhaltendem Trinken gewiß befürchten.
Aus dieser Ursache machte ich michheimlich davon, und schliche mich
die Treppe an dem Faß hinunter, in der Absicht aus dem Keller zu
entwischen; Als ich aber an die Thüre kam, fand ich zwei Mann
von der Churfürstlichcn Leibgarde, welche ihr Gewehr kreutzweise
über einander gestellet hatten, und mir zuriefen: Halt, hier
kommt niemand durch. Jch bate sie inständig, mich doch passiren
zu lassen, und versicherte sie, daß gewisse trifftige Ursachen, mich
hinaufzugehen nöthigten." Aber vergebens; schließlich verstecki
sich Pöllnitz hinter dem Fasse. Seine Entfernung aber wird be-
merkt und der Churfürst schreit: „Wo ist er, wo ist er hinge-
kommen? Man suche ihn und bringe mir ihn — todt oder
lebendig." Ein Page findet ihn endlich und holt ihn aus der
Höhle hervor. Dem Missethäter wird der Proceß gemacht. Das
Weingericht wird bestellt. „Jhr könnet euch leicht vorstellen, daß
mein Verstand schon ziemlich schwach war, und brachte man mich
vor meinen Richter, welches der Churfürst war. Jch nahme die
Freyheit gegen ihn und alle bei sich habende Cavalliers aus der
Ursache zu protestiren, weilen sie vor Partheyisch anzusehen, allein
der Churfürst sagte hierauf, wie mein gutes Herrgen! ihr ver-
werffet uns als eure Richter, gut, ich will euch andere geben,
und alsdann sehen, ob ihr besser dabey fahren werdet. Er
ernennete hierauf die Princessin seine Tochter, und ihre bei sich
habende Dames, daff sie über mich das Urtheil fällen sollten.
Der Churfürst thate selbsten die Anklage, und ich verantwortete
mich ; Hierauf wurden die Stimmen gesammlet und ich einmüthig
dahin verurtheilt, daß ich so lange trincken sollte,
bis ich todt wäre. Der Churfürst sagte hierauf, daß er
als Landesherr das Urtheil mindern wollte, und daß ich selbigen
Tag, noch 4 große Gläser, davon jedes ein halb Maaß hielte,
14 Tage aber an seiner Taffel, so bald ich die Suppe gegesscn,
ein gleiches Glaß auf seine Gesundheit austrincken sollte; jeder-
mann bewunderte die Gnade des Churfürsten, ich meines Orts
mußte cin gleiches thun, und mich also auf das hösflichste bey
ihme bedancken. Hierauf stunde ich den vornehmsten Punkt meiner
Straffe aus, und verlohre ich zwar nicht das Leben
darüber, doch auf einigeStunden Sprache und
Vernunft. Man trug mich auf ein Bette, wo ich einige Zeit
hernach wiederum zu mir selbsten kam, und alsdann erfuhr, daß
meinen Anklägern eben so wohl gewartet worden als mir, und
daß sie gantz anders aus dem Keller heraufgegangen, als sie
waren hinein gekommen. Den andern Tag erwiest mir der Chur-
fürst die Gnade, das übrige so ich von meiner Straffe noch aus-
zustehen hatte, zu mildern, und indem er mir das tägliche Straff-
Trincken, worzu ich verurtheilt worden, erließ, war er mit meinem
Versprechen zufrieden, daß ich einen Monath lang an seiner Tafel
speisen wolte."
Wo ein solches Beispiel von den Fürsten gegeben ward,
konnten auch die Sitten der Studenten nicht gerade immer tadel-
los sein. Die Strafedicte der Universität werfen -kin Licht auf
jene Verbindung von Uebermuth und Rohheit, von Ritterlichkeit
und Ungeschlachtheit, wie sie in früheren Jahrhunderten auf allen
Hochschulen angetrossen wurde und in Zachariä's unsterblichem
Canonnisten ihr unvergängliches Denkmal erhalten hat. Am
18. October 1386 eingeweiht, blühte die Ruperina bald auf,
zumal der scholastischen Lehrmethode in einem Punkte, der noch
heute bedeutsam ist, entschieden entgegengetreten wurde. Es wurde
verboten. die ganze Stunde mit Dictiren auszufüllen. Aber es
ward auch verboten das Würfelspiel, das Herumziehen in den
Fechtsch'ffen, das Schuldenmachen, das Nachtschwärmen, das nächt-
liche ^c>affentragen, das Eiubrechen in Gärtcu und Weinberge
und schließlich sogar — die Fuchstaufe. Es muß jedoch bisweilen
nöthig gewesen sein, nicht nur gegen die durstige Jugend, sondern
auch gegen die trockenen Herren Professoren einzuschreiten. Wenig-
stens heißt es in dem Reformstatut von 1456, welches den großen
Grundsatz unbeschränkter Lehr- und Lernfreiheit zum ersten Male
ausspricht, zugleich: „Und wir wollen auch, daß Jeglicher in
seiner Weise lese und lehre und Keiner von ihnen sich unterstehe,
des Anderen Lehre oder Kunst in Werken, Geberden oder Worten
heimlich oder öffentlich zu verachten, zu schmähen oder zu schänden";
eine Bestimmung, welche bis auf diesen Tag nicht immer peinlich
öeobachtet sein soll.
Die Verdienste der berühmten ^lmg. inatsr sind darum
nicht geringer; hier war es, wo in einer Zeit der Ketzergerichte
und Scheiterhaufen der Humanismus gehegt und geschützt wurde;
hier reformirte Melanchthon den Unterricht, wie er zuvor die
Reform der Kirche vorbereitet; und hier rang sich nach langen
düsteren Kämpfen ein freier Geist siegreich wieder zur Herrschaft
Aenrüelon..
Franz Liszt.
Der Se.nsenmann treibt diesmal mitten in stiller Sommerszeit l
mit unheimlicher Emsigkeit sein Wesen, in Kunst uad Wisienschaft!
mäht er im Laufe weniger Wochen Opser in kaum erhörter Zah^
nieder. Aus den Höhen der Geisteswelt in die mittleren Regionerw
und abermals zu den Spitzen steigend hat er einen begnadeten Herr-!
scher im Reiche der Kunst hingestreckt: Franz Liszt, desien Lebens-
kraft all den im hohen Greisenalter so bedenklichen Anstrengungen und
Aufregungen der seit Jahren sich erneuenden Triumphreisen zu trotzen,
die vielfachen Krankheitsfälle immer wieder siegreich zu überwinden,
schien, ist am Sonnabend in Bayreuth an den Folgen einer Lungen-
entzündung verschieden. °/« Stunden vor Mitternacht stand ein Herz
still, das w feurig für alles Große und Schöne geglüht; der große,
geniale KUnstler, der Großmeister dss modernen Clavierspiels, dessen
Wirken längst der Musikgeschichte angehört, nachdsm mehr als zwei
Generationen über sein erstes Erscheinen dahingegangen, ist ein stiller
Mann geworden. Der Zauber seines Namens, seiner Persönlichkeit,
seines Schaffens und Wirkens wird sortleben.
Man wird in diesem Augenblick keine biographische Skizze, keine
eingehende Würdigung seiner epochemachenden Wirksamkeit für die Ent-
wickelung des Clavierspiels erwarten. Alle wissen, daß er in dem
Kometenjahr 1811 geboren war, daß man plante, am 22. October
dieses Jahres, an dem Tage, wo er sein 76. Lebensjahr vollendet;
haben würde, eine große musikalische Feier in Leipzig ihm zu bereiten, §
daß die grundsätzliche Oppcsition gegen Franz Liszt, den Componisten'
in den musikalischen Centren, in dcr Geburtsstadt Richard Wagners^
wie anderwärts einer unbefangenen Beurtheilung und Würdigung all-
gemach Platz zu machen begann. Nun der Meister die Augen ge-
schloflen, wird auch seiner schöpferischen Thätigkeit als Componist die
Gerechtigkeit nicht vorenthalten, die Anerkennung nicht versagt werden.
Die Dresdner Musikfreunde gedenken heute wohl mit doppeltem Danke
jenes unvergeßlichen Abends am .16 Mai 1884, wo es ihnen vergönnt
ward, den Meister als Gast der Damen Götze und Kotzebue im Saale
des Hotel de Saxe zu begrüßen und seinem noch immer unvergleich-
lichen Spiele zu lauschen.
Wie ein Meteor stieg der Claviervirtuose Franz Liszt empor,
einen Glanz um sich verbreitend, wie kein anderer Virtuose Vor ihm;
er wurde angestaunt und bejubelt wie kaum ein Künstler zuvor. Gleich
einem Götterjüngüng durchzog er Europa, das ihm entzückt zu FUßen
lag. Nicht nur die unerhörte blendende Virtuosität war es, die wider-
standslos Alles an ihn fesselte, nicht nur der Zauber einer Lberaus
liebenswürdigen Perfönlichkeit und herrlichen Erscheinung, nicht nur
!eine große Herzensgüte, sein hoher und edler Charakter; sein genialer
musikalischer Geist, seine außergewöhnliche Weltbildung waren es, die
jhm eine Ueberlegenheit verliehen, welcherJedermann gern und willig
stch beugte.
Den Familientraditionen nach, so bsrichtet L. Ramann. gehört der
Name Lizt zu den ungarischen Adelsnamen. Aber gleichviel, ob seine
Vorfahren adelig waren, er selbst, der ja später von seinem Kaiser
thatsächlich geadelt wurde, hatte von seinen trefflichen Eltern den hohen
persönlichen Adel übernommen.
„Von Beiden Wahrhaftigkeit, vom Vater das heißwallende Un-
garnblut, von der deutschen Mutter das deutsche Gemüth voll Jnnig-
keit, vom Bater das Talent zur Musik und von der Mutter die
Seele, die seiner Harfe den Klang gab, von seinem Vater den Sinn
sür Ordnung und Pflichttreue und von der Mutter die heilige Liebe,
welche Menschheit und Gott ans Herz drückl."
Diese großen und edeln Eigenschaften hat Liszt sein Mannesalter
hindurch gepflegt und bis zu seinem Lebensende sich bewahrt. Keiner
war mehr geneigt, seinen Feinden, denn deren hatte auch er, zu ver-
zeihen, unermüdlich ihnen Gutes zu erweisen; ihm war es Herzens-
bedürfniß, junge und ältere Talsnte zu sördern, ihnen Anerkennung
zu verschaffen; was haben »icht Alles seine Schüler, seine Freunde und
seine Feinde ihm zu verdanken ! Die Zahl seiner Schüler gleicht einer
Legion, aus der die stolzesten Pianistennamen ein Künstlerdiadem
sonder Gleichen bezeichnen.
Seit Jahren hatte Liszt ein geistliches Gewand anaezogen. Jn
ihm vereinten sich in seltener Harmonie die Lust am Dasein, der Ge-
nuß des Lebens, die Weihe der Kunst mit jenem übersinnlichen Be-
dürfniffe, das nur in voller religiöser Hingebung Befriedigung flndet.
Er gleicht in dieser Beziehung den italienischen Meistern des Quatro-
cento, denen Kunst und Religion nur verschiedenartige Ausdrücke dcs-
selben Herzensdranges waren. Franz Liszt wurde Abbö und Dom-
herr. Aber niemals hat ihn der Päpste Neigung, hat ihn die lockende
AuLsicht, auch auf geistlichcm Gebiete emporzusteigen, dcr Kunst un-
treu gemacht, die nach wie vor seins ganze Seele erfüllte. Nurpflsgte
er mehrere Monate im Jahre in Rom zu leben, dort, wie Lberall
wo er erschien, von einer zahlreichen Jünger-Schaar umgeben. Auch
der ungarischen Heimath hat er, seit Ungarn eine politische Stellung
wiedergewonnen hat, größere Theilnahme zugewendet, wie er denn
deren Weisen gesammelt und in künstlerischer Durchbildung der Wclt
bekannt gemacht hat. Die Magyaren zeigten sich dem großen Sohne
ihres Landes, obwohl derselbe ihrer eigenen Entwickelung fernstand,
dankbar, sie ernannten ihn zum Chrenpräsidenlen ihres nationalen
Conservatoriums und setzten ihm einen Jahresgehalt aus, für welchen
er nur die Verpflichtung übernahm, kurze Zeit in jedem Jahre in der
ungarischen Hauptstadt zu verweilen und zu lehren. Solch' eineFür-
sorge für die materiellen Verhältnisie des Meisters war um so noth-
wendiger, als er selbst in dieser Beziehung von einer rührenden Sorg-
losigkeit war. Geld und Gut hatten nie einen anderen Werth für
Liszt als den, Anderen Freude zu spenden und Nnderen zu nützen.
Große Summen sind durch seine Hände gewandert, aber der Besitz
derselben war ihm gleichgiltig; sorglos um den folgcnden Tag gab er
sein Letztes dahin, auch darin eine wahrhaft königliche Natur.
Nach Jahrzehnten unerhörter Virtuosen-Triumphe hielt Franz
Liszt mitten in seiner Sicqeslaufbahn inne, erkor sich den stillen
Musensitz Weimar zum Aufenthalt und gab sich hier in aufopferungs-
Vollster Weise einer unermüdlichen Dirigententhärigkeit hin, zog die
Werke seiner Kunstgenosien an das Tageslicht, und, wie er früher
durch sein Spiel die tiefere Anerkennung Beethoven's mächtig
gefördert hatte, wie er Franz Schuberl dadurch schnell dem Hcr-