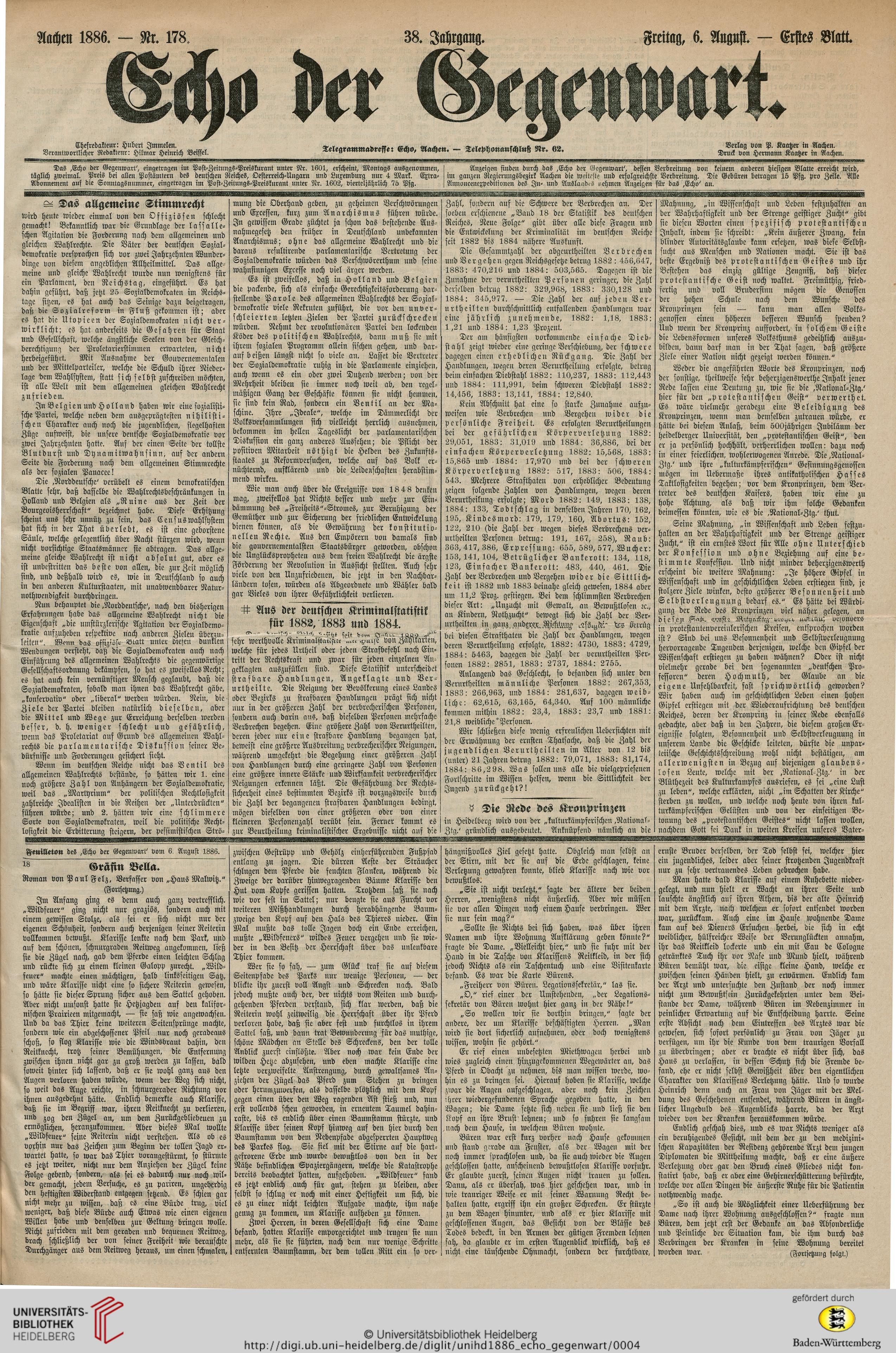Aichcn 1886. — Nr. 178.
38. Jahrgailg.
Frcitag, 6. August. — Erstcs Blatt.
Ehesredakteur: Hubert Jmmelen.
Verantwortlicher Redaltcur: Hilmar Heinrich Beissel.
Telegrammadrefler Echo, Aachen. — Telephonanschlnß Nr. 62.
Berlag von P. Kaatzer in Aachen.
Druck von Hcrmann Kaatzer in Aachen.
Das ,Echo der Gegenwart', eingetragen im Post-Zeitungs-Preiskurant untcr Nr. 1601, erscheint, Montags ausgcnommen,
täglich zweimal. Preis bei allen Postämtern dcs deutschcn Reiches, Oesterreich-Ungarn und Lnxemburg nur 4 Mark. Extra-
Abonnement auf die Sonntagsnummcr, eingetragcn im Post-Zeitungs-Preiskurant unter Nr. 1602, viertcljährlich 7ü Pfg.
Anzeigcn finden durch das ,Echo der Gcgenwart', dessen Verbreitung von keincin andercn hiesigen Blatte crreicht wird,
im ganzen Regierungsbezirk Aachen die weiteste und ersolgreichste Verbreitung. Die Gebüren betragcn 15 Pfg. pro Zeile. Alle
Annoncenexpeditioncn des Jn- und Auslaad.s oehmcn Anzeigen für das ,Echo' an.
^ Das attgemeine Stimmrecht
wird heute wieder einmal von den Offiziösen schlecht
gemacht! Bekanntlich war die Grundlage dcr lassalle-
schen Agitation dic Forderung nach dem allgemeinen und
gleichen Wahlrechte. Die Väter dcr deutschen Sozial-
demokratie vcrsprachen sich vor zwei Jahrzehnten Wunder-
dinge von diesem angeblichcn Allheilmittel. Das allge-
meine und gleiche Wahlrccht wurde nun wenigstens für
cin Parlament, den Reichstag, eingeführt. Es hat
dahin geführt, daß jetzt 25 Sozialdcmokraten im Reichs-
tage sitzcn, es hat auch das Seinige dazu beigctragen,
daß die Sozialreform in Fluß gekommen ist; aber
cs hat die Utopieen dcr Sozialdemokraten nicht ver-
wirklicht; cs hat anderseits die Gefahren für Staat
und Gesellschaft, welche ängstliche Seelcn von der Gleich-
berechtigung der Proletarierstimmen erwarteten, nicht
herbeigeführt. Mit Ausnahme der Gouvernementalen
und der Mittelparteiler, welche die Schuld ihrer Nieder-
lage dem Wahlsystem, statt sich selbst zuschreibcn möchten,
ist alle Welt mit dem allgemeinen glcichen Wahlrecht
zufrieden.
Jn Belgien und Holland haben wir eine sozialisti-
schePartei, welche ncben dcm ausgeprägtcsten nihilisti-
schen Charakter auch noch die jugendlichen, flegelhaften
Züge aufwcist, die unsere dentsche Sozialdemokratie vor
zwei Jahrzehnten hatte. Auf der einen Seite der tollste
Blutdurst und Dynamitwahnsinn, auf der andern
Seite dic Forderung nach dem allgemeinen Stimmrechte
als der sozialen Panacee!
Die ,Norddeutschc' verübelt es eincm dcmokratischen
Blatte sehr, daß dasselbe die Wahlrechtsbeschränkungen in
Holland und Bclgien als „Ruine aus der Zeit der
Bourgeoisherrschaft" bezeichnet habe. Diesc Erhitzung
scheint uns sehr unnütz zu sein, das Censuswahlsystem
hat sich in der That überlebt, es ist eine geborstene
Säule, welche gelegcntlich über Nacht stürzen wird, wenn
nicht vorsichtige Staatsmänncr sie abtragen. Das allge-
meine gleiche Wahlrecht ist nicht absolut gut, aber es
ist unbcstritten das beste von allcn, die zur Zeit möglich
sind, und deßhalb wird es, wie in Deutschland so auch
in den anderen Kulturstaaten, mit unabwendbarer Natur-
nothwendigkeit durchdringen.
Nun behauptet die.Norddeutsche', nach den bisherigen
Erfahrungen habe das allgemeine Wahlrecht nicht die
Eigcnschaft „die umstürzlerische Agitation der Sozialdemo-
kratie aufzuheben respektive nach anderen Zielcn übcrzu-
leiten". Wenn das offiziöst Biatl unier oiesen dunklen
Wendungen versteht, oaß die Sozialdemvkraten auch nach
Einführung des allgemeinen Wahlrcchts die gegenwärtige
Gesellschaftsordnung bekämpfen, so hat es zweifellosRecht;
cs hat auch kein vernünftiger Mensch geglanbt, daß dic
Sozialdemokraten, sobald man ihnen das Wahlrecht gäbe,
„konservativ" oder „liberal" werden würden. Nein, die
Ziele der Partei bleiben natürlich dieselben, aber
die Mittel und Wege zur Erreichung derselben werden
besser, d. h. weniger schlecht und gcfährlich,
wenn das Proletariat auf Grund des allgemeinen Wahl-
rechts die parlamentarische Diskussion seiner Be-
dürfnisse und Fordernngen gesichert fieht.
Wenn im deutschen Reiche nicht das Ventil dcs
allgemeincn Wahlrechts bcstände, so hätten wir 1. eine
noch größere Zahl von Anhängcrn der Sozialdemokratie,
weil das „Martyrium" der Politischen Rechtlosigkeit
zahlreiche Jdealistcn in die Rcihen der „Unterdrücktcn"
führen würde; und 2. hätten wir cine schlimmere
Sorte von Sozialdemokraten, weil die politische Recht-
losigkeit die Erbitterung stcigern, der pessimistischen Strö-
mung die Oberhand gcben, zu gehcimen Verschwörungen
und Excessen, kurz zum Anarchismus führen würde.
Jn gewissem Grade züchtct ja schon das bestehende Aus-
nahmegesetz den früher in Deutschland unbekannten
Anarchismus; ohne das allgcmeine Wahlrecht und die
daraus resultirende parlamentarische Vcrtretung der
Sozialdemokratie würden das Verschwörerthum und seine
wahnsinnigen Excesse noch viel ärger werden.
Es ist zweifellos, daß in Holland und Belgien
die packende, sich als einfache Gerechtigkeitsforderung dar-
stellende Parole des allgcmeincn Wahlrechts der Svzial-
demokratie viele Rekruten zuführt, die vor den unver-
schleierten letzten Zielen der Partei zurückschrecken
würden. Nehmt der revolutionären Partei den lockenden
Köder des politischen Wahlrechts, dann muß sie mit
ihrem sozialen Prvgramm allein fischen gehen, und dar-
auf b eißen längst nicht so viele an. Lasset die Vertreter
der Svzialdemokratie ruhig in die Parlamente einziehen,
auch wenn es ein oder zwei Dutzend werden; vvn dcr
Mehrheit bleiben sie immer noch weit ab, den regel-
mäßigen Gang der Geschäfte können sie nicht hcmmen,
sie sind kein Rad, sondern ein Ventil an der Ma-
schine. Jhre „Jdeale", welche im Dämmerlicht der
Volksversammlungen sich vielleicht herrlich ausnehmen,
bekommen im hcllen Tageslicht der parlamentarischen
Diskussion ein ganz andercs Aussehen; die Pflicht der
Positiven Mitarbeit nöthigt die Helden des Zukunfts-
staates zu Reformvcrsuchen, welche auf das Volk er-
nüchternd, aufklärend und die Leidenschaften herabstim-
mend wirken.
Wie man auch über die Ereignisse von 1848 denken
mag, zweifellos hat Nichts besser und mehr zur Ein-
dämmung des „Freiheits"-Stromes, zur Beruhigung der
Gemüther und zur Sicherung der friedlichen Entwickelung
dienen können, als die Gewährung der konstitutio-
nellen Rechte. Aus dcn Empörern von damals sind
die gouverncmentalsten Staatsbürger geworden, obschon
die Unglücksprophcten aus dem freien Wahlrecht die ärgste
Förderung der Revolution in Aussicht stellten. Auch sehr
viele von den Unzufriedenen, die jetzt in den Nachbar-
ländern tosen, würden als Abgeordnete und Wähler bald
gar Vieles von ihrer Gefährlichkeit verlieren.
^ Aus der deutschen Kriminalstatistik
sür 1882/1883 und 1884.
sehr werthvolle Kriimnalstatiflik ...c- ^uise Von Zaylkarten,
welche für jedes Urtheil oder jeden Strafbefehl nach Ein-
tritt der Rcchtskraft und zwar für jeden einzelnen An-
geklagten auszufüllen sind. Diese Statistik unterscheidet
strafbare Handlungen, Angeklagte und Ver-
urtheilte. Die Neigung der Bevölkerung eines Landes
oder Bezirks zu strafbaren Handlungen prägt sich nicht
nur in der größercn Zahl der vcrbrecherischen Personen,
sondern auch darin ans, daß dieselben Personen mehrfache
Verbrechen begehen. Eine größere Zahl von Verurtheilten,
deren jeder nur eine strafbare Handlung bcgangen hat,
beweist eine größere Ausbreitung verbrecherischer Neigungen,
während umgekehrt die Begehung einer größeren Zahl
von Handlungen durch eine geringere Zahl von Personen
eine größere innere Stärkc und Wirksamkeit verbrecherischer
Neigungen erkcnncn läßt. Die Gefährdung der Rechts-
ficherheit eines bestimmtcn Bezirks ist vorzugsweise durch
die Zahl der begangenen strafbaren Handlungen bedingt,
mögen dieselben von einer größeren oder von einer
kleineren Personenzahl verübt sein. Ferner kommt es
zur Beurtheilung kriminalistischer Ergebnisse nicht anf die
Zahl, fondern auf dic Schwere der Vcrbrechen an. Der
soeben erschiencne „Baud 18 der Statistik des deutschen
Reiches, Neue Folge" gibt über alle diese Fragen und
die Entwickelung der Kriminalität im deutschen Reiche
seit 1882 bis 1884 nähere Auskunft.
Die Gesamnitzahl der abgeurtheilten Verbrechen
und Vergehen gegen Reichsgesetze betrug 1882 : 456,647,
1883: 470,216 und 1884: 503,565. Dagegen ist die
Zunahmc dcr verurtheilten Personcn geringer, die Zahl
derselben betrug 1882: 329,968, 1883: 330,128 und
1884: 345,977. — Die Zahl der auf jcden Ver-
urtheilten durchschnittlich entfallendcn Handlungen war
eiue jährlich zunehmeude, 1882: 1,18, 1883:
1,21 und 1884: 1,23 Prozent.
Der am häufigsten vorkommende einfache Dieb-
stahl zeigt wieder eine geringe Verschiebung, der schwere
dagegen einen erheblichen Rückgang. Die Zahl der
Handlungen, wegen deren Verurthcilung erfolgte, betrug
beim einfachen Diebstahl 1882: 110,237, 1883: 112,443
und 1884: 111,991, beim schwercu Diebstahl 1882:
14,456, 1883: 13,141, 1884: 12,840.
Kein Abschnitt hat eine so starke Zunahme aufzu-
weisen wie Berbrechen nnd Vergehen wider die
Persvnliche Freiheit. Es erfolgten Verurtheilungen
bei der gefährlichen Körperverletzung 1882:
29,051, 1883: 31,019 und 1884: 36,886,' bei der
einfachen Körperverletzung 1882: 15,568, 1883:
15,865 und 1884: 17,970 und bei der schweren
Körpervcrletzung 1882: 517, 1883: 506, 1884:
543. Mehrere Strafthaten vvn erheblicher Bedeutung
zeigen folgende Zahlen von Handlungen, wegen deren
Verurtheilung erfolgte; Mord 1882: 149, 1883: 138,
1884: 133, Todtschlag in denselben Jahren 170, 162,
195, Kindesmord: 179, 179, 160, Abortus: 152,
122, 210 (die Zahl der Wegen dieses Verbrechens ver-
urtheilten Personen betrug: 191, 167, 258), Raub:
363,417,386, Erpressung: 655, 589, 577, Wucher:
153,141,104, Betrüglicher Bankerott: 134, 118,
123, Einfacher Bankerott: 483, 440, 461. Die
Zahl der Verbrechen und Vergehcn wider die Sittlich-
keit ist 1882 und 1883 beinahe gleich gewesen, 1884 aber
um 11,2 Proz. gestiegcn. Bei dem schlimmsten Verbrechen
dieser Art: „Unzucht mit Gewalt, an Bewußtlosen rc.,
an Kindern, Nothzucht" bewegt sich dic Zahl der Ber-
urtheilten in ganz andere^MMiMF drs Seirüg
bei diesen Strafthaten die Zahl der Handlungen, wegen
deren Verurtheilung erfolgte, 1882: 4730, 1883: 4729,
1884: 5463, dagegen die Zahl dcr verurtheilten Per-
sonen 1882: 2851,'1883: 2737, 1884: 2755.
Anlangend das Geschlecht, fo befanden sich unter den
Verurtheilten männliche Personen 1882: 267,353,
1883: 266,963, und 1884: 281,637, dagcgen weib-
liche: 62,615, 63,165, 64,340. Auf 100 männliche
kommen mithin 1882: 23,4, 1883: 23,7 und 1881:
21,8 weibliche'Personen.
Wir schließcn diese wenig crfreulichen Uebersichten mit
der Erwähnung der ernsten Thatsache, daß die Zahl der
jugendlichen Verurtheilten im Alter von 12 bis
(unter) 21 Jahrenbetrug 1882: 79,071, 1883: 81,174,
1884: 86,298. Was sollen uns alle die vielgcpriesenen
Fortschritte im Wissen helfen, wenn die Sittlichkeit der
Jugend zurückgeht?!
s Die Rede des KronpVirizerr
in Heidelberg wird von der „kultnrkämpferischen,National-
Ztg.' grttndlich ausgebentet. Anknüpfend nämlich an die
Mahnung, „in Wissenschaft und Leben festzuhalten an
der Wahrhaftigkeit und der Strcnge geistiger Zucht" gibt
sie diesen Worten cinen spezifisch protestantischen
Jnhalt, indem sie schreibt: „Kein äußerer Zwang, kein
blinder Autoritätsglaube kann ersetzen, was diese Selbst-
sucht aus Menschen nnd Nationen macht. Sie ist das
beste Ergebniß des protestantischen Geistes und ihr
Bestchcn das einzig gültige Zeugniß, daß dieser
protestantische Geist noch waltet. Frcimüthig, fried-
fertig und voll Brudersinn mögen die Genossen
der hohen Schule nach dem Wunsche des
Kronprinzen sein — kann man allen Volks-
genossen einen höheren besseren Wunsch spenden?
Und wenn der Kronprinz auffordert, in solchem Geiste
die Lebensformen unseres Bolksthums gedeihlich auszu-
bildcn, dann darf man iu dcr That sagen, daß größere
Zicle einer Nation nicht gezeigt werden können."
Weder die angefnhrten Worte des Kronprinzen, noch
der sonstige, theilweise sehr beherzigenswerthe Jnhalt jener
Rede lassen cine Deutung zu, wie sie die ,National-Ztg.'
hier für den „protestantischen Geist" verwerthet.
Es wäre vielmehr geradczu eine Beleidigung des
Kronprinzen, wenn man demselbcn zutrauen würde, er
hätte bei diesem Anlaß, beim 500jährigen Jubiläum der
heidelberger Universität, den „Protestantischen Geist", den
cr ja Persönlich hvchhält, vcrhcrrlichen wollen: dazu noch
in einer feierlichen, wohlerwogencn Anrede. Die,National-
Ztg.' und ihre „kulturkämpferischen" Gesinnungsgenossen
mögen im Uebermaßc ihres antikatholischen Hasses
Taktlosigkeiten begehen; vor dem Kronprinzen, dem Ver-
treter des deutschen Kaisers, haben wir eine zu
hohe Achtung, als daß wir ihm solche Gedanken
beimessen könnten, wie es die ,National-Ztg.' thut.
Seine Mahnung, „in Wissenschaft und Leben festzu-
halten an der Wahrhaftigkeit und der Strenge geistiger
Zucht," ist ein ernstes Wort für Alle ohne Unterschied
der Konfession und ohne Beziehung auf eine be-
stimmte Konfession. Und nicht minder beherzigenswerth
erscheint die weitere Mahnung: „Je höhere Gipfel in
Wissenschaft und im geschichtlichen Leben erstiegen sind, je
stolzere Ziele winken, desto größcrcr Besonnenheitund
Selbstverleugnung bedarf es." Es hätte bei Würdi-
gung der Rede des Kronprinzen viel näher gelegcn, an
djeiexi -riystr uaeuiu; oe;onvers
in protestantenvereinlerischen Kreisen, entsprochen worden
ist? Sind bei uns Besonncnheit und Selbstverleugnung
hervorragende Tugcnden derjenigen, welche dcn Gipfel der
Wissenschaft erstiegen zu haben wähnen? Oder ist nicht
vielmehr gerade bei den sogenannten „dcutschen Pro-
fessoren" deren Hochmuth, der Glaube an die
eigene Unfehlbarkeit, fast sprichwörtlich geworden?
Wir haben auch im geschichtlichen Leben cinen hohen
Gipfel erstiegen mit der Wiederaufrichtung des dentschen
Reiches, deren der Kronprinz in seiner Rede ebenfalls
gedachte, aber daß in dcn Jahren, die diesem großen Er-
eignisse folgten, Besonnenheit und Selbstverleugnung in
unserem Lande die Geschicke leitcten, dürfte die unpar-
teiische Geschichtsschreibung wohl nicht bestätigen, am
allerwenigsten in Bezug auf diejenigen glaubens-
losen Leute, welche mit der ,National-Ztg.' in der
Blüthezeit des Kulturkampfes ausriefen, es sei „eine Lust
zu leben", welche erklärten, nicht „im Schatten der Kirche"
sterben zu wollen, und wclche noch heute von ihren kul-
turkämpferischen Gelüsten und von der einseitigen Be-
tonung des „protestantischen Geistes" nicht lassen wollen,
nachdem Gott sei Dank in weiten Kreisen unseres Vater-
Keuilleto« deS ,Echv der Gegenwart' vom 6. August 1886.
^ Gräfin Betta.
Roman von Paul Felz, Verfasser von „Haus Malwitz."
(Fortsetzung.)
Jm Anfang ging es denn auch ganz vortrefflich.
„Wildfeuer" ging nicht nur graziös, sondern auch mit
cinem gewiffen Stolze, als sei er sich nicht nur der
eigenen Schönheit, sondern auch derjenigen seiner Reiterin
vollkommen bewußt. Klariffe lenkte nach dem Park, und
auf dem schönen, schnurgraden Reitweg angekommen, ließ
sie die Zügel nach, gab dem Pferde einen leichten Schlag
und rückte sich zu einem kleinen GaloPP zurecht. „Wild-
feuer" machte einen mächtigen, halb linksseitigcn Satz,
und wäre Klarisse nicht eine so sichere Reiterin gewesen,
so hätte sie dieser Sprung sicher aus dem Sattel gehoben.
Aber nicht umsonst hatte sie Hetzjagden auf den kalifor-
nischen Prairicen mitgemacht, — sie saß wie angewachsen.
Und da das Thier keine weitercn Seitensprünge machte,
sondern wie ein abgeschossener Pfeil nur noch geradeaus
schoß, so flog Klarisse wie die Windsbraut dahin, den
Reitknecht, trotz seiner Bemühungen, die Entfernung
zwischen ihnen nicht gar zu groß werden zu lassen, bald
soweit hinter sich laffend, daß er sie wohl ganz aus den
Augen verloren haben würde, wenn der Weg sich nicht,
so weit das Auge reichte, in schnurgerader Richtung vor
ihnen ausgedehnt hätte. Endlich bemerkte auch Klarisse,
daß sie im Begriff war, ihren Reitknecht zu verlieren,
und zog den Zügel an, um dem Zurückgebliebeuen zu
ermöglichen, heranzukommen. Aber dieses Mal wollte
„Wildfeuer" seine Reiterin nicht verstehen. Als ob es
vorhin nur das Zeichen zum Beginn der tollen Jagd er-
wartet hatte, so war das Thier vorangestürmt, so stürmte
es jetzt weiter, nicht nur dem Anziehen der Zügel keine
Folge gebend, sondern, als sei es dadurch nur noch wil-
der gemacht, jedem Versuche, es zu pariren, ungeberdig
den heftigsten Widerstand entgegen setzend. Es schien gar
nicht mehr zu wiffen, daß es eine Bürde trug, viel
weniger, daß diese Bürde auch Etwas wie einen eigenen
Willen habe und denselben zur Geltung bringen wolle.
Nicht zufrieden mit dem geraden und bequemen Reitweg,
brach schließlich der von seiner Freiheit wie berauschte
Durchgänger aus dem Reitweg heraus, um einen schmalen,
zwischen Gestrüpp und Gehölz einhcrführenden Fußpfad
entlang zu jagen. Die dürren Aeste der Sträucher
schlugen dem Pferde die fcuchten Flanken, während die
Zweige der darüber hinwegragenden Bäume Klarisse den
Hut vom Kopfe gerissen hatten. Trotzdem saß sie nach
wie vor fest im Sattel; nur beugte sie aus Furcht vor
weiteren Mißhandlungen durch herabhängende Baum-
zweige den Kopf auf den Hals des Thieres nieder. Ein
Mal mnßte das tvlle Jagen doch ein Ende erreichen,
mußte „Wildfeuers" wildes Feuer vergehen und sie wie-
der in den Besitz der Herrschaft über das unlenkbare
Thier kommen.
Wer sie so sah, — zum Glück traf sie auf diesem
Seitenpfade des Parks nur wenige Personen, — der
blickte ihr zuerst voll Angst und Schrecken nach. Bald
jedoch mußte auch der, der nichts vom Reiten und durch-
gehenden Pferdcn verstaud, sich klar werden, daß die
Reiterin wohl zeitweilig die Herrschaft über ihr Pferd
verloren habe, daß sie aber fest und furchtlos in ihrem
Sattel saß, und dann trat Bewunderung für das muthige,
schöne Mädchen an Stellc des Schreckens, den der tolle
Anblick zuerst cinflößte. Aber nvch war kein Ende der
wilden Hetze abzusehen, und eben machte Klariffe eine
letzte verzweifelte Anstrengung, dnrch gcwaltsames An-
ziehen der Zügel das Pferd zum Stehen zu bringen
oder herumzuwerfen, als dasselbe Plötzlich mit dem Kopf
gegen einen über den Weg ragenden Ast stieß und, nun
erst vollends scheu geworden, in erneutem Taumel dahin-
raste, bis es endlich über einen Baumstamm stürzte, und
Klarisse über seinen Kopf hiuweg auf den hier durch den
Baumstamm von dem Nebenpfade abgesperrten Hauptweg
des Parkes flog. Sie fiel mit der Stirne auf die hart-
gefrorene Erde und wurde bewußtlos von den in der
Nähe befindlichen Spaziergängern, welche die Katastrophe
bereits beobachtet hatten, aufgehoben. „Wildfeuer" fand
es jetzt endlich auch für gut, stehen zu bleiben, aber
selbst so schlug er noch mit einer Heftigkeit um sich, die
es zu einer nicht leichten Aufgabe machte, ihm nahe
genug zu kommen, um Klariffe aufheben zu können.
Zwei Herren, in deren Gesellschaft sich eine Dame
befand, hatten Klarisse emporgerichtet und trugen sie nun
mehr, als sie sie führten, nach dem nur wenige Schritte
entfernten Baumstamm, der dem tollen Ritt ein so ver-
hängnißvolles Ziel gesetzt hatte. Obgleich man selbst an
der Stirn, mit der sie auf die Erdc geschlagen, keine
Verletzung gewahren konnte, blieb Klarisse nach wie vor
bcwußtlos.
„Sie ist nicht verletzt," sagte der ältere der beiden
Herren, „wenigstens nicht äußerlich. Aber wir müssen
sie vor allen Dingen nach einem Hause verbringen. Wer
sie nur sein mag?"
„Sollte sie Nichts bei sich haben, was über ihren
Namen und ihrc Wohnung Aufklärung geben könnte?"
fragte die Dame. „Vielleicht hicr," und sie fuhr mit der
Hand in die Tasche von Klariffens Reitkleid, in der sich
jedoch Nichts als ein Taschentuch und eine Visitenkarte
befand. Es war die Karte Bürens.
„Freiherr von Büren. Legationssekrctär," las sie.
„O," rief eincr der Umstehenden, „der Legations-
sekretär von Büren wohnt hier ganz in der Nähe!"
„So wollen wir sie dorthin bringcn," sagte der
andere, der um Klarisse beschästigten Herren. „Man
wird sie dort sicherlich aufnehmen, oder doch wenigstens
wiffen, wohin sie gehört."
Er rief einen unbesetzten Miethwagen herbei und
wies zugleich einen hinzugekommcnen Wegewärter an, das
Pferd in Obacht zu nehmen, bis man wiffen werde, wo-
hin es zu bringen sei. Hierauf hoben sic Klarisie, welche
zwyr die Augen aufgeschlagen, aber noch kein Zeichen
ihrer wiedergefundenen Sprache gegeben hatte, in den
Wagen; die Dame sctzte sich neben sie und ließ sie den
Kopf an ihrc Brnst lehnen; und so fuhren sie langsam
nach dem Hause, in welchem Büren wvhnte.
Büren war erst kurz vorher nach Hause gekommen
und stand gerade am Fcnster, als der Wagen mit der
noch immer sprachlosen und, da sie auch wieder die Augen
geschloffen hatte, anscheinend bewußtlosen Klariffe vorfuhr.
Er glaubte zuerst, seinen Augen nicht trauen zu sollen.
Dann, als er übersah, was hier geschehen war, und in
wie trauriger Weise er mit seiner Warnung Recht be-
halten hatte, ergriff ihn ein großer Schrecken. Er stürzte
zu dem Wagen hinunter, und als er hier Klarisse mit
geschloffenen Augen, das Gesicht von der Blässe des
Todes bedeckt, in den Armen der gütigen Fremden lchnen
sah, da glaubte er im ersten Augenblick wirklich, daß es
nicht cine tänschende Ohnmacht, sondern der furchtbare,
ernste Bruder derselben, der Tod selbst sei, welcher hier
ein jugendliches, leider aber seincr strotzenden Jugendkraft
nur zu sehr vertrauendes Leben gebrochen habe.
Man hatte bald Klarisse auf einem Ruhebette nieder-
gelegt, und nun hielt er Wacht an ihrer Seite und
lauschte ängstlich auf ihren Athem, bis der alte Heinrich
mit dem Arzte, nach welchem er sofort entsendet worden
war, zurückkam. Auch cine im Hause wohnende Dame
kam auf des Dieners Ersuchen herbei, die sich in echt
weiblicher, hülfreicher Weise der Verunglückten annahm,
ihr das Reitkleid lockerte und ein mit Eau de Cologne
getränktes Tuch ihr vor Nase und Mund hielt, während
Büren bemüht war, dic eisige kleine Hand, welche er
zwischen seinen Händen hielt, zu erwärmen. Endlich kam
der Arzt und untersuchte den Zustand der noch immer
nicht zum Bewußtscin Zurückgekehrten unter dem Bei-
stande der Dame, wührend Büren im Nebenzimmer in
peinlicher Erwartung auf die Entscheidung harrte. Seine
erste Absicht nach dem Eintreffen des Arztes war die
gewesen, sich sofort persönlich zu Frau von Jäger zu
verfügen, um ihr die Kunde von dem traurigen Vorfall
zu überbringen; aber er brachte es nicht über sich, das
Haus zu verlassen, in deffen Schutz sich die Fremde be-
fand, ehe er nicht selbst Gewißheit über den eigentlichen
Charakter von Klarissens Verletzung hätte. Und so wurde
Heinrich denn auch an Frau von Jäger mit der Mel-
dung des Geschehenen entsendet, während Büren in ängst-
licher Ungeduld des Augenblicks harrte, da der Arzt
wieder von der Kranken herauskommen würde.
Endlich geschah dies, und es war Nichts weniger als
ein beruhigendes Gesicht, mit dem der zu den medizini-
schen Kapazitäten der Residenz gehörende Arzt dem jungen
Diplomaten die Mittheilung machte, daß er eine äußere
Verletzung oder gar den Bruch eines Gliedes nicht kon-
statirt habe, daß er aber eine Gehirnerschüttcrung befürchte,
welche vor allcn Dingen die äußerste Ruhe für dic Patientin
nothwendig mache.
„So ist auch die Möglichkeit einer Ueberführung der
Dame nach ihrer Wohnung ausgeschlossen?" fragte nun
Büren, dem jetzt erst der Gedanke an das Absonderliche
und Peinliche der Situation kam, die ihm durch das
Verbringen der Kranken in seine Wohnung bereitet
worden war. (Fortsetzung folgt.)
38. Jahrgailg.
Frcitag, 6. August. — Erstcs Blatt.
Ehesredakteur: Hubert Jmmelen.
Verantwortlicher Redaltcur: Hilmar Heinrich Beissel.
Telegrammadrefler Echo, Aachen. — Telephonanschlnß Nr. 62.
Berlag von P. Kaatzer in Aachen.
Druck von Hcrmann Kaatzer in Aachen.
Das ,Echo der Gegenwart', eingetragen im Post-Zeitungs-Preiskurant untcr Nr. 1601, erscheint, Montags ausgcnommen,
täglich zweimal. Preis bei allen Postämtern dcs deutschcn Reiches, Oesterreich-Ungarn und Lnxemburg nur 4 Mark. Extra-
Abonnement auf die Sonntagsnummcr, eingetragcn im Post-Zeitungs-Preiskurant unter Nr. 1602, viertcljährlich 7ü Pfg.
Anzeigcn finden durch das ,Echo der Gcgenwart', dessen Verbreitung von keincin andercn hiesigen Blatte crreicht wird,
im ganzen Regierungsbezirk Aachen die weiteste und ersolgreichste Verbreitung. Die Gebüren betragcn 15 Pfg. pro Zeile. Alle
Annoncenexpeditioncn des Jn- und Auslaad.s oehmcn Anzeigen für das ,Echo' an.
^ Das attgemeine Stimmrecht
wird heute wieder einmal von den Offiziösen schlecht
gemacht! Bekanntlich war die Grundlage dcr lassalle-
schen Agitation dic Forderung nach dem allgemeinen und
gleichen Wahlrechte. Die Väter dcr deutschen Sozial-
demokratie vcrsprachen sich vor zwei Jahrzehnten Wunder-
dinge von diesem angeblichcn Allheilmittel. Das allge-
meine und gleiche Wahlrccht wurde nun wenigstens für
cin Parlament, den Reichstag, eingeführt. Es hat
dahin geführt, daß jetzt 25 Sozialdcmokraten im Reichs-
tage sitzcn, es hat auch das Seinige dazu beigctragen,
daß die Sozialreform in Fluß gekommen ist; aber
cs hat die Utopieen dcr Sozialdemokraten nicht ver-
wirklicht; cs hat anderseits die Gefahren für Staat
und Gesellschaft, welche ängstliche Seelcn von der Gleich-
berechtigung der Proletarierstimmen erwarteten, nicht
herbeigeführt. Mit Ausnahme der Gouvernementalen
und der Mittelparteiler, welche die Schuld ihrer Nieder-
lage dem Wahlsystem, statt sich selbst zuschreibcn möchten,
ist alle Welt mit dem allgemeinen glcichen Wahlrecht
zufrieden.
Jn Belgien und Holland haben wir eine sozialisti-
schePartei, welche ncben dcm ausgeprägtcsten nihilisti-
schen Charakter auch noch die jugendlichen, flegelhaften
Züge aufwcist, die unsere dentsche Sozialdemokratie vor
zwei Jahrzehnten hatte. Auf der einen Seite der tollste
Blutdurst und Dynamitwahnsinn, auf der andern
Seite dic Forderung nach dem allgemeinen Stimmrechte
als der sozialen Panacee!
Die ,Norddeutschc' verübelt es eincm dcmokratischen
Blatte sehr, daß dasselbe die Wahlrechtsbeschränkungen in
Holland und Bclgien als „Ruine aus der Zeit der
Bourgeoisherrschaft" bezeichnet habe. Diesc Erhitzung
scheint uns sehr unnütz zu sein, das Censuswahlsystem
hat sich in der That überlebt, es ist eine geborstene
Säule, welche gelegcntlich über Nacht stürzen wird, wenn
nicht vorsichtige Staatsmänncr sie abtragen. Das allge-
meine gleiche Wahlrecht ist nicht absolut gut, aber es
ist unbcstritten das beste von allcn, die zur Zeit möglich
sind, und deßhalb wird es, wie in Deutschland so auch
in den anderen Kulturstaaten, mit unabwendbarer Natur-
nothwendigkeit durchdringen.
Nun behauptet die.Norddeutsche', nach den bisherigen
Erfahrungen habe das allgemeine Wahlrecht nicht die
Eigcnschaft „die umstürzlerische Agitation der Sozialdemo-
kratie aufzuheben respektive nach anderen Zielcn übcrzu-
leiten". Wenn das offiziöst Biatl unier oiesen dunklen
Wendungen versteht, oaß die Sozialdemvkraten auch nach
Einführung des allgemeinen Wahlrcchts die gegenwärtige
Gesellschaftsordnung bekämpfen, so hat es zweifellosRecht;
cs hat auch kein vernünftiger Mensch geglanbt, daß dic
Sozialdemokraten, sobald man ihnen das Wahlrecht gäbe,
„konservativ" oder „liberal" werden würden. Nein, die
Ziele der Partei bleiben natürlich dieselben, aber
die Mittel und Wege zur Erreichung derselben werden
besser, d. h. weniger schlecht und gcfährlich,
wenn das Proletariat auf Grund des allgemeinen Wahl-
rechts die parlamentarische Diskussion seiner Be-
dürfnisse und Fordernngen gesichert fieht.
Wenn im deutschen Reiche nicht das Ventil dcs
allgemeincn Wahlrechts bcstände, so hätten wir 1. eine
noch größere Zahl von Anhängcrn der Sozialdemokratie,
weil das „Martyrium" der Politischen Rechtlosigkeit
zahlreiche Jdealistcn in die Rcihen der „Unterdrücktcn"
führen würde; und 2. hätten wir cine schlimmere
Sorte von Sozialdemokraten, weil die politische Recht-
losigkeit die Erbitterung stcigern, der pessimistischen Strö-
mung die Oberhand gcben, zu gehcimen Verschwörungen
und Excessen, kurz zum Anarchismus führen würde.
Jn gewissem Grade züchtct ja schon das bestehende Aus-
nahmegesetz den früher in Deutschland unbekannten
Anarchismus; ohne das allgcmeine Wahlrecht und die
daraus resultirende parlamentarische Vcrtretung der
Sozialdemokratie würden das Verschwörerthum und seine
wahnsinnigen Excesse noch viel ärger werden.
Es ist zweifellos, daß in Holland und Belgien
die packende, sich als einfache Gerechtigkeitsforderung dar-
stellende Parole des allgcmeincn Wahlrechts der Svzial-
demokratie viele Rekruten zuführt, die vor den unver-
schleierten letzten Zielen der Partei zurückschrecken
würden. Nehmt der revolutionären Partei den lockenden
Köder des politischen Wahlrechts, dann muß sie mit
ihrem sozialen Prvgramm allein fischen gehen, und dar-
auf b eißen längst nicht so viele an. Lasset die Vertreter
der Svzialdemokratie ruhig in die Parlamente einziehen,
auch wenn es ein oder zwei Dutzend werden; vvn dcr
Mehrheit bleiben sie immer noch weit ab, den regel-
mäßigen Gang der Geschäfte können sie nicht hcmmen,
sie sind kein Rad, sondern ein Ventil an der Ma-
schine. Jhre „Jdeale", welche im Dämmerlicht der
Volksversammlungen sich vielleicht herrlich ausnehmen,
bekommen im hcllen Tageslicht der parlamentarischen
Diskussion ein ganz andercs Aussehen; die Pflicht der
Positiven Mitarbeit nöthigt die Helden des Zukunfts-
staates zu Reformvcrsuchen, welche auf das Volk er-
nüchternd, aufklärend und die Leidenschaften herabstim-
mend wirken.
Wie man auch über die Ereignisse von 1848 denken
mag, zweifellos hat Nichts besser und mehr zur Ein-
dämmung des „Freiheits"-Stromes, zur Beruhigung der
Gemüther und zur Sicherung der friedlichen Entwickelung
dienen können, als die Gewährung der konstitutio-
nellen Rechte. Aus dcn Empörern von damals sind
die gouverncmentalsten Staatsbürger geworden, obschon
die Unglücksprophcten aus dem freien Wahlrecht die ärgste
Förderung der Revolution in Aussicht stellten. Auch sehr
viele von den Unzufriedenen, die jetzt in den Nachbar-
ländern tosen, würden als Abgeordnete und Wähler bald
gar Vieles von ihrer Gefährlichkeit verlieren.
^ Aus der deutschen Kriminalstatistik
sür 1882/1883 und 1884.
sehr werthvolle Kriimnalstatiflik ...c- ^uise Von Zaylkarten,
welche für jedes Urtheil oder jeden Strafbefehl nach Ein-
tritt der Rcchtskraft und zwar für jeden einzelnen An-
geklagten auszufüllen sind. Diese Statistik unterscheidet
strafbare Handlungen, Angeklagte und Ver-
urtheilte. Die Neigung der Bevölkerung eines Landes
oder Bezirks zu strafbaren Handlungen prägt sich nicht
nur in der größercn Zahl der vcrbrecherischen Personen,
sondern auch darin ans, daß dieselben Personen mehrfache
Verbrechen begehen. Eine größere Zahl von Verurtheilten,
deren jeder nur eine strafbare Handlung bcgangen hat,
beweist eine größere Ausbreitung verbrecherischer Neigungen,
während umgekehrt die Begehung einer größeren Zahl
von Handlungen durch eine geringere Zahl von Personen
eine größere innere Stärkc und Wirksamkeit verbrecherischer
Neigungen erkcnncn läßt. Die Gefährdung der Rechts-
ficherheit eines bestimmtcn Bezirks ist vorzugsweise durch
die Zahl der begangenen strafbaren Handlungen bedingt,
mögen dieselben von einer größeren oder von einer
kleineren Personenzahl verübt sein. Ferner kommt es
zur Beurtheilung kriminalistischer Ergebnisse nicht anf die
Zahl, fondern auf dic Schwere der Vcrbrechen an. Der
soeben erschiencne „Baud 18 der Statistik des deutschen
Reiches, Neue Folge" gibt über alle diese Fragen und
die Entwickelung der Kriminalität im deutschen Reiche
seit 1882 bis 1884 nähere Auskunft.
Die Gesamnitzahl der abgeurtheilten Verbrechen
und Vergehen gegen Reichsgesetze betrug 1882 : 456,647,
1883: 470,216 und 1884: 503,565. Dagegen ist die
Zunahmc dcr verurtheilten Personcn geringer, die Zahl
derselben betrug 1882: 329,968, 1883: 330,128 und
1884: 345,977. — Die Zahl der auf jcden Ver-
urtheilten durchschnittlich entfallendcn Handlungen war
eiue jährlich zunehmeude, 1882: 1,18, 1883:
1,21 und 1884: 1,23 Prozent.
Der am häufigsten vorkommende einfache Dieb-
stahl zeigt wieder eine geringe Verschiebung, der schwere
dagegen einen erheblichen Rückgang. Die Zahl der
Handlungen, wegen deren Verurthcilung erfolgte, betrug
beim einfachen Diebstahl 1882: 110,237, 1883: 112,443
und 1884: 111,991, beim schwercu Diebstahl 1882:
14,456, 1883: 13,141, 1884: 12,840.
Kein Abschnitt hat eine so starke Zunahme aufzu-
weisen wie Berbrechen nnd Vergehen wider die
Persvnliche Freiheit. Es erfolgten Verurtheilungen
bei der gefährlichen Körperverletzung 1882:
29,051, 1883: 31,019 und 1884: 36,886,' bei der
einfachen Körperverletzung 1882: 15,568, 1883:
15,865 und 1884: 17,970 und bei der schweren
Körpervcrletzung 1882: 517, 1883: 506, 1884:
543. Mehrere Strafthaten vvn erheblicher Bedeutung
zeigen folgende Zahlen von Handlungen, wegen deren
Verurtheilung erfolgte; Mord 1882: 149, 1883: 138,
1884: 133, Todtschlag in denselben Jahren 170, 162,
195, Kindesmord: 179, 179, 160, Abortus: 152,
122, 210 (die Zahl der Wegen dieses Verbrechens ver-
urtheilten Personen betrug: 191, 167, 258), Raub:
363,417,386, Erpressung: 655, 589, 577, Wucher:
153,141,104, Betrüglicher Bankerott: 134, 118,
123, Einfacher Bankerott: 483, 440, 461. Die
Zahl der Verbrechen und Vergehcn wider die Sittlich-
keit ist 1882 und 1883 beinahe gleich gewesen, 1884 aber
um 11,2 Proz. gestiegcn. Bei dem schlimmsten Verbrechen
dieser Art: „Unzucht mit Gewalt, an Bewußtlosen rc.,
an Kindern, Nothzucht" bewegt sich dic Zahl der Ber-
urtheilten in ganz andere^MMiMF drs Seirüg
bei diesen Strafthaten die Zahl der Handlungen, wegen
deren Verurtheilung erfolgte, 1882: 4730, 1883: 4729,
1884: 5463, dagegen die Zahl dcr verurtheilten Per-
sonen 1882: 2851,'1883: 2737, 1884: 2755.
Anlangend das Geschlecht, fo befanden sich unter den
Verurtheilten männliche Personen 1882: 267,353,
1883: 266,963, und 1884: 281,637, dagcgen weib-
liche: 62,615, 63,165, 64,340. Auf 100 männliche
kommen mithin 1882: 23,4, 1883: 23,7 und 1881:
21,8 weibliche'Personen.
Wir schließcn diese wenig crfreulichen Uebersichten mit
der Erwähnung der ernsten Thatsache, daß die Zahl der
jugendlichen Verurtheilten im Alter von 12 bis
(unter) 21 Jahrenbetrug 1882: 79,071, 1883: 81,174,
1884: 86,298. Was sollen uns alle die vielgcpriesenen
Fortschritte im Wissen helfen, wenn die Sittlichkeit der
Jugend zurückgeht?!
s Die Rede des KronpVirizerr
in Heidelberg wird von der „kultnrkämpferischen,National-
Ztg.' grttndlich ausgebentet. Anknüpfend nämlich an die
Mahnung, „in Wissenschaft und Leben festzuhalten an
der Wahrhaftigkeit und der Strcnge geistiger Zucht" gibt
sie diesen Worten cinen spezifisch protestantischen
Jnhalt, indem sie schreibt: „Kein äußerer Zwang, kein
blinder Autoritätsglaube kann ersetzen, was diese Selbst-
sucht aus Menschen nnd Nationen macht. Sie ist das
beste Ergebniß des protestantischen Geistes und ihr
Bestchcn das einzig gültige Zeugniß, daß dieser
protestantische Geist noch waltet. Frcimüthig, fried-
fertig und voll Brudersinn mögen die Genossen
der hohen Schule nach dem Wunsche des
Kronprinzen sein — kann man allen Volks-
genossen einen höheren besseren Wunsch spenden?
Und wenn der Kronprinz auffordert, in solchem Geiste
die Lebensformen unseres Bolksthums gedeihlich auszu-
bildcn, dann darf man iu dcr That sagen, daß größere
Zicle einer Nation nicht gezeigt werden können."
Weder die angefnhrten Worte des Kronprinzen, noch
der sonstige, theilweise sehr beherzigenswerthe Jnhalt jener
Rede lassen cine Deutung zu, wie sie die ,National-Ztg.'
hier für den „protestantischen Geist" verwerthet.
Es wäre vielmehr geradczu eine Beleidigung des
Kronprinzen, wenn man demselbcn zutrauen würde, er
hätte bei diesem Anlaß, beim 500jährigen Jubiläum der
heidelberger Universität, den „Protestantischen Geist", den
cr ja Persönlich hvchhält, vcrhcrrlichen wollen: dazu noch
in einer feierlichen, wohlerwogencn Anrede. Die,National-
Ztg.' und ihre „kulturkämpferischen" Gesinnungsgenossen
mögen im Uebermaßc ihres antikatholischen Hasses
Taktlosigkeiten begehen; vor dem Kronprinzen, dem Ver-
treter des deutschen Kaisers, haben wir eine zu
hohe Achtung, als daß wir ihm solche Gedanken
beimessen könnten, wie es die ,National-Ztg.' thut.
Seine Mahnung, „in Wissenschaft und Leben festzu-
halten an der Wahrhaftigkeit und der Strenge geistiger
Zucht," ist ein ernstes Wort für Alle ohne Unterschied
der Konfession und ohne Beziehung auf eine be-
stimmte Konfession. Und nicht minder beherzigenswerth
erscheint die weitere Mahnung: „Je höhere Gipfel in
Wissenschaft und im geschichtlichen Leben erstiegen sind, je
stolzere Ziele winken, desto größcrcr Besonnenheitund
Selbstverleugnung bedarf es." Es hätte bei Würdi-
gung der Rede des Kronprinzen viel näher gelegcn, an
djeiexi -riystr uaeuiu; oe;onvers
in protestantenvereinlerischen Kreisen, entsprochen worden
ist? Sind bei uns Besonncnheit und Selbstverleugnung
hervorragende Tugcnden derjenigen, welche dcn Gipfel der
Wissenschaft erstiegen zu haben wähnen? Oder ist nicht
vielmehr gerade bei den sogenannten „dcutschen Pro-
fessoren" deren Hochmuth, der Glaube an die
eigene Unfehlbarkeit, fast sprichwörtlich geworden?
Wir haben auch im geschichtlichen Leben cinen hohen
Gipfel erstiegen mit der Wiederaufrichtung des dentschen
Reiches, deren der Kronprinz in seiner Rede ebenfalls
gedachte, aber daß in dcn Jahren, die diesem großen Er-
eignisse folgten, Besonnenheit und Selbstverleugnung in
unserem Lande die Geschicke leitcten, dürfte die unpar-
teiische Geschichtsschreibung wohl nicht bestätigen, am
allerwenigsten in Bezug auf diejenigen glaubens-
losen Leute, welche mit der ,National-Ztg.' in der
Blüthezeit des Kulturkampfes ausriefen, es sei „eine Lust
zu leben", welche erklärten, nicht „im Schatten der Kirche"
sterben zu wollen, und wclche noch heute von ihren kul-
turkämpferischen Gelüsten und von der einseitigen Be-
tonung des „protestantischen Geistes" nicht lassen wollen,
nachdem Gott sei Dank in weiten Kreisen unseres Vater-
Keuilleto« deS ,Echv der Gegenwart' vom 6. August 1886.
^ Gräfin Betta.
Roman von Paul Felz, Verfasser von „Haus Malwitz."
(Fortsetzung.)
Jm Anfang ging es denn auch ganz vortrefflich.
„Wildfeuer" ging nicht nur graziös, sondern auch mit
cinem gewiffen Stolze, als sei er sich nicht nur der
eigenen Schönheit, sondern auch derjenigen seiner Reiterin
vollkommen bewußt. Klariffe lenkte nach dem Park, und
auf dem schönen, schnurgraden Reitweg angekommen, ließ
sie die Zügel nach, gab dem Pferde einen leichten Schlag
und rückte sich zu einem kleinen GaloPP zurecht. „Wild-
feuer" machte einen mächtigen, halb linksseitigcn Satz,
und wäre Klarisse nicht eine so sichere Reiterin gewesen,
so hätte sie dieser Sprung sicher aus dem Sattel gehoben.
Aber nicht umsonst hatte sie Hetzjagden auf den kalifor-
nischen Prairicen mitgemacht, — sie saß wie angewachsen.
Und da das Thier keine weitercn Seitensprünge machte,
sondern wie ein abgeschossener Pfeil nur noch geradeaus
schoß, so flog Klarisse wie die Windsbraut dahin, den
Reitknecht, trotz seiner Bemühungen, die Entfernung
zwischen ihnen nicht gar zu groß werden zu lassen, bald
soweit hinter sich laffend, daß er sie wohl ganz aus den
Augen verloren haben würde, wenn der Weg sich nicht,
so weit das Auge reichte, in schnurgerader Richtung vor
ihnen ausgedehnt hätte. Endlich bemerkte auch Klarisse,
daß sie im Begriff war, ihren Reitknecht zu verlieren,
und zog den Zügel an, um dem Zurückgebliebeuen zu
ermöglichen, heranzukommen. Aber dieses Mal wollte
„Wildfeuer" seine Reiterin nicht verstehen. Als ob es
vorhin nur das Zeichen zum Beginn der tollen Jagd er-
wartet hatte, so war das Thier vorangestürmt, so stürmte
es jetzt weiter, nicht nur dem Anziehen der Zügel keine
Folge gebend, sondern, als sei es dadurch nur noch wil-
der gemacht, jedem Versuche, es zu pariren, ungeberdig
den heftigsten Widerstand entgegen setzend. Es schien gar
nicht mehr zu wiffen, daß es eine Bürde trug, viel
weniger, daß diese Bürde auch Etwas wie einen eigenen
Willen habe und denselben zur Geltung bringen wolle.
Nicht zufrieden mit dem geraden und bequemen Reitweg,
brach schließlich der von seiner Freiheit wie berauschte
Durchgänger aus dem Reitweg heraus, um einen schmalen,
zwischen Gestrüpp und Gehölz einhcrführenden Fußpfad
entlang zu jagen. Die dürren Aeste der Sträucher
schlugen dem Pferde die fcuchten Flanken, während die
Zweige der darüber hinwegragenden Bäume Klarisse den
Hut vom Kopfe gerissen hatten. Trotzdem saß sie nach
wie vor fest im Sattel; nur beugte sie aus Furcht vor
weiteren Mißhandlungen durch herabhängende Baum-
zweige den Kopf auf den Hals des Thieres nieder. Ein
Mal mnßte das tvlle Jagen doch ein Ende erreichen,
mußte „Wildfeuers" wildes Feuer vergehen und sie wie-
der in den Besitz der Herrschaft über das unlenkbare
Thier kommen.
Wer sie so sah, — zum Glück traf sie auf diesem
Seitenpfade des Parks nur wenige Personen, — der
blickte ihr zuerst voll Angst und Schrecken nach. Bald
jedoch mußte auch der, der nichts vom Reiten und durch-
gehenden Pferdcn verstaud, sich klar werden, daß die
Reiterin wohl zeitweilig die Herrschaft über ihr Pferd
verloren habe, daß sie aber fest und furchtlos in ihrem
Sattel saß, und dann trat Bewunderung für das muthige,
schöne Mädchen an Stellc des Schreckens, den der tolle
Anblick zuerst cinflößte. Aber nvch war kein Ende der
wilden Hetze abzusehen, und eben machte Klariffe eine
letzte verzweifelte Anstrengung, dnrch gcwaltsames An-
ziehen der Zügel das Pferd zum Stehen zu bringen
oder herumzuwerfen, als dasselbe Plötzlich mit dem Kopf
gegen einen über den Weg ragenden Ast stieß und, nun
erst vollends scheu geworden, in erneutem Taumel dahin-
raste, bis es endlich über einen Baumstamm stürzte, und
Klarisse über seinen Kopf hiuweg auf den hier durch den
Baumstamm von dem Nebenpfade abgesperrten Hauptweg
des Parkes flog. Sie fiel mit der Stirne auf die hart-
gefrorene Erde und wurde bewußtlos von den in der
Nähe befindlichen Spaziergängern, welche die Katastrophe
bereits beobachtet hatten, aufgehoben. „Wildfeuer" fand
es jetzt endlich auch für gut, stehen zu bleiben, aber
selbst so schlug er noch mit einer Heftigkeit um sich, die
es zu einer nicht leichten Aufgabe machte, ihm nahe
genug zu kommen, um Klariffe aufheben zu können.
Zwei Herren, in deren Gesellschaft sich eine Dame
befand, hatten Klarisse emporgerichtet und trugen sie nun
mehr, als sie sie führten, nach dem nur wenige Schritte
entfernten Baumstamm, der dem tollen Ritt ein so ver-
hängnißvolles Ziel gesetzt hatte. Obgleich man selbst an
der Stirn, mit der sie auf die Erdc geschlagen, keine
Verletzung gewahren konnte, blieb Klarisse nach wie vor
bcwußtlos.
„Sie ist nicht verletzt," sagte der ältere der beiden
Herren, „wenigstens nicht äußerlich. Aber wir müssen
sie vor allen Dingen nach einem Hause verbringen. Wer
sie nur sein mag?"
„Sollte sie Nichts bei sich haben, was über ihren
Namen und ihrc Wohnung Aufklärung geben könnte?"
fragte die Dame. „Vielleicht hicr," und sie fuhr mit der
Hand in die Tasche von Klariffens Reitkleid, in der sich
jedoch Nichts als ein Taschentuch und eine Visitenkarte
befand. Es war die Karte Bürens.
„Freiherr von Büren. Legationssekrctär," las sie.
„O," rief eincr der Umstehenden, „der Legations-
sekretär von Büren wohnt hier ganz in der Nähe!"
„So wollen wir sie dorthin bringcn," sagte der
andere, der um Klarisse beschästigten Herren. „Man
wird sie dort sicherlich aufnehmen, oder doch wenigstens
wiffen, wohin sie gehört."
Er rief einen unbesetzten Miethwagen herbei und
wies zugleich einen hinzugekommcnen Wegewärter an, das
Pferd in Obacht zu nehmen, bis man wiffen werde, wo-
hin es zu bringen sei. Hierauf hoben sic Klarisie, welche
zwyr die Augen aufgeschlagen, aber noch kein Zeichen
ihrer wiedergefundenen Sprache gegeben hatte, in den
Wagen; die Dame sctzte sich neben sie und ließ sie den
Kopf an ihrc Brnst lehnen; und so fuhren sie langsam
nach dem Hause, in welchem Büren wvhnte.
Büren war erst kurz vorher nach Hause gekommen
und stand gerade am Fcnster, als der Wagen mit der
noch immer sprachlosen und, da sie auch wieder die Augen
geschloffen hatte, anscheinend bewußtlosen Klariffe vorfuhr.
Er glaubte zuerst, seinen Augen nicht trauen zu sollen.
Dann, als er übersah, was hier geschehen war, und in
wie trauriger Weise er mit seiner Warnung Recht be-
halten hatte, ergriff ihn ein großer Schrecken. Er stürzte
zu dem Wagen hinunter, und als er hier Klarisse mit
geschloffenen Augen, das Gesicht von der Blässe des
Todes bedeckt, in den Armen der gütigen Fremden lchnen
sah, da glaubte er im ersten Augenblick wirklich, daß es
nicht cine tänschende Ohnmacht, sondern der furchtbare,
ernste Bruder derselben, der Tod selbst sei, welcher hier
ein jugendliches, leider aber seincr strotzenden Jugendkraft
nur zu sehr vertrauendes Leben gebrochen habe.
Man hatte bald Klarisse auf einem Ruhebette nieder-
gelegt, und nun hielt er Wacht an ihrer Seite und
lauschte ängstlich auf ihren Athem, bis der alte Heinrich
mit dem Arzte, nach welchem er sofort entsendet worden
war, zurückkam. Auch cine im Hause wohnende Dame
kam auf des Dieners Ersuchen herbei, die sich in echt
weiblicher, hülfreicher Weise der Verunglückten annahm,
ihr das Reitkleid lockerte und ein mit Eau de Cologne
getränktes Tuch ihr vor Nase und Mund hielt, während
Büren bemüht war, dic eisige kleine Hand, welche er
zwischen seinen Händen hielt, zu erwärmen. Endlich kam
der Arzt und untersuchte den Zustand der noch immer
nicht zum Bewußtscin Zurückgekehrten unter dem Bei-
stande der Dame, wührend Büren im Nebenzimmer in
peinlicher Erwartung auf die Entscheidung harrte. Seine
erste Absicht nach dem Eintreffen des Arztes war die
gewesen, sich sofort persönlich zu Frau von Jäger zu
verfügen, um ihr die Kunde von dem traurigen Vorfall
zu überbringen; aber er brachte es nicht über sich, das
Haus zu verlassen, in deffen Schutz sich die Fremde be-
fand, ehe er nicht selbst Gewißheit über den eigentlichen
Charakter von Klarissens Verletzung hätte. Und so wurde
Heinrich denn auch an Frau von Jäger mit der Mel-
dung des Geschehenen entsendet, während Büren in ängst-
licher Ungeduld des Augenblicks harrte, da der Arzt
wieder von der Kranken herauskommen würde.
Endlich geschah dies, und es war Nichts weniger als
ein beruhigendes Gesicht, mit dem der zu den medizini-
schen Kapazitäten der Residenz gehörende Arzt dem jungen
Diplomaten die Mittheilung machte, daß er eine äußere
Verletzung oder gar den Bruch eines Gliedes nicht kon-
statirt habe, daß er aber eine Gehirnerschüttcrung befürchte,
welche vor allcn Dingen die äußerste Ruhe für dic Patientin
nothwendig mache.
„So ist auch die Möglichkeit einer Ueberführung der
Dame nach ihrer Wohnung ausgeschlossen?" fragte nun
Büren, dem jetzt erst der Gedanke an das Absonderliche
und Peinliche der Situation kam, die ihm durch das
Verbringen der Kranken in seine Wohnung bereitet
worden war. (Fortsetzung folgt.)