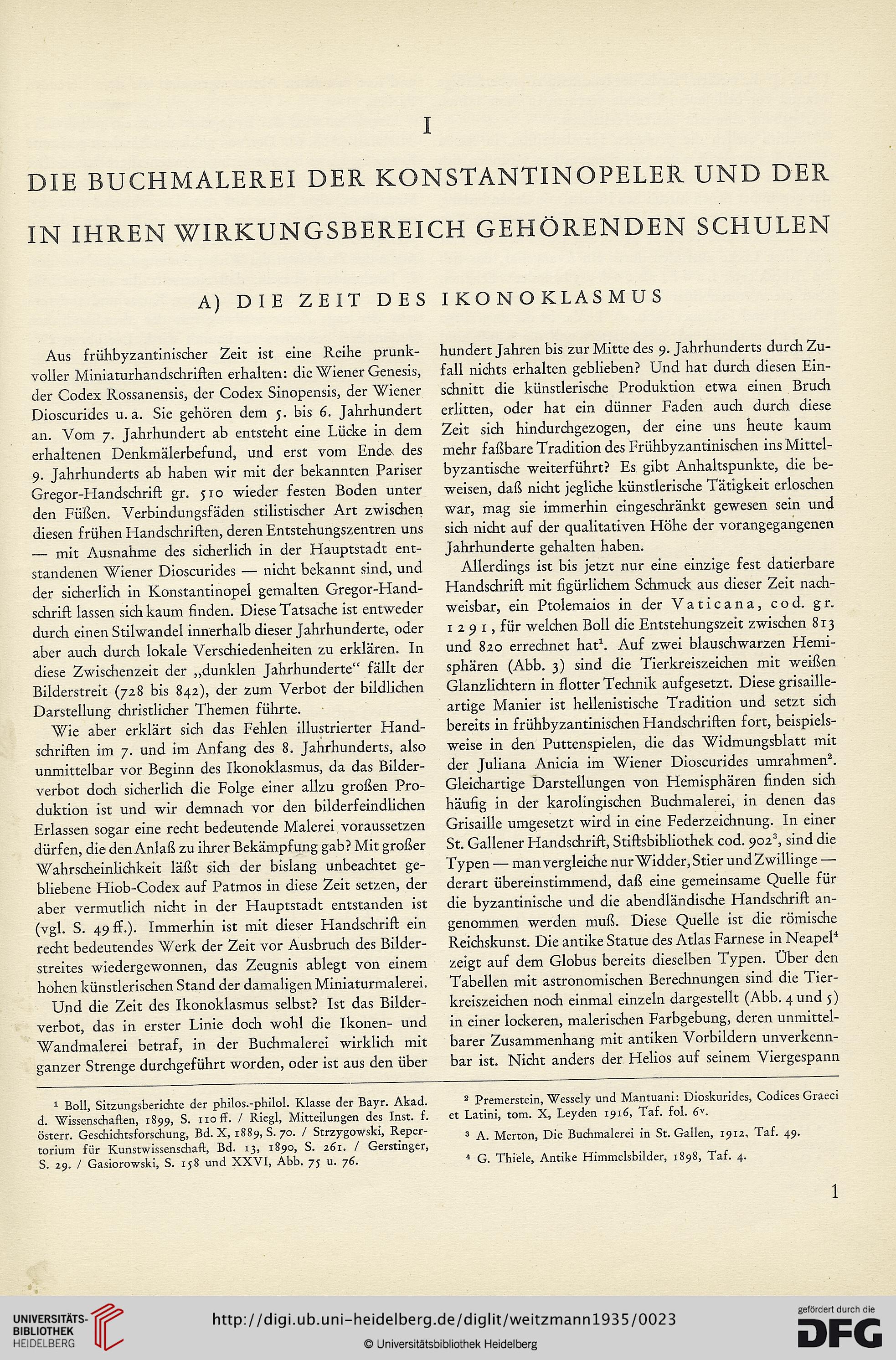I
DIE BUCHMALEREI DER KONSTANTINOPELER UND DER
IN IHREN WIRKUNGSBEREICH GEHÖRENDEN SCHULEN
A) DIE ZEIT DES IKONOKLASMUS
Aus frühbyzantinischer Zeit ist eine Reihe prunk-
voller MiniaturhandschriAen erhalten: die Wiener Genesis,
der Codex Rossanensis, der Codex Sinopensis, der Wiener
Dioscurides u. a. Sie gehören dem $. bis 6. Jahrhundert
an. Vom 7. Jahrhundert ab entsteht eine Lücke in dem
erhaltenen Denkmälerbefund, und erst vom Ende, des
9. Jahrhunderts ab haben wir mit der bekannten Pariser
Gregor-HandschriA gr. $10 wieder festen Boden unter
den Füßen. Verbindungsfäden stilistischer Art zwischen
diesen frühen HandschriAen, deren Entstehungszentren uns
— mit Ausnahme des sicherlich in der Hauptstadt ent-
standenen Wiener Dioscurides — nicht bekannt sind, und
der sicherlich in Konstantinopel gemalten Gregor-Hand-
schriA lassen sich kaum Anden. Diese Tatsache ist entweder
durch einen Stilwandel innerhalb dieser Jahrhunderte, oder
aber auch durch lokale VersAiedenheiten zu erklären. In
diese Zwischenzeit der „dunklen Jahrhunderte" fällt der
Bilderstreit (728 bis 842), der zum Verbot der bildlichen
Darstellung christlicher Themen führte.
Wie aber erklärt sich das Fehlen illustrierter Hand-
schriAen im 7. und im Anfang des 8. Jahrhunderts, also
unmittelbar vor Beginn des Ikonoklasmus, da das Bilder-
verbot doch sicherlich die Folge einer allzu großen Pro-
duktion ist und wir demnach vor den bilderfeindli&en
Erlassen sogar eine recht bedeutende Malerei voraussetzen
dürfen, die den Anlaß zu ihrer Bekämpfung gab? Mit großer
Wahrscheinlichkeit läßt sich der bislang unbeachtet ge-
bliebene Hiob-Codex auf Patmos in diese Zeit setzen, der
aber vermutlich nicht in der Hauptstadt entstanden ist
(vgl. S. 4p A.). Immerhin ist mit dieser HandschriA ein
recht bedeutendes Werk der Zeit vor Ausbruch des Bilder-
streites wiedergewonnen, das Zeugnis ablegt von einem
hohen künstlerischen Stand der damaligen Miniaturmalerei.
Und die Zeit des Ikonoklasmus selbst? Ist das Bilder-
verbot, das in erster Linie doch wohl die Ikonen- und
Wandmalerei betraf, in der BuAmalerei wirklich mit
ganzer Strenge durchgeführt worden, oder ist aus den über
* Boll, Sitzungsberichte der phüos.-phitoi. Klasse der Bayr. Akad.
d. WissensAaften, 18$$, S. noff. / Riegl, Mitteilungen des Inst. f.
österr. Ges&iAtsforschung, Bd. X, 1889,8.70. / Strzygowski, Reper-
torium für KunstwissensAaA, Bd. 13, 1890, S. 261. / Gerstinger,
S. 29. / Gasiorowski, S. i;8 und XXVI, Abb. 7; u. 76.
hundert Jahren bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts durch Zu-
fall nichts erhalten geblieben? Und hat dur& diesen Ein-
schnitt die künstlerische Produktion etwa einen BruA
erlitten, oder hat ein dünner Faden auA durA diese
Zeit sich hindurchgezogen, der eine uns heute kaum
mehr faßbare Tradition des Frühbyzantinischen ins Mittel-
byzantisAe weiterführt? Es gibt Anhaltspunkte, die be-
weisen, daß nicht jegliche künstlerisAe Tätigkeit erlosAen
war, mag sie immerhin eingeschränkt gewesen sein und
sich nicht auf der qualitativen Höhe der vorangegangenen
Jahrhunderte gehalten haben.
Allerdings ist bis jetzt nur eine einzige fest datierbare
HandsAriA mit Agürlichem Schmuck aus dieser Zeit nach-
weisbar, ein Ptolemaios in der Vaticana, cod. gr.
1291, für welchen Boll die Entstehungszeit zwisAen 813
und 820 errechnet hat*. Auf zwei blauschwarzen Hemi-
sphären (Abb. 3) sind die TierkreiszeiAen mit weißen
Glanzlichtern in Aotter Technik aufgesetzt. Diese grisaille-
artige Manier ist hellenistische Tradition und setzt sich
bereits in frühbyzantinisAen HandschriAen fort, beispiels-
weise in den Puttenspielen, die das Widmungsblatt mit
der Juliana Anicia im Wiener Dioscurides umrahmen^.
Gleichartige Darstellungen von Hemisphären Anden siA
häuAg in der karolingischen Buchmalerei, in denen das
Grisaille umgesetzt wird in eine Federzeichnung. In einer
St. Gallener HandschriA, StiAsbibiiothek cod. 902% sind die
Typen — man vergleiche nur Widder,Stier undZwillinge —
derart übereinstimmend, daß eine gemeinsame Quelle für
die byzantinische und die abendländische HandschriA an-
genommen werden muß. Diese Quelle ist die römische
Reichskunst. Die antike Statue des Atlas Farnese in Neapel*
zeigt auf dem Globus bereits dieselben Typen. Über den
Tabellen mit astronomischen BereAnungen sind die Tier-
kreiszeichen noch einmal einzeln dargestellt (Abb. 4 und 3)
in einer lockeren, malerisAen Farbgebung, deren unmittel-
barer Zusammenhang mit antiken Vorbildern unverkenn-
bar ist. Nicht anders der Helios auf seinem Viergespann
2 Premerstein, Wessely und Mantuani: Dioskurides, Codices Graeci
et Latini, tom. X, Leyden 1916, Taf. fol. 6".
A. Merton, Die Bu&maierei in St. Gaiien, 19:2, Taf. 49.
4 G. Thieie, Antike Himmeisbiider, 1898, Taf. 4.
1
DIE BUCHMALEREI DER KONSTANTINOPELER UND DER
IN IHREN WIRKUNGSBEREICH GEHÖRENDEN SCHULEN
A) DIE ZEIT DES IKONOKLASMUS
Aus frühbyzantinischer Zeit ist eine Reihe prunk-
voller MiniaturhandschriAen erhalten: die Wiener Genesis,
der Codex Rossanensis, der Codex Sinopensis, der Wiener
Dioscurides u. a. Sie gehören dem $. bis 6. Jahrhundert
an. Vom 7. Jahrhundert ab entsteht eine Lücke in dem
erhaltenen Denkmälerbefund, und erst vom Ende, des
9. Jahrhunderts ab haben wir mit der bekannten Pariser
Gregor-HandschriA gr. $10 wieder festen Boden unter
den Füßen. Verbindungsfäden stilistischer Art zwischen
diesen frühen HandschriAen, deren Entstehungszentren uns
— mit Ausnahme des sicherlich in der Hauptstadt ent-
standenen Wiener Dioscurides — nicht bekannt sind, und
der sicherlich in Konstantinopel gemalten Gregor-Hand-
schriA lassen sich kaum Anden. Diese Tatsache ist entweder
durch einen Stilwandel innerhalb dieser Jahrhunderte, oder
aber auch durch lokale VersAiedenheiten zu erklären. In
diese Zwischenzeit der „dunklen Jahrhunderte" fällt der
Bilderstreit (728 bis 842), der zum Verbot der bildlichen
Darstellung christlicher Themen führte.
Wie aber erklärt sich das Fehlen illustrierter Hand-
schriAen im 7. und im Anfang des 8. Jahrhunderts, also
unmittelbar vor Beginn des Ikonoklasmus, da das Bilder-
verbot doch sicherlich die Folge einer allzu großen Pro-
duktion ist und wir demnach vor den bilderfeindli&en
Erlassen sogar eine recht bedeutende Malerei voraussetzen
dürfen, die den Anlaß zu ihrer Bekämpfung gab? Mit großer
Wahrscheinlichkeit läßt sich der bislang unbeachtet ge-
bliebene Hiob-Codex auf Patmos in diese Zeit setzen, der
aber vermutlich nicht in der Hauptstadt entstanden ist
(vgl. S. 4p A.). Immerhin ist mit dieser HandschriA ein
recht bedeutendes Werk der Zeit vor Ausbruch des Bilder-
streites wiedergewonnen, das Zeugnis ablegt von einem
hohen künstlerischen Stand der damaligen Miniaturmalerei.
Und die Zeit des Ikonoklasmus selbst? Ist das Bilder-
verbot, das in erster Linie doch wohl die Ikonen- und
Wandmalerei betraf, in der BuAmalerei wirklich mit
ganzer Strenge durchgeführt worden, oder ist aus den über
* Boll, Sitzungsberichte der phüos.-phitoi. Klasse der Bayr. Akad.
d. WissensAaften, 18$$, S. noff. / Riegl, Mitteilungen des Inst. f.
österr. Ges&iAtsforschung, Bd. X, 1889,8.70. / Strzygowski, Reper-
torium für KunstwissensAaA, Bd. 13, 1890, S. 261. / Gerstinger,
S. 29. / Gasiorowski, S. i;8 und XXVI, Abb. 7; u. 76.
hundert Jahren bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts durch Zu-
fall nichts erhalten geblieben? Und hat dur& diesen Ein-
schnitt die künstlerische Produktion etwa einen BruA
erlitten, oder hat ein dünner Faden auA durA diese
Zeit sich hindurchgezogen, der eine uns heute kaum
mehr faßbare Tradition des Frühbyzantinischen ins Mittel-
byzantisAe weiterführt? Es gibt Anhaltspunkte, die be-
weisen, daß nicht jegliche künstlerisAe Tätigkeit erlosAen
war, mag sie immerhin eingeschränkt gewesen sein und
sich nicht auf der qualitativen Höhe der vorangegangenen
Jahrhunderte gehalten haben.
Allerdings ist bis jetzt nur eine einzige fest datierbare
HandsAriA mit Agürlichem Schmuck aus dieser Zeit nach-
weisbar, ein Ptolemaios in der Vaticana, cod. gr.
1291, für welchen Boll die Entstehungszeit zwisAen 813
und 820 errechnet hat*. Auf zwei blauschwarzen Hemi-
sphären (Abb. 3) sind die TierkreiszeiAen mit weißen
Glanzlichtern in Aotter Technik aufgesetzt. Diese grisaille-
artige Manier ist hellenistische Tradition und setzt sich
bereits in frühbyzantinisAen HandschriAen fort, beispiels-
weise in den Puttenspielen, die das Widmungsblatt mit
der Juliana Anicia im Wiener Dioscurides umrahmen^.
Gleichartige Darstellungen von Hemisphären Anden siA
häuAg in der karolingischen Buchmalerei, in denen das
Grisaille umgesetzt wird in eine Federzeichnung. In einer
St. Gallener HandschriA, StiAsbibiiothek cod. 902% sind die
Typen — man vergleiche nur Widder,Stier undZwillinge —
derart übereinstimmend, daß eine gemeinsame Quelle für
die byzantinische und die abendländische HandschriA an-
genommen werden muß. Diese Quelle ist die römische
Reichskunst. Die antike Statue des Atlas Farnese in Neapel*
zeigt auf dem Globus bereits dieselben Typen. Über den
Tabellen mit astronomischen BereAnungen sind die Tier-
kreiszeichen noch einmal einzeln dargestellt (Abb. 4 und 3)
in einer lockeren, malerisAen Farbgebung, deren unmittel-
barer Zusammenhang mit antiken Vorbildern unverkenn-
bar ist. Nicht anders der Helios auf seinem Viergespann
2 Premerstein, Wessely und Mantuani: Dioskurides, Codices Graeci
et Latini, tom. X, Leyden 1916, Taf. fol. 6".
A. Merton, Die Bu&maierei in St. Gaiien, 19:2, Taf. 49.
4 G. Thieie, Antike Himmeisbiider, 1898, Taf. 4.
1