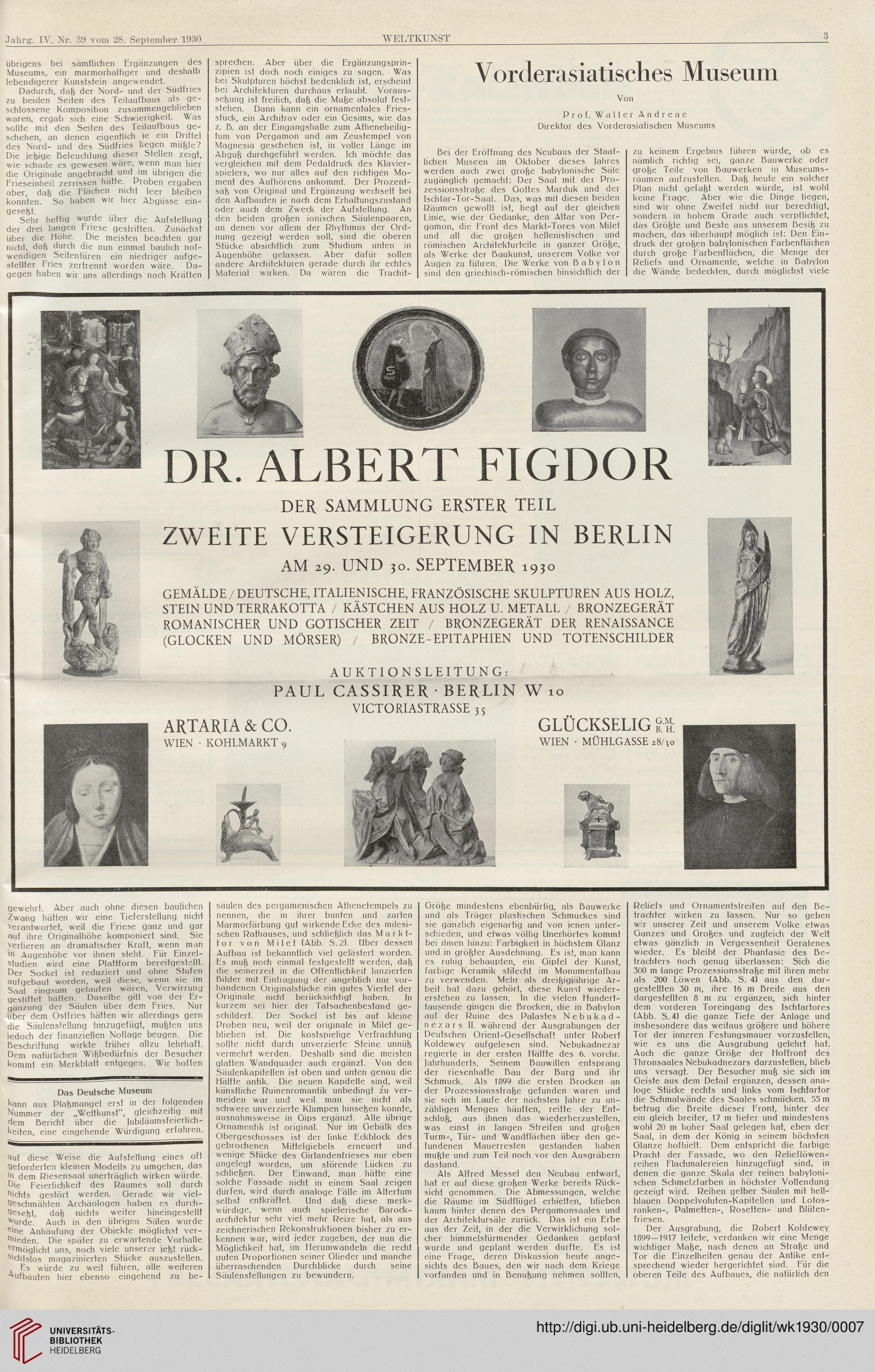Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930
WELTKUNST
3
Vorderasiatisches Museum
Von
Prof. Walter Andreae
Direktor des Vorderasiatischen Museums
übrigens bei sämtlichen Ergänzungen des
Museums, ein marmorhaltiger und deshalb
lebendigerer Kunststein angewendet.
Dadurch, daß der Nord- und der Südfries
zu beiden Seiten des Teilaufbaus als ge-
schlossene Komposition zusammengeblieben
waren, ergab sich eine Schwierigkeit. Was
sollte mit den Seiten des Teilaufbaus ge-
schehen, an denen eigentlich je ein Drittel
des Nord- und des Südfries liegen müßte?
Die jefeige Beleuchtung dieser Stellen zeigt,
wie schade es gewesen wäre, wenn man hier
die Originale angebracht und im übrigen die
Frieseinheil zerrissen hätte. Proben ergaben
aber, dalj die Flächen nicht leer bleiben
konnten. So haben wir hier Abgüsse ein-
gesefet.
Sehr heftig wurde über die Aufstellung
der drei langen Friese gestritten. Zunächst
über die Höhe. Die meisten beachten gar
nicht, daß durch die nun einmal baulich not-
wendigen Seifenfüren ein niedriger aufge-
siellter Fries zertrennt worden wäre. Da-
gegen haben wir uns allerdings nach Kräften
sprechen. Aber über die Ergänzungsprin-
zipien isi doch noch einiges zu sagen. Was
bei Skulpturen höchst bedenklich ist, erscheint
bei Architekturen durchaus erlaubt. Veräus-
serung ist freilich, daß die Mage absolut fest-
stehen. Dann kann ein ornamentales Fries-
stück, ein Architrav oder ein Gesims, wie das
z. B. an der Eingangshalle zum Atheneheilig-
tum von Pergamon und am Zeusfempel von
Magnesia geschehen ist, in voller Länge im
Abguß durchgeführt werden. Ich möchte das
vergleichen mit dem Pedaldruck des Klavier-
spielers, wo nur alles auf den richtigen Mo-
ment des Aufhörens ankommt. Der Prozent-
safe von Original und Ergänzung wechselt bei
den Aufbauten je nach dem Erhaltungszustand
oder auch dem Zweck der Aufstellung. An
den beiden großen ionischen Säulenpaaren,
an denen vor allem der Rhythmus der Ord-
nung gezeigt werden soll, sind die oberen
Stücke absichtlich zum Studium unten in
Augenhöhe gelassen. Aber dafür sollen
andere Architekturen gerade durch ihr echtes
Material wirken. Da wären die Trachit-
Bei der Eröffnung des Neubaus der Staat-
lichen Museen im Oktober dieses Jahres
werden auch zwei große babylonische Säle
zugänglich gemacht: Der Saal mit der Pro-
zessionssiraße des Gottes Marduk und der
Ischiar-Tor-Saal. Das, was mit diesen beiden
Räumen gewollt ist, liegt auf der gleichen
Linie, wie der Gedanke, den Altar von Per-
gamon, die Front des Markt-Tores von Milet
und all die großen hellenistischen und
römischen Architekiurteile in ganzer Größe,
als Werke der Baukunst, unserem Volke vor
Augen zu führen. Die Werke von Babylon
sind den griechisch-römischen hinsichtlich der
zu keinem Ergebnis führen würde, ob es
nämlich richtig sei, ganze Bauwerke oder
große Teile von Bauwerken in Museums-
räumen aufzustellen. Daß heute ein solcher
Plan nicht gefaßt werden würde, ist wohl
keine Frage. Aber wie die Dinge liegen,
sind wir ohne Zweifel nicht nur berechtigt,
sondern in hohem Grade auch verpflichtet,
das Größte und Beste aus unserem Besife zu
machen, das überhaupt möglich ist: Den Ein-
druck der großen babylonischen Farbenflächen
durch große Farbenflächen, die Menge der
Reliefs und Ornamente, welche in Babylon
die Wände bedeckten, durch möglichst viele
DR. ALBERT FIGDOR
DER SAMMLUNG ERSTER TEIL
ZWEITE VERSTEIGERUNG IN BERLIN
AM 29. UND 30. SEPTEMBER 1930
GEMÄLDE/DEUTSCHE, ITALIENISCHE, FRANZÖSISCHE SKULPTUREN AUS HOLZ,
STEIN UND TERRAKOTTA / KÄSTCHEN AUS HOLZ U. METALL / BRONZEGERÄT
ROMANISCHER UND GOTISCHER ZEIT / BRONZEGERÄT DER RENAISSANCE
(GLOCKEN UND MÖRSER) / BRONZE-EPITAPHIEN UND TOTENSCHILDER
AUKTIONSLEITUNG:
PAUL CASSIRER • BERLIN W 10
ARTARIA & CO.
WIEN - KOHLMARKT 9
VICTORIASTRASSE 3S
GLÜCKSELIG £$
WIEN ■ MÜHLGASSE 28/50
gewehrt. Aber auch ohne diesen baulichen
Zwang hätten wir eine Tieferstellung nicht
Verantwortet, weil die Friese ganz und gar
auf ihre Originalhöhe komponiert sind. Sie
verlieren an dramatischer Kraft, wenn man
'n Augenhöhe vor ihnen steht. Für Einzel-
studien wind eine Plattform bereitgestellt.
Der Sockel ist reduziert und ohne Stufen
auf gebaut worden, weil diese, wenn sie im
Saal ringsum gelaufen wären, Verwirrung
gestiftet hätten. Daselbe gilt von der Er-
gänzung der Säulen über dem Fries. Nur
über dem Ostfries hätten wir allerdings gern
die Säulenstellung hinzugefügt, mußten uns
jedoch der finanziellen Notlage beugen. Die
Beschriftung wirkte früher allzu lehrhaft.
Dem natürlichen Wißbedürfnis der Besucher
kommt ein Merkblatt entgegen. Wir hoffen
Das Deutsche Museum
kann aus Plafemangel erst in der folgenden
Nummer der „Weltkunst", gleichzeitig mit
dem Bericht über die Jubiläumsfeierlich-
keiten, eine eingehende Würdigung erfahren.
auf diese Weise die Aufstellung eines oft
geforderten kleinen Modells zu umgehen, das
'n dem Riesensaal unerträglich wirken würde.
Die Feierlichkeit des Raumes soll durch
nichts gestört werden. Gerade wir viel-
Qeschmähten Archäologen haben es durch-
Üesefet, daß nichts weiter hineingesfellt
'V'Urde. Auch in den übrigen Sälen wurde
e*ne Anhäufung der Objekte möglichst ver-
mieden. Die später zu erwartende Vorhalle
ermöglicht uns, noch viele unserer jefet rück-
sichtslos magazinierten Stücke auszustellen.
Es würde zu weit führen, alle weiteren
Aufbauten hier ebenso eingehend zu be-
säulen des pergamenischen Athenetempels zu
nennen, die in ihrer bunten und zarten
Marmorfärbung gut wirkende Ecke des milesi-
schen Rathauses, und schließlich das Markt-
tor von Milet (Abb. S.2), über dessen
Aufbau ist bekanntlich viel gelästert worden.
Es muß noch einmal festgestellt werden, daß
die seinerzeit in die Öffentlichkeit lanzierten
Bilder mit Eintragung der angeblich nur vor-
handenen Originalstücke ein gutes Viertel der
Originale nicht berücksichtigt haben. In
kurzem sei hier der Tatsachenbestand ge-
schildert. Der Sockel ist bis auf kleine
Proben neu, weil der originale in Milet ge-
blieben ist. Die kostspielige Verfrachtung
sollte nicht durch unverzierte Steine unnüfe
vermehrt werden. Deshalb sind die meisten
glatten Wandquader auch ergänzt. Von den
Säulenkapitellen ist oben und unten genau die
Hälfte antik. Die neuen Kapitelle sind, weil
künstliche Ruinenromantik unbedingt zu ver-
meiden war und weil man sie nicht als
schwere unverzierte Klumpen hinsefeen konnte,
ausnahmsweise in Gips ergänzt. Alle übrige
Ornamentik ist original. Nur im Gebälk des
Obergeschosses ist der linke Eckblock des
gebrochenen Mittelgiebels erneuert und
wenige Stücke des Girlandenfrieses nur eben
angelegt worden, um störende Lücken zu
schließen. Der Einwand, man hätte eine
solche Fassade nicht in einem Saal zeigen
dürfen, wird durch analoge Fälle im Altertum
selbst entkräftet. Und daß diese merk-
würdige, wenn auch spielerische Barock-
architektur sehr viel mehr Reize hat, als aus
zeichnerischen Rekonstruktionen bisher zu er-
kennen war, wird jeder zugeben, der nun die
Möglichkeit hat, im Herumwandeln die recht
guten Proportionen seiner Glieder und manche
überraschenden Durchblicke durch seine
Säulenstellungen zu bewundern.
Größe mindestens ebenbürtig, als Bauwerke
und als Träger plastischen Schmuckes sind
sie gänzlich eigenartig und von jenen unter-
schieden, und etwas völlig Unerhörtes kommt
bei ihnen hinzu: Farbigkeit in höchstem Glanz
und in größter Ausdehnung. Es ist, man kann
es ruhig behaupten, ein Gipfel der Kunst,
farbige Keramik stilecht im Monumentalbau
zu verwenden. Mehr als dreißigjährige Ar-
beit hat dazu gehört, diese Kunst wieder-
erstehen zu lassen. In die vielen Hundert-
tausende gingen die Brocken, die in Babylon
auf der Ruine des Palastes N e b u k a d -
n e z a r s II. während der Ausgrabungen der
Deutschen Orient-Gesellschaft unter Robert
Koldewey aufgelesen sind. Nebukadnezar
regierte in der ersten Hälfte des 6. vorchr.
Jahrhunderts. Seinem Bauwillen entsprang
der riesenhafte Bau der Burg und ihr
Schmuck. Als 1899 die ersten Brocken an
der Prozessionsstraße gefunden waren und
sie sich im Laufe der nächsten Jahre zu un-
zähligen Mengen häuften, reifte der Ent-
schluß, aus ihnen das wiederherzustellen,
was einst in langen Streifen und großen
Turm-, Tür- und Wandflächen über den ge-
fundenen Mauerresten gestanden haben
mußte und zum Teil noch vor den Ausgräbern
dastand.
Als Alfred Messel den Neubau entwarf,
hat er auf diese großen Werke bereits Rück-
sicht genommen. Die Abmessungen, welche
die Räume im Südflügel erhielten, blieben
kaum hinter denen des Pergamonsaales und
der Architekiursäle zurück. Das ist ein Erbe
aus der Zeit, in der die Verwirklichung sol-
cher himmelstürmender Gedanken geplant
wurde und geplant werden durfte. Es ist
eine Frage, deren Diskussion heute ange-
sichts des Baues, den wir nach dem Kriege
vorfanden und in Benufeung nehmen sollten.
Reliefs und Ornamentstreifen auf den Be-
trachter wirken zu lassen. Nur so geben
wir unserer Zeit und unserem Volke etwas
Ganzes und Großes und zugleich der Welt
etwas gänzlich in Vergessenheit Geratenes
wieder. Es bleibt der Phantasie des Be-
trachters noch genug überlassen: Sich die
300 m lange Prozessionssiraße mit ihren mehr
als 200 Löwen (Abb. S. 4) aus den dar-
gestellfcn 30 m, ihre 16 m Breite aus den
dargestellten 8 m zu ergänzen, sich hinter
dem vorderen Toreingang des Ischtartores
(Abb. S. 4) die ganze Tiefe der Anlage und
insbesondere das weitaus größere und höhere
Tor der inneren Festungsmauer vorzustellen,
wie es uns die Ausgrabung gelehrt hat.
Auch die ganze Größe der Hoffront des
Thronsaales Nebukadnezars darzustellen, blieb
uns versagt. Der Besucher muß sie sich im
Geiste aus dem Detail ergänzen, dessen ana-
loge Stücke rechts und links vom Ischtartor
die Schmalwände des Saales schmücken. 55 m
betrug die Breite dieser Front, hinter der
ein gleich breiter, 17 m tiefer und mindestens
wohl 20 m hoher Saal gelegen hat, eben der
Saal, in dem der König in seinem höchsten
Glanze hofhielt. Dem entspricht die farbige
Pracht der Fassade, wo den Relieflöwen-
reihen Flachmalereien hinzugefügt sind, in
denen die ganze Skala der reinen babyloni-
schen Schmelzfarben in höchster Vollendung
gezeigt wird. Reihen gelber Säulen mit hell-
blauen Doppelvoluten-Kapitellen und Lotos-
ranken-, Palmetten-, Rosetten- und Blüten-
friesen.
Der Ausgrabung, die Robert Koldewey
1899—1917 leitete, verdanken wir eine Menge
wichtiger Maße, nach denen an Straße und
Tor die Einzelheiten genau der Antike ent-
sprechend wieder hergerichtet sind. Für die
oberen Teile des Aufbaues, die natürlich den
WELTKUNST
3
Vorderasiatisches Museum
Von
Prof. Walter Andreae
Direktor des Vorderasiatischen Museums
übrigens bei sämtlichen Ergänzungen des
Museums, ein marmorhaltiger und deshalb
lebendigerer Kunststein angewendet.
Dadurch, daß der Nord- und der Südfries
zu beiden Seiten des Teilaufbaus als ge-
schlossene Komposition zusammengeblieben
waren, ergab sich eine Schwierigkeit. Was
sollte mit den Seiten des Teilaufbaus ge-
schehen, an denen eigentlich je ein Drittel
des Nord- und des Südfries liegen müßte?
Die jefeige Beleuchtung dieser Stellen zeigt,
wie schade es gewesen wäre, wenn man hier
die Originale angebracht und im übrigen die
Frieseinheil zerrissen hätte. Proben ergaben
aber, dalj die Flächen nicht leer bleiben
konnten. So haben wir hier Abgüsse ein-
gesefet.
Sehr heftig wurde über die Aufstellung
der drei langen Friese gestritten. Zunächst
über die Höhe. Die meisten beachten gar
nicht, daß durch die nun einmal baulich not-
wendigen Seifenfüren ein niedriger aufge-
siellter Fries zertrennt worden wäre. Da-
gegen haben wir uns allerdings nach Kräften
sprechen. Aber über die Ergänzungsprin-
zipien isi doch noch einiges zu sagen. Was
bei Skulpturen höchst bedenklich ist, erscheint
bei Architekturen durchaus erlaubt. Veräus-
serung ist freilich, daß die Mage absolut fest-
stehen. Dann kann ein ornamentales Fries-
stück, ein Architrav oder ein Gesims, wie das
z. B. an der Eingangshalle zum Atheneheilig-
tum von Pergamon und am Zeusfempel von
Magnesia geschehen ist, in voller Länge im
Abguß durchgeführt werden. Ich möchte das
vergleichen mit dem Pedaldruck des Klavier-
spielers, wo nur alles auf den richtigen Mo-
ment des Aufhörens ankommt. Der Prozent-
safe von Original und Ergänzung wechselt bei
den Aufbauten je nach dem Erhaltungszustand
oder auch dem Zweck der Aufstellung. An
den beiden großen ionischen Säulenpaaren,
an denen vor allem der Rhythmus der Ord-
nung gezeigt werden soll, sind die oberen
Stücke absichtlich zum Studium unten in
Augenhöhe gelassen. Aber dafür sollen
andere Architekturen gerade durch ihr echtes
Material wirken. Da wären die Trachit-
Bei der Eröffnung des Neubaus der Staat-
lichen Museen im Oktober dieses Jahres
werden auch zwei große babylonische Säle
zugänglich gemacht: Der Saal mit der Pro-
zessionssiraße des Gottes Marduk und der
Ischiar-Tor-Saal. Das, was mit diesen beiden
Räumen gewollt ist, liegt auf der gleichen
Linie, wie der Gedanke, den Altar von Per-
gamon, die Front des Markt-Tores von Milet
und all die großen hellenistischen und
römischen Architekiurteile in ganzer Größe,
als Werke der Baukunst, unserem Volke vor
Augen zu führen. Die Werke von Babylon
sind den griechisch-römischen hinsichtlich der
zu keinem Ergebnis führen würde, ob es
nämlich richtig sei, ganze Bauwerke oder
große Teile von Bauwerken in Museums-
räumen aufzustellen. Daß heute ein solcher
Plan nicht gefaßt werden würde, ist wohl
keine Frage. Aber wie die Dinge liegen,
sind wir ohne Zweifel nicht nur berechtigt,
sondern in hohem Grade auch verpflichtet,
das Größte und Beste aus unserem Besife zu
machen, das überhaupt möglich ist: Den Ein-
druck der großen babylonischen Farbenflächen
durch große Farbenflächen, die Menge der
Reliefs und Ornamente, welche in Babylon
die Wände bedeckten, durch möglichst viele
DR. ALBERT FIGDOR
DER SAMMLUNG ERSTER TEIL
ZWEITE VERSTEIGERUNG IN BERLIN
AM 29. UND 30. SEPTEMBER 1930
GEMÄLDE/DEUTSCHE, ITALIENISCHE, FRANZÖSISCHE SKULPTUREN AUS HOLZ,
STEIN UND TERRAKOTTA / KÄSTCHEN AUS HOLZ U. METALL / BRONZEGERÄT
ROMANISCHER UND GOTISCHER ZEIT / BRONZEGERÄT DER RENAISSANCE
(GLOCKEN UND MÖRSER) / BRONZE-EPITAPHIEN UND TOTENSCHILDER
AUKTIONSLEITUNG:
PAUL CASSIRER • BERLIN W 10
ARTARIA & CO.
WIEN - KOHLMARKT 9
VICTORIASTRASSE 3S
GLÜCKSELIG £$
WIEN ■ MÜHLGASSE 28/50
gewehrt. Aber auch ohne diesen baulichen
Zwang hätten wir eine Tieferstellung nicht
Verantwortet, weil die Friese ganz und gar
auf ihre Originalhöhe komponiert sind. Sie
verlieren an dramatischer Kraft, wenn man
'n Augenhöhe vor ihnen steht. Für Einzel-
studien wind eine Plattform bereitgestellt.
Der Sockel ist reduziert und ohne Stufen
auf gebaut worden, weil diese, wenn sie im
Saal ringsum gelaufen wären, Verwirrung
gestiftet hätten. Daselbe gilt von der Er-
gänzung der Säulen über dem Fries. Nur
über dem Ostfries hätten wir allerdings gern
die Säulenstellung hinzugefügt, mußten uns
jedoch der finanziellen Notlage beugen. Die
Beschriftung wirkte früher allzu lehrhaft.
Dem natürlichen Wißbedürfnis der Besucher
kommt ein Merkblatt entgegen. Wir hoffen
Das Deutsche Museum
kann aus Plafemangel erst in der folgenden
Nummer der „Weltkunst", gleichzeitig mit
dem Bericht über die Jubiläumsfeierlich-
keiten, eine eingehende Würdigung erfahren.
auf diese Weise die Aufstellung eines oft
geforderten kleinen Modells zu umgehen, das
'n dem Riesensaal unerträglich wirken würde.
Die Feierlichkeit des Raumes soll durch
nichts gestört werden. Gerade wir viel-
Qeschmähten Archäologen haben es durch-
Üesefet, daß nichts weiter hineingesfellt
'V'Urde. Auch in den übrigen Sälen wurde
e*ne Anhäufung der Objekte möglichst ver-
mieden. Die später zu erwartende Vorhalle
ermöglicht uns, noch viele unserer jefet rück-
sichtslos magazinierten Stücke auszustellen.
Es würde zu weit führen, alle weiteren
Aufbauten hier ebenso eingehend zu be-
säulen des pergamenischen Athenetempels zu
nennen, die in ihrer bunten und zarten
Marmorfärbung gut wirkende Ecke des milesi-
schen Rathauses, und schließlich das Markt-
tor von Milet (Abb. S.2), über dessen
Aufbau ist bekanntlich viel gelästert worden.
Es muß noch einmal festgestellt werden, daß
die seinerzeit in die Öffentlichkeit lanzierten
Bilder mit Eintragung der angeblich nur vor-
handenen Originalstücke ein gutes Viertel der
Originale nicht berücksichtigt haben. In
kurzem sei hier der Tatsachenbestand ge-
schildert. Der Sockel ist bis auf kleine
Proben neu, weil der originale in Milet ge-
blieben ist. Die kostspielige Verfrachtung
sollte nicht durch unverzierte Steine unnüfe
vermehrt werden. Deshalb sind die meisten
glatten Wandquader auch ergänzt. Von den
Säulenkapitellen ist oben und unten genau die
Hälfte antik. Die neuen Kapitelle sind, weil
künstliche Ruinenromantik unbedingt zu ver-
meiden war und weil man sie nicht als
schwere unverzierte Klumpen hinsefeen konnte,
ausnahmsweise in Gips ergänzt. Alle übrige
Ornamentik ist original. Nur im Gebälk des
Obergeschosses ist der linke Eckblock des
gebrochenen Mittelgiebels erneuert und
wenige Stücke des Girlandenfrieses nur eben
angelegt worden, um störende Lücken zu
schließen. Der Einwand, man hätte eine
solche Fassade nicht in einem Saal zeigen
dürfen, wird durch analoge Fälle im Altertum
selbst entkräftet. Und daß diese merk-
würdige, wenn auch spielerische Barock-
architektur sehr viel mehr Reize hat, als aus
zeichnerischen Rekonstruktionen bisher zu er-
kennen war, wird jeder zugeben, der nun die
Möglichkeit hat, im Herumwandeln die recht
guten Proportionen seiner Glieder und manche
überraschenden Durchblicke durch seine
Säulenstellungen zu bewundern.
Größe mindestens ebenbürtig, als Bauwerke
und als Träger plastischen Schmuckes sind
sie gänzlich eigenartig und von jenen unter-
schieden, und etwas völlig Unerhörtes kommt
bei ihnen hinzu: Farbigkeit in höchstem Glanz
und in größter Ausdehnung. Es ist, man kann
es ruhig behaupten, ein Gipfel der Kunst,
farbige Keramik stilecht im Monumentalbau
zu verwenden. Mehr als dreißigjährige Ar-
beit hat dazu gehört, diese Kunst wieder-
erstehen zu lassen. In die vielen Hundert-
tausende gingen die Brocken, die in Babylon
auf der Ruine des Palastes N e b u k a d -
n e z a r s II. während der Ausgrabungen der
Deutschen Orient-Gesellschaft unter Robert
Koldewey aufgelesen sind. Nebukadnezar
regierte in der ersten Hälfte des 6. vorchr.
Jahrhunderts. Seinem Bauwillen entsprang
der riesenhafte Bau der Burg und ihr
Schmuck. Als 1899 die ersten Brocken an
der Prozessionsstraße gefunden waren und
sie sich im Laufe der nächsten Jahre zu un-
zähligen Mengen häuften, reifte der Ent-
schluß, aus ihnen das wiederherzustellen,
was einst in langen Streifen und großen
Turm-, Tür- und Wandflächen über den ge-
fundenen Mauerresten gestanden haben
mußte und zum Teil noch vor den Ausgräbern
dastand.
Als Alfred Messel den Neubau entwarf,
hat er auf diese großen Werke bereits Rück-
sicht genommen. Die Abmessungen, welche
die Räume im Südflügel erhielten, blieben
kaum hinter denen des Pergamonsaales und
der Architekiursäle zurück. Das ist ein Erbe
aus der Zeit, in der die Verwirklichung sol-
cher himmelstürmender Gedanken geplant
wurde und geplant werden durfte. Es ist
eine Frage, deren Diskussion heute ange-
sichts des Baues, den wir nach dem Kriege
vorfanden und in Benufeung nehmen sollten.
Reliefs und Ornamentstreifen auf den Be-
trachter wirken zu lassen. Nur so geben
wir unserer Zeit und unserem Volke etwas
Ganzes und Großes und zugleich der Welt
etwas gänzlich in Vergessenheit Geratenes
wieder. Es bleibt der Phantasie des Be-
trachters noch genug überlassen: Sich die
300 m lange Prozessionssiraße mit ihren mehr
als 200 Löwen (Abb. S. 4) aus den dar-
gestellfcn 30 m, ihre 16 m Breite aus den
dargestellten 8 m zu ergänzen, sich hinter
dem vorderen Toreingang des Ischtartores
(Abb. S. 4) die ganze Tiefe der Anlage und
insbesondere das weitaus größere und höhere
Tor der inneren Festungsmauer vorzustellen,
wie es uns die Ausgrabung gelehrt hat.
Auch die ganze Größe der Hoffront des
Thronsaales Nebukadnezars darzustellen, blieb
uns versagt. Der Besucher muß sie sich im
Geiste aus dem Detail ergänzen, dessen ana-
loge Stücke rechts und links vom Ischtartor
die Schmalwände des Saales schmücken. 55 m
betrug die Breite dieser Front, hinter der
ein gleich breiter, 17 m tiefer und mindestens
wohl 20 m hoher Saal gelegen hat, eben der
Saal, in dem der König in seinem höchsten
Glanze hofhielt. Dem entspricht die farbige
Pracht der Fassade, wo den Relieflöwen-
reihen Flachmalereien hinzugefügt sind, in
denen die ganze Skala der reinen babyloni-
schen Schmelzfarben in höchster Vollendung
gezeigt wird. Reihen gelber Säulen mit hell-
blauen Doppelvoluten-Kapitellen und Lotos-
ranken-, Palmetten-, Rosetten- und Blüten-
friesen.
Der Ausgrabung, die Robert Koldewey
1899—1917 leitete, verdanken wir eine Menge
wichtiger Maße, nach denen an Straße und
Tor die Einzelheiten genau der Antike ent-
sprechend wieder hergerichtet sind. Für die
oberen Teile des Aufbaues, die natürlich den