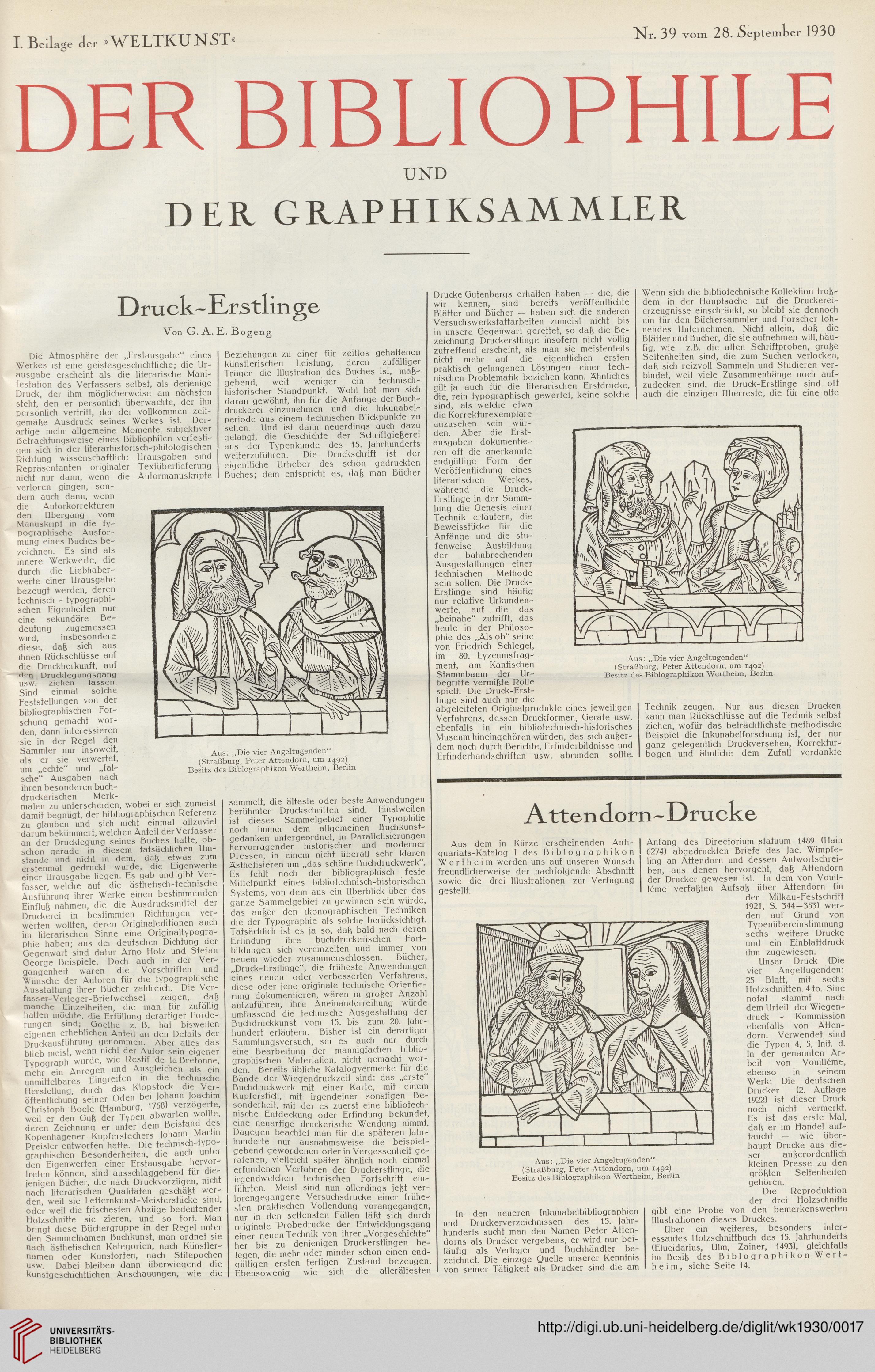I. Beilage Jer • WELTKU NST« Nr. 39 vom 28. September 1930
DER BIBLIOPHILE
UND
DER GRAPHIKSAMMLER
Druck- Ers tim ge
Von G. A.E. Bogeng
Die Atmosphäre der „Erstausgabe" eines
Werkes ist eine geistesgeschichtliche; die Ur-
ausgabe erscheint als die literarische Mani-
festation des Verfassers selbst, als derjenige
Druck, der ihm möglicherweise am nächsten
steht, den er persönlich überwachte, der ihn
persönlich vertritt, der der vollkommen zeit-
gemäße Ausdruck seines Werkes ist. Der-
artige mehr allgemeine Momente subjektiver
Betrachtungsweise eines Bibliophilen verfesti-
gen sich in der literarhistorisch-philologischen
Richtung wissenschaftlich: Urausgaben sind
Repräsentanten originaler Textüberlieferung
nicht nur dann, wenn die Autormanuskripte
verloren gingen, son-
dern auch dann, wenn
die Autorkorrekturen
den Übergang vom
Manuskript in die ty-
pographische Ausfor-
mung eines Buches be-
zeichnen. Es sind als
innere Werkwerte, die
durch die Liebhaber-
werte einer Urausgabe
bezeugt werden, deren
technisch - typographi-
schen Eigenheiten nur
eine sekundäre Be-
deutung zugemessen
wird, insbesondere
diese, daß sich aus
ihnen Rückschlüsse auf
die Druckherkunft, auf
den Drucklegungsgang
usw. ziehen lassen.
Sind einmal solche
Feststellungen von der
bibliographischen For-
schung gemacht wor-
den, dann interessieren
sie in der Regel den
Sammler nur insoweit,
als er sie verwertet,
um „echte“ und „fal-
sche“ Ausgaben nach
ihren besonderen buch-
druckerischen Merk-
malen zu unterscheiden, wobei er sich zumeist
damit begnügt, der bibliographischen Referenz
zu glauben und sich nicht einmal allzuviel
darum bekümmert, welchen Anteil der Verfasser
an der Drucklegung seines Buches hatte, ob-
schon gerade in diesem tatsächlichen Um-
stande und nicht in dem, daß etwas zum
erstenmal gedruckt wurde, die Eigenwerte
einer Urausgabe liegen. Es gab und gibt Ver-
fasser, welche auf die ästhetisch-technische
Ausführung ihrer Werke einen bestimmenden
Einfluß nahmen, die die Ausdrucksmittel der
Druckerei in bestimmten Richtungen ver-
werten wollten, deren Originaleditionen auch
im literarischen Sinne eine Originaltypogra-
phie haben; aus der deutschen Dichtung der
Gegenwart sind dafür Arno Holz und Stefan
George Beispiele. Doch auch in der Ver-
gangenheit waren die Vorschriften und
Wünsche der Autoren für die typographische
Ausstattung ihrer Bücher zahlreich. Die Ver-
fasser-Verleger-Briefwechsel zeigen, daß
manche Einzelheiten, die man für zufällig
halten möchte, die Erfüllung derartiger Forde-
rungen sind; Goethe z. B. hat bisweilen
eigenen erheblichen Anteil an den Details der
Druckausführung genommen. Aber alles das
blieb meist, wenn nicht der Autor sein eigener
Typograph wurde, wie Restif de la Bretonne,
mehr ein Anregen und Ausgleichen als ein
unmittelbares Eingreifen in die technische
Herstellung, durch das Klopstock die Ver-
öffentlichung seiner Oden bei Johann Joachim
Christoph Bocle (Hamburg, 1768) verzögerte,
weil er den Guß der Typen abwarten wollte,
deren Zeichnung er unter dem Beistand des
Kopenhagener Kupferstechers Johann Martin
Preisler entworfen hatte. Die technisch-typo-
graphischen Besonderheiten, die auch unter
den Eigenwerten einer Erstausgabe hervor-
treten können, sind ausschlaggebend für die-
jenigen Bücher, die nach Druckvorzügen, nicht
nach literarischen Qualitäten geschäht wer-
den, weil sie Letternkunst-Meisterstücke sind,
oder weil die frischesten Abzüge bedeutender
Holzschnitte sie zieren, und so fort. Man
bringt diese Büchergruppe in der Regel unter
den Sammelnamen Buchkunst, man ordnet sie
nach ästhetischen Kategorien, nach Künstler-
namen oder Kunstarten, nach Stilepochen
usw. Dabei bleiben dann überwiegend die
kunstgeschichtlichen Anschauungen, wie die
Beziehungen zu einer für zeitlos gehaltenen
künstlerischen Leistung, deren zufälliger
Träger die Illustration des Buches ist, maß-
gebend, weit weniger ein technisch-
historischer Standpunkt. Wohl hat man sich
daran gewöhnt, ihn für die Anfänge der Buch-
druckerei einzunehmen und die Inkunabel-
periode aus einem technischen Blickpunkte zu
sehen. Und ist dann neuerdings auch dazu
gelangt, die Geschichte der Schriftgießerei
aus der Typenkunde des 15. Jahrhunderts
weiterzuführen. Die Druckschrift ist der
eigentliche Urheber des schön gedruckten
Buches; dem entspricht es, daß man Bücher
sammelt, die älteste oder beste Anwendungen
berühmter Druckschriften sind. Einstweilen
ist dieses Sammelgebiet einer Typophilie
noch immer dem allgemeinen Buchkunst-
gedanken untergeordnet, in Parallelisierungen
hervorragender historischer und moderner
Pressen, in einem nicht überall sehr klaren
Ästhetisieren um „das schöne Buchdruckwerk“.
Es fehlt noch der bibliographisch feste
Mittelpunkt eines bibliotechnisch-historischen
Systems, von dem aus ein Überblick über das
ganze Sammelgebiet zu gewinnen sein würde,
das außer den ikonographischen Techniken
die der Typographie als solche berücksichtigt.
Tatsächlich ist es ja so, daß bald nach deren
Erfindung ihre buchdruckerischen Fort-
bildungen sich vereinzelten und immer von
neuem wieder zusammenschlossen. Bücher,
„Druck-Erstlinge“, die früheste Anwendungen
eines neuen oder verbesserten Verfahrens,
diese oder jene originale technische Orientie-
rung dokumentieren, wären in großer Anzahl
aufzuführen, ihre Aneinanderreihung würde
umfassend die technische Ausgestaltung der
Buchdruckkunst vom 15. bis zum 20. Jahr-
hundert erläutern. Bisher ist ein derartiger
Sammlungsversuch, sei es auch nur durch
eine Bearbeitung der mannigfachen biblio-
graphischen Materialien, nicht gemacht wor-
den. Bereits übliche Katalogvermerke für die
Bände der Wiegendruckzeit sind: das „erste“
Buchdruckwerk mit einer Karte, mit einem
Kupferstich, mit irgendeiner sonstigen Be-
sonderheit, mit der es zuerst eine bibliotech-
nische Entdeckung oder Erfindung bekundet,
eine neuartige druckerische Wendung nimmt.
Dagegen beachtet man für die späteren Jahr-
hunderte nur ausnahmsweise die beispiel-
gebend gewordenen oder in Vergessenheit ge-
ratenen, vielleicht später ähnlich noch einmal
erfundenen Verfahren der Druckerstlinge, die
irgendwelchen technischen Fortschritt ein-
führten. Meist sind nun allerdings jeßt ver-
lorengegangene Versuchsdrucke einer frühe-
sten praktischen Vollendung vorangegangen,
nur in den seltensten Fällen läßt sich durch
originale Probedrucke der Entwicklungsgang
einer neuen Technik von ihrer „Vorgeschichte“
her bis zu denjenigen Druckerstlingen be-
legen, die mehr oder minder schon einen end-
gültigen ersten fertigen Zustand bezeugen.
Ebensowenig wie sich die allerältesten
Aus: „Die vier Angeltugenden“
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin
Drucke Gutenbergs erhalten haben — die, die
wir kennen, sind bereits veröffentlichte
Blätter und Bücher — haben sich die anderen
Versuchswerkstattarbeiten zumeist nicht bis
in unsere Gegenwart gerettet, so daß die Be-
zeichnung Druckerstlinge insofern nicht völlig
zutreffend erscheint, als man sie meistenteils
nicht mehr auf die eigentlichen ersten
praktisch gelungenen Lösungen einer tech-
nischen Problematik beziehen kann. Ähnliches
gilt ja auch für die literarischen Erstdrucke,
die, rein typographisch gewertet, keine solche
sind, als welche etwa
die Korrekturexemplare
anzusehen sein wür-
den. Aber die Erst-
ausgaben dokumentie-
ren oft die anerkannte
endgültige Form der
Veröffentlichung eines
literarischen Werkes,
während die Druck-
Erstlinge in der Samm-
lung die Genesis einer
Technik erläutern, die
Beweisstücke für die
Anfänge und die stu-
fenweise Ausbildung
der bahnbrechenden
Ausgestaltungen einer
technischen Methode
sein sollen. Die Druck-
Erstlinge sind häufig
nur relative Urkunden-
werte, auf die das
„beinahe“ zutrifft, das
heute in der Philoso-
phie des „Als ob“ seine
von Friedrich Schlegel,
im 80. Lyzeumsfrag-
ment, am Kantischen
Stammbaum der Ur-
begriffe vermißte Rolle
spielt. Die Druck-Erst-
linge sind auch nur die
abgeleiteten Originalprodukte eines jeweiligen
Verfahrens, dessen Druckformen, Geräte usw.
ebenfalls in ein bibliotechnisch-historisches
Museum hineingehören würden, das sich außer-
dem noch durch Berichte, Erfinderbildnisse und
Erfinderhandschriften usw. abrunden sollte.
Wenn sich die bibliotechnische Kollektion troß-
dem in der Hauptsache auf die Druckerei-
erzeugnisse einschränkt, so bleibt sie dennoch
ein für den Büchersammler und Forscher loh-
nendes Unternehmen. Nicht allein, daß die
Blätter und Bücher, die sie aufnehmen will, häu-
fig, wie z.B. die alten Schriftproben, große
Seltenheiten sind, die zum Suchen verlocken,
daß sich reizvoll Sammeln und Studieren ver-
bindet, weil viele Zusammenhänge noch auf-
zudecken sind, die Druck-Erstlinge sind oft
auch die einzigen Überreste, die für eine alte
Technik zeugen. Nur aus diesen Drucken
kann man Rückschlüsse auf die Technik selbst
ziehen, wofür das beträchtlichste methodische
Beispiel die Inkunabelforschung ist, der nur
ganz gelegentlich Druckversehen, Korrektur-
bogen und ähnliche dem Zufall verdankte
Aus: „Die vier Angeltugenden"
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin
Attendorn-Drucke
Aus dem in Kürze erscheinenden Anti-
quariats-Katalog I des Bibiographikon
Wertheim werden uns auf unseren Wunsch
freundlicherweise der nachfolgende Abschnitt
sowie die drei Illustrationen zur Verfügung
gestellt.
In den neueren Inkunabelbibliographien
und Druckerverzeichnissen des 15. Jahr-
hunderts sucht man den Namen Peter Atten-
dorns als Drucker vergebens, er wird nur bei-
läufig als Verleger und Buchhändler be-
zeichnet. Die einzige Quelle unserer Kenntnis
von seiner Tätigkeit als Drucker sind die am
Anfang des Directorium stafuum 1489 (Hain
6274) abgedruckten Briefe des Jac. Wimpfe-
ling an Attendorn und dessen Antwortschrei-
ben, aus denen hervorgeht, daß Attendorn
der Drucker gewesen ist. In dem von Vouil-
leme verfaßten Aufsaß über Attendorn (in
der Milkau-Festschrift
1921, S. 344-353) wer-
den auf Grund von
Typenübereinstimmung
sechs weitere Drucke
und ein Einblattdruck
ihm zugewiesen.
Unser Druck (Die
vier Angeltugenden:
25 Blatt, mit sechs
Holzschnitten. 4 to. Sine
nota) stammt nach
dem Urteil der Wiegen-
druck - Kommission
ebenfalls von Atten-
dorn. Verwendet sind
die Typen 4, 5, Init. d.
In der genannten Ar-
beit von Vouilleme,
ebenso in seinem
Werk: Die deutschen
Drucker (2. Auflage
1922) ist dieser Druck
noch nicht vermerkt.
Es ist das erste Mal,
daß er im Handel auf-
taucht — wie über-
haupt Drucke aus die-
ser außerordentlich
kleinen Presse zu den
größten Seltenheiten
gehören.
Die Reproduktion
der drei Holzschnitte
gibt eine Probe von den bemerkenswerten
Illustrationen dieses Druckes.
über ein weiteres, besonders inter-
essantes Holzschnittbuch des 15. Jahrhunderts
(Elucidarius, Ulm, Zainer, 1493), gleichfalls
im Besiß des Bibiographikon Wert-
heim, siehe Seite 14.
Aus; „Die vier Angeltugenden"
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin
DER BIBLIOPHILE
UND
DER GRAPHIKSAMMLER
Druck- Ers tim ge
Von G. A.E. Bogeng
Die Atmosphäre der „Erstausgabe" eines
Werkes ist eine geistesgeschichtliche; die Ur-
ausgabe erscheint als die literarische Mani-
festation des Verfassers selbst, als derjenige
Druck, der ihm möglicherweise am nächsten
steht, den er persönlich überwachte, der ihn
persönlich vertritt, der der vollkommen zeit-
gemäße Ausdruck seines Werkes ist. Der-
artige mehr allgemeine Momente subjektiver
Betrachtungsweise eines Bibliophilen verfesti-
gen sich in der literarhistorisch-philologischen
Richtung wissenschaftlich: Urausgaben sind
Repräsentanten originaler Textüberlieferung
nicht nur dann, wenn die Autormanuskripte
verloren gingen, son-
dern auch dann, wenn
die Autorkorrekturen
den Übergang vom
Manuskript in die ty-
pographische Ausfor-
mung eines Buches be-
zeichnen. Es sind als
innere Werkwerte, die
durch die Liebhaber-
werte einer Urausgabe
bezeugt werden, deren
technisch - typographi-
schen Eigenheiten nur
eine sekundäre Be-
deutung zugemessen
wird, insbesondere
diese, daß sich aus
ihnen Rückschlüsse auf
die Druckherkunft, auf
den Drucklegungsgang
usw. ziehen lassen.
Sind einmal solche
Feststellungen von der
bibliographischen For-
schung gemacht wor-
den, dann interessieren
sie in der Regel den
Sammler nur insoweit,
als er sie verwertet,
um „echte“ und „fal-
sche“ Ausgaben nach
ihren besonderen buch-
druckerischen Merk-
malen zu unterscheiden, wobei er sich zumeist
damit begnügt, der bibliographischen Referenz
zu glauben und sich nicht einmal allzuviel
darum bekümmert, welchen Anteil der Verfasser
an der Drucklegung seines Buches hatte, ob-
schon gerade in diesem tatsächlichen Um-
stande und nicht in dem, daß etwas zum
erstenmal gedruckt wurde, die Eigenwerte
einer Urausgabe liegen. Es gab und gibt Ver-
fasser, welche auf die ästhetisch-technische
Ausführung ihrer Werke einen bestimmenden
Einfluß nahmen, die die Ausdrucksmittel der
Druckerei in bestimmten Richtungen ver-
werten wollten, deren Originaleditionen auch
im literarischen Sinne eine Originaltypogra-
phie haben; aus der deutschen Dichtung der
Gegenwart sind dafür Arno Holz und Stefan
George Beispiele. Doch auch in der Ver-
gangenheit waren die Vorschriften und
Wünsche der Autoren für die typographische
Ausstattung ihrer Bücher zahlreich. Die Ver-
fasser-Verleger-Briefwechsel zeigen, daß
manche Einzelheiten, die man für zufällig
halten möchte, die Erfüllung derartiger Forde-
rungen sind; Goethe z. B. hat bisweilen
eigenen erheblichen Anteil an den Details der
Druckausführung genommen. Aber alles das
blieb meist, wenn nicht der Autor sein eigener
Typograph wurde, wie Restif de la Bretonne,
mehr ein Anregen und Ausgleichen als ein
unmittelbares Eingreifen in die technische
Herstellung, durch das Klopstock die Ver-
öffentlichung seiner Oden bei Johann Joachim
Christoph Bocle (Hamburg, 1768) verzögerte,
weil er den Guß der Typen abwarten wollte,
deren Zeichnung er unter dem Beistand des
Kopenhagener Kupferstechers Johann Martin
Preisler entworfen hatte. Die technisch-typo-
graphischen Besonderheiten, die auch unter
den Eigenwerten einer Erstausgabe hervor-
treten können, sind ausschlaggebend für die-
jenigen Bücher, die nach Druckvorzügen, nicht
nach literarischen Qualitäten geschäht wer-
den, weil sie Letternkunst-Meisterstücke sind,
oder weil die frischesten Abzüge bedeutender
Holzschnitte sie zieren, und so fort. Man
bringt diese Büchergruppe in der Regel unter
den Sammelnamen Buchkunst, man ordnet sie
nach ästhetischen Kategorien, nach Künstler-
namen oder Kunstarten, nach Stilepochen
usw. Dabei bleiben dann überwiegend die
kunstgeschichtlichen Anschauungen, wie die
Beziehungen zu einer für zeitlos gehaltenen
künstlerischen Leistung, deren zufälliger
Träger die Illustration des Buches ist, maß-
gebend, weit weniger ein technisch-
historischer Standpunkt. Wohl hat man sich
daran gewöhnt, ihn für die Anfänge der Buch-
druckerei einzunehmen und die Inkunabel-
periode aus einem technischen Blickpunkte zu
sehen. Und ist dann neuerdings auch dazu
gelangt, die Geschichte der Schriftgießerei
aus der Typenkunde des 15. Jahrhunderts
weiterzuführen. Die Druckschrift ist der
eigentliche Urheber des schön gedruckten
Buches; dem entspricht es, daß man Bücher
sammelt, die älteste oder beste Anwendungen
berühmter Druckschriften sind. Einstweilen
ist dieses Sammelgebiet einer Typophilie
noch immer dem allgemeinen Buchkunst-
gedanken untergeordnet, in Parallelisierungen
hervorragender historischer und moderner
Pressen, in einem nicht überall sehr klaren
Ästhetisieren um „das schöne Buchdruckwerk“.
Es fehlt noch der bibliographisch feste
Mittelpunkt eines bibliotechnisch-historischen
Systems, von dem aus ein Überblick über das
ganze Sammelgebiet zu gewinnen sein würde,
das außer den ikonographischen Techniken
die der Typographie als solche berücksichtigt.
Tatsächlich ist es ja so, daß bald nach deren
Erfindung ihre buchdruckerischen Fort-
bildungen sich vereinzelten und immer von
neuem wieder zusammenschlossen. Bücher,
„Druck-Erstlinge“, die früheste Anwendungen
eines neuen oder verbesserten Verfahrens,
diese oder jene originale technische Orientie-
rung dokumentieren, wären in großer Anzahl
aufzuführen, ihre Aneinanderreihung würde
umfassend die technische Ausgestaltung der
Buchdruckkunst vom 15. bis zum 20. Jahr-
hundert erläutern. Bisher ist ein derartiger
Sammlungsversuch, sei es auch nur durch
eine Bearbeitung der mannigfachen biblio-
graphischen Materialien, nicht gemacht wor-
den. Bereits übliche Katalogvermerke für die
Bände der Wiegendruckzeit sind: das „erste“
Buchdruckwerk mit einer Karte, mit einem
Kupferstich, mit irgendeiner sonstigen Be-
sonderheit, mit der es zuerst eine bibliotech-
nische Entdeckung oder Erfindung bekundet,
eine neuartige druckerische Wendung nimmt.
Dagegen beachtet man für die späteren Jahr-
hunderte nur ausnahmsweise die beispiel-
gebend gewordenen oder in Vergessenheit ge-
ratenen, vielleicht später ähnlich noch einmal
erfundenen Verfahren der Druckerstlinge, die
irgendwelchen technischen Fortschritt ein-
führten. Meist sind nun allerdings jeßt ver-
lorengegangene Versuchsdrucke einer frühe-
sten praktischen Vollendung vorangegangen,
nur in den seltensten Fällen läßt sich durch
originale Probedrucke der Entwicklungsgang
einer neuen Technik von ihrer „Vorgeschichte“
her bis zu denjenigen Druckerstlingen be-
legen, die mehr oder minder schon einen end-
gültigen ersten fertigen Zustand bezeugen.
Ebensowenig wie sich die allerältesten
Aus: „Die vier Angeltugenden“
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin
Drucke Gutenbergs erhalten haben — die, die
wir kennen, sind bereits veröffentlichte
Blätter und Bücher — haben sich die anderen
Versuchswerkstattarbeiten zumeist nicht bis
in unsere Gegenwart gerettet, so daß die Be-
zeichnung Druckerstlinge insofern nicht völlig
zutreffend erscheint, als man sie meistenteils
nicht mehr auf die eigentlichen ersten
praktisch gelungenen Lösungen einer tech-
nischen Problematik beziehen kann. Ähnliches
gilt ja auch für die literarischen Erstdrucke,
die, rein typographisch gewertet, keine solche
sind, als welche etwa
die Korrekturexemplare
anzusehen sein wür-
den. Aber die Erst-
ausgaben dokumentie-
ren oft die anerkannte
endgültige Form der
Veröffentlichung eines
literarischen Werkes,
während die Druck-
Erstlinge in der Samm-
lung die Genesis einer
Technik erläutern, die
Beweisstücke für die
Anfänge und die stu-
fenweise Ausbildung
der bahnbrechenden
Ausgestaltungen einer
technischen Methode
sein sollen. Die Druck-
Erstlinge sind häufig
nur relative Urkunden-
werte, auf die das
„beinahe“ zutrifft, das
heute in der Philoso-
phie des „Als ob“ seine
von Friedrich Schlegel,
im 80. Lyzeumsfrag-
ment, am Kantischen
Stammbaum der Ur-
begriffe vermißte Rolle
spielt. Die Druck-Erst-
linge sind auch nur die
abgeleiteten Originalprodukte eines jeweiligen
Verfahrens, dessen Druckformen, Geräte usw.
ebenfalls in ein bibliotechnisch-historisches
Museum hineingehören würden, das sich außer-
dem noch durch Berichte, Erfinderbildnisse und
Erfinderhandschriften usw. abrunden sollte.
Wenn sich die bibliotechnische Kollektion troß-
dem in der Hauptsache auf die Druckerei-
erzeugnisse einschränkt, so bleibt sie dennoch
ein für den Büchersammler und Forscher loh-
nendes Unternehmen. Nicht allein, daß die
Blätter und Bücher, die sie aufnehmen will, häu-
fig, wie z.B. die alten Schriftproben, große
Seltenheiten sind, die zum Suchen verlocken,
daß sich reizvoll Sammeln und Studieren ver-
bindet, weil viele Zusammenhänge noch auf-
zudecken sind, die Druck-Erstlinge sind oft
auch die einzigen Überreste, die für eine alte
Technik zeugen. Nur aus diesen Drucken
kann man Rückschlüsse auf die Technik selbst
ziehen, wofür das beträchtlichste methodische
Beispiel die Inkunabelforschung ist, der nur
ganz gelegentlich Druckversehen, Korrektur-
bogen und ähnliche dem Zufall verdankte
Aus: „Die vier Angeltugenden"
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin
Attendorn-Drucke
Aus dem in Kürze erscheinenden Anti-
quariats-Katalog I des Bibiographikon
Wertheim werden uns auf unseren Wunsch
freundlicherweise der nachfolgende Abschnitt
sowie die drei Illustrationen zur Verfügung
gestellt.
In den neueren Inkunabelbibliographien
und Druckerverzeichnissen des 15. Jahr-
hunderts sucht man den Namen Peter Atten-
dorns als Drucker vergebens, er wird nur bei-
läufig als Verleger und Buchhändler be-
zeichnet. Die einzige Quelle unserer Kenntnis
von seiner Tätigkeit als Drucker sind die am
Anfang des Directorium stafuum 1489 (Hain
6274) abgedruckten Briefe des Jac. Wimpfe-
ling an Attendorn und dessen Antwortschrei-
ben, aus denen hervorgeht, daß Attendorn
der Drucker gewesen ist. In dem von Vouil-
leme verfaßten Aufsaß über Attendorn (in
der Milkau-Festschrift
1921, S. 344-353) wer-
den auf Grund von
Typenübereinstimmung
sechs weitere Drucke
und ein Einblattdruck
ihm zugewiesen.
Unser Druck (Die
vier Angeltugenden:
25 Blatt, mit sechs
Holzschnitten. 4 to. Sine
nota) stammt nach
dem Urteil der Wiegen-
druck - Kommission
ebenfalls von Atten-
dorn. Verwendet sind
die Typen 4, 5, Init. d.
In der genannten Ar-
beit von Vouilleme,
ebenso in seinem
Werk: Die deutschen
Drucker (2. Auflage
1922) ist dieser Druck
noch nicht vermerkt.
Es ist das erste Mal,
daß er im Handel auf-
taucht — wie über-
haupt Drucke aus die-
ser außerordentlich
kleinen Presse zu den
größten Seltenheiten
gehören.
Die Reproduktion
der drei Holzschnitte
gibt eine Probe von den bemerkenswerten
Illustrationen dieses Druckes.
über ein weiteres, besonders inter-
essantes Holzschnittbuch des 15. Jahrhunderts
(Elucidarius, Ulm, Zainer, 1493), gleichfalls
im Besiß des Bibiographikon Wert-
heim, siehe Seite 14.
Aus; „Die vier Angeltugenden"
(Straßburg, Peter Attendorn, um 1492)
Besitz des Bibiographikon Wertheim, Berlin