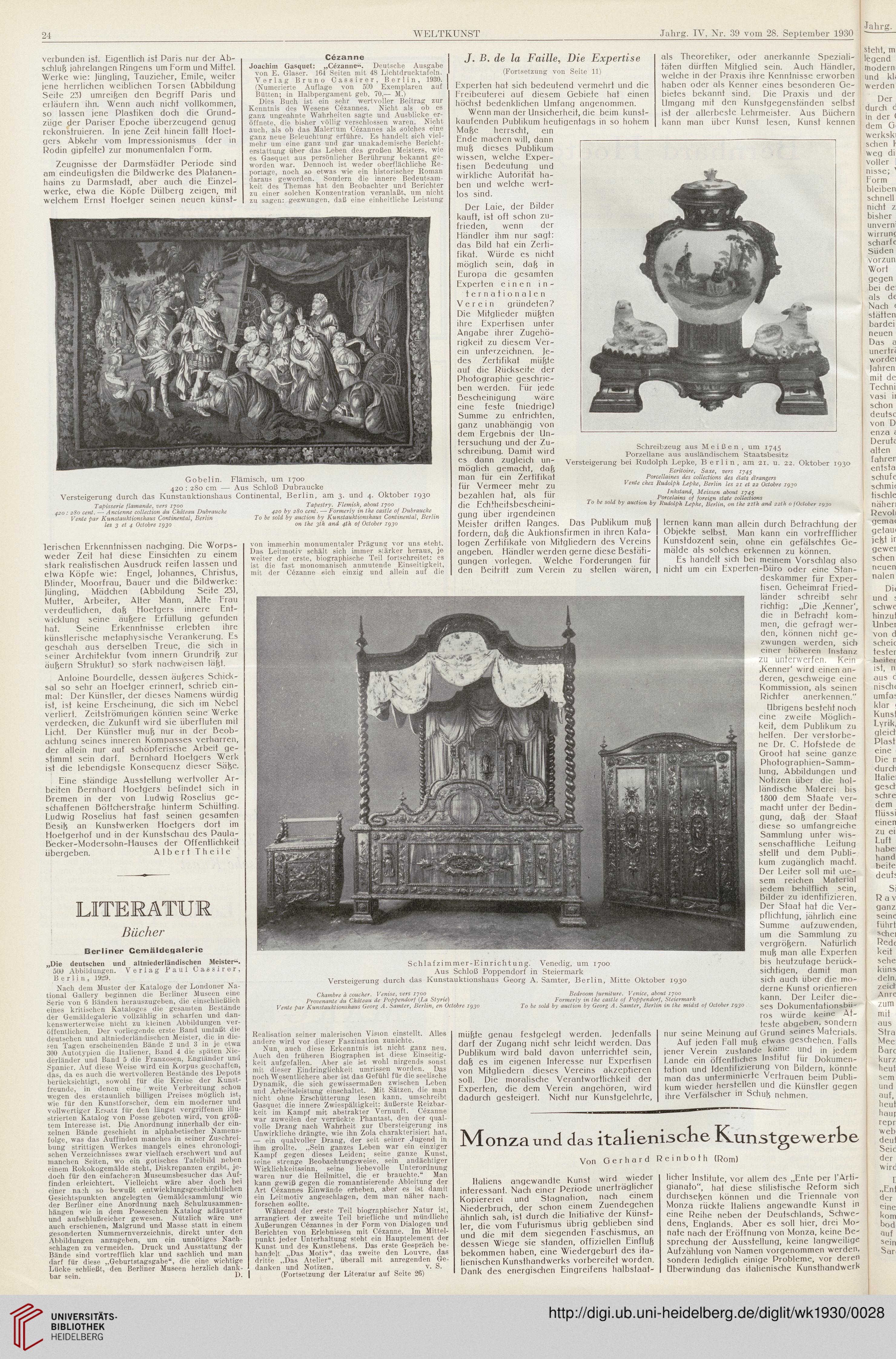24
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930
Jahrg.
als Theoretiker, oder anerkannte Speziali-
täten dürften Mitglied sein. Auch Händler,
welche in der Praxis ihre Kenntnisse erworben
haben oder als Kenner eines besonderen Ge-
bietes bekannt sind. Die Praxis und der
Umgang mit den Kunstgegenständen selbst
ist der allerbeste Lehrmeister. Aus Büchern
kann man über Kunst lesen, Kunst kennen
Schlafzimmer-Einrichtung. Venedig, um 1700
Aus Schloß Poppendorf in Steiermark
Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, Mitte Oktober 1930
Chambre ä coucher. Venise, vers 1700 _ Bedroom furniture. Venice, about 1700
Provenante du Chateau de~ Poppendorf (La Styrie) Formerly in the castle of Poppendorf, Steiermark
Vente par Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, en Octobre 1930 To be sold by auction by Georg A. Samter, Berlin in the midst of October 1930
Monza und das italienische Kunstgewerbe
Von Gerhard Reinboth (Rom)
Italiens angewandte Kunst wird wieder
interessant. Nach einer Periode unerträglicher
Kopiererei und Stagnation, nach einem
Niederbruch, der schon einem Zuendegehen
ähnlich sah, ist durch die Initiative der Künst-
ler, die vom Futurismus übrig geblieben sind
und die mit dem siegenden Faschismus, an
dessen Wiege sie standen, offiziellen Einfluß
bekommen haben, eine Wiedergeburt des ita-
lienischen Kunsthandwerks vorbereitet worden.
Dank des energischen Eingreifens halbstaat-
licher Institute, vor allem des „Ente per l’Arti—
gianato", hat diese stilistische Reform sich
durchseßen können und die Triennale von
Monza rückte Italiens angewandte Kunst in
eine Reihe neben der Deutschlands, Schwe-
dens, Englands. Aber es soll hier, drei Mo-
nate nach der Eröffnung von Monza, keine Be-
sprechung der Ausstellung, keine langweilige
Aufzählung von Namen vorgenommen werden,
sondern lediglich einige Probleme, vor deren
Überwindung das italienische Kunsthandwerk
verbunden ist. Eigentlich ist Paris nur der Ab-
schluß jahrelangen Ringens um Form und Mittel.
Werke wie: Jüngling, Tauzieher, Emile, weiter
jene herrlichen weiblichen Torsen (Abbildung
Seite 23) umreißen den Begriff Paris und
erläutern ihn. Wenn auch nicht vollkommen,
so lassen jene Plastiken doch die Grund-
züge der Pariser Epoche überzeugend genug
rekonstruieren. In jene Zeit hinein fällt Hoet-
gers Abkehr vom Impressionismus (der in
Rodin gipfelte) zur monumentalen Form.
Zeugnisse der Darmstädter Periode sind
am eindeutigsten die Bildwerke des Platanen-
hains zu Darmstadt, aber auch die Einzel-
werke, etwa die Köpfe Dülberg zeigen, mit
welchem Ernst Hoetger seinen neuen künst-
Cezanne
Joachim Gasquet: „Cezanne“. Deutsche Ausgabe
von E. Glaser. 164 Seiten, mit 48 Lichtdrucktafeln.
Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1930.
(Numerierte Auflage von 500 Exemplaren auf
Bütten; in Halbpergament geb. 70,— M.)
Dies Buch, ist ein sehr wertvoller Beitrag zur
Kenntnis des Wesens Cezannes. Nicht als ob es
ganz ungeahnte Wahrheiten sagte und Ausblicke er-
öffnete, die bisher völlig verschlossen waren. Nicht
auch, als ob das Malertum Cezannes als solches eine
ganz neue Beleuchtung erführe. Es handelt sich viel-
mehr um eine ganz und gar -unakademische Bericht-
erstattung über das Leben des großen Meisters, wie
es Gasquet aus persönlicher Berührung bekannt ge-
worden war. Dennoch ist weder oberflächliche Re-
portage, noch so etwas wie ein historischer Roman
daraus geworden. Sondern die innere Bedeutsam-
keit des Themas hat den Beobachter und Berichter
zu einer -solchen Konzentration veranlaßt, um nicht
zu sagen: gezwungen, daß eine einheitliche Leistung
LITERATUR
Bücher
Berliner Cemäldeqalerie
„Die deutschen und altniederländischen Meister“.
500 Abbildungen. Verlag Paul Cassirer,
Berlin, 1929.
Nach dem Muster der Kataloge- der Londoner Na-
tional Gallery beginnen die Berliner Museen eine
Serie von 6 Bänden herauszugeben, die einschließlich
eines kritischen Kataloges die gesamten Bestände
der Gemäldegalerie vollzählig in scharfen und dan-
kenswerterweise nicht zu kleinen Abbildungen ver-
öffentlichen. Der vorliegende erste Band umfaßt die
deutschen und altniederländischen Meister, die in die-
sen Tagen erscheinenden Bände 2 und 3 in je etwa
300 Autotypien die Italiener, Band 4 die späten Nie-
derländer und Band 5 die Franzosen, Engländer und
Spanier. Auf diese Weise wird ein Korpus geschaffen,
das, da es auch die wertvolleren Bestände des Depots
berücksichtigt, sowohl für die Kreise der Kunst-
freunde, in denen eine weite Verbreitung schon
wegen des erstaunlich billigen Preises möglich ist,
wie für den Kunstforscher, dem ein moderner und
vollwertiger Ersatz für den längst vergriffenen illu-
strierten Katalog von Posse geboten wird, von größ-
tem Interesse ist. Die Anordnung innerhalb der ein-
zelnen Bände geschieht in alphabetischer Namens-
folge, was das Auffinden manches in seiner Zuschrei-
bung strittigen Werkes mangels eines chronologi-
schen Verzeichnisses zwar vielfach erschwert und auf
manchen Seiten, wo ein gotisches Tafelbild neben
einem Rokokogemälde steht, Diskrepanzen ergibt, je-
doch für den einfacheren Museumsbesucher das Auf;
finden erleichtert. Vielleicht wäre aber doch bei
einer nach so bewußt entwicklungsgeschiehtlichen
Gesichtspunkten angelegten Gemäldesammlung wie
der Berliner eine Anordnung nach Schulzusammen-
hängen wie in dem Poss-eschen Katalog adäquater
und aufschlußreicher gewesen. Nützlich wäre uns
auch erschienen, Malgrund und Masse statt in einem
gesonderten Nummernverzeichnis, direkt unter den
Abbildungen anzugeben, um ein unnötiges Nach-
schlagen zu vermeiden. Druck und Ausstattung der
Bände sind vortrefflich klar und sachlich und man
darf für diese „Geburtstagsgabe“, die eine wichtige
Lücke schließt, den Berliner Museen herzlich dank-
bar sein. D.
Realisation seiner malerischen Vision einstellt. Alles
andere wird vor dieser Faszination zunichte.
Nun, auch diese Erkenntnis ist nicht ganz neu.
Auch den früheren Biographen ist diese Einseitig-
keit aufgefallen. Aber sie ist wohl nirgends sonst
mit dieser Eindringlichkeit umrissen worden. Das
noch Wesentliehere aber ist das Gefühl für die seelische
Dynamik, die sich gewissermaßen zwischen Leben
und Arbeitsleistung einschaltet. Mit Sätzen, die man
nicht ohne Erschütterung lesen kann, umschreibt
Gasquet die innere Zwiespältigkeit: äußerste Reizbar-
keit im Kampf mit abstrakter Vernunft. Cdzanne
war zuweilen der verrückte Phantast, den der qual-
volle Drang nach Wahrheit zur Übersteigerung ins
Unwirkliche drängte, wie ihn Zola charakterisiert hat,
— ein qualvoller Drang, der seit seiner Jugend in
ihm grollte. , „Sein ganzes Leben war ein einziger
Kampf gegen dieses Leiden;, seine, ganze Kunst,
seine strenge Beobachtungsweise, sein andächtiger
Wirklichkeitssinn, seine liebevolle Unterordnung
waren nur die Heilmittel, die . er brauchte.“ Man
kann gewiß gegen die romantisierende Ableitung der
Art Cezannes Einwände- erheben, aber es ist damit
ein Leitmotiv angeschlagen, dem man näher nach-
forschen sollte.
Während der erste Teil biographischer Natur , ist,
arrangiert der zweite Teil briefliche und mündliche
Äußerungen Ctaiannes in der Form von Dialogen und
Berichten von Erlebnissen mit Cezanne. Im Mittel-
punkt jeder Unterhaltung steht ein Hauptelement der
Kunst und des Kunstlebens. Das erste Gespräch be-
handelt „Das Motiv“, das zweite den Louvre, das
dritte „Das Atelier“, überall mit anregenden Ge-
danken und Notizen. . v. S.
(Fortsetzung der Literatur auf Seite 26)
J. B. de la Faille, Die Expertise
(Fortsetzung von Seite 11)
Das Publikum muß
und
hol-
bis
ver-
müßfe genau festgelegt werden. Jedenfalls
darf der Zugang nicht sehr leicht werden. Das
Publikum wird bald davon unterrichtet sein,
daß es im eigenen Interesse nur Expertisen
von Mitgliedern dieses Vereins akzeptieren
soll. Die moralische Verantwortlichkeit der
Experten, die dem Verein angehören, wird
dadurch gesteigert. Nicht nur Kunstgelehrte,
Der Laie, der Bilder
kauft, ist oft schon zu-
frieden, wenn der
Händler ihm nur sagt:
das Bild hat ein Zerti-
fikat. Würde es nicht
möglich sein, daß in
Europa die gesamten
Experten einen in-
ternationalen
Verein gründeten?
Die Mitglieder müßten
ihre Expertisen unter
Angabe ihrer Zugehö-
rigkeit zu diesem Ver-
ein unterzeichnen. Je-
des Zertifikat müßte
auf die Rückseite der
Photographie geschrie-
ben werden. Für jede
Bescheinigung wäre
eine feste (niedrige)
Summe zu entrichten,
ganz unabhängig von
dem Ergebnis der Un-
tersuchung und der Zu-
schreibung. Damit wird
es dann zugleich un-
möglich gemacht, daß
man tür ein Zertifikat
für Vermeer mehr zu
bezahlen hat, als für
die Echtheitsbescheini-
gung über irgendeinen
Meister dritten Ranges,
fordern, daß die Auktionsfirmen in ihren Kata-
logen Zertifikate von Mitgliedern des Vereins
angeben. Händler werden gerne diese Bestäti-
gungen vorlegen. Welche Forderungen für
den Beitritt zum Verein zu stellen wären.
Schreibzeug aus Meißen, um 1745
Porzellane aus ausländischem Staatsbesitz
Versteigerung bei Rudolph Lepke, Berlin, am 21. u. 22. Oktober 1930
Ecritoire, Saxe, vers 1745
Porcellaines des collections des etats etrangers
Vente chez Rudolph Lepke, Berlin les 21 et 22 Octobre 1930
Inkstand, Meissen about 1745
Ä „ ,, , .. . Porcelains of foreign state collections
io oe sota by auction by Rudolph Lepke, Berlin, on the 2ith and 22th ofOctober 1930
rvLnen kann man allein durch Betrachtung der
Objekte selbst. Man kann ein vortrefflicher
Kunstdozent sein, ohne ein gefälschtes Ge-
mälde als solches erkennen zu können.
Es handelt sich bei meinem Vorschlag also
nicht um ein Experten-Büro oder eine Stan-
deskammer für Exper-
tisen. Geheimrat Fried-
länder schreibt sehr
richtig: „Die ,Kenner',
die in Betracht kom-
men, die gefragt wer-
den, können nicht ge-
zwungen werden, sich
einer höheren Instanz
zu unterwerfen. Kein
.Kenner' wird einen an-
deren, geschweige eine
Kommission, als seinen
Richter anerkennen."
übrigens besteht noch
eine zweite Möglich-
keit, dem Publikum zu
helfen. Der verstorbe-
ne Dr. C. Hofstede de
Groot hat seine ganze
Photographien-Samm-
lung, Abbildungen
Notizen über die
ländische Malerei
1800 dem Staate
macht unter der Bedin-
gung, daß der Staat
diese so umfangreiche
Sammlung unter wis-
senschaftliche Leitung
stellt und dem Publi-
kum zugänglich macht.
Der Leiter soll mit uie-
sem reichen Material
jedem behilflich sein,
Bilder zu identifizieren.
Der Staat hat die Ver-
pflichtung, jährlich eine
Summe aufzuwenden,
um die Sammlung zu
vergrößern. Natürlich
muß man alle Experten
bis heutzutage berück-
sichtigen, damit man
sich auch über die mo-
derne Kunst orientieren
kann. Der Leiter die-
ses Dokumentationsbü-
ros würde keine At-
teste abgeben, sondern
nur seine Meinung auf Grund seines Materials.
Auf jeden Fall muß etwas geschehen. Falls
jener Verein zustande käme und in jedem
Lande ein öffentliches Institut für Dokumen-
tation und Identifizierung von Bildern, könnte
man das unterminierte Vertrauen beim Publi-
kum wieder herstellen und die Künstler gegen
ihre Verfälscher in Schuß nehmen.
Gobelin. Flämisch, um 1700
420 : 280 cm — Aus Schloß Dubraucke
Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Continental, Berlin, am 3. und 4. Oktober 1930
Tapisserie flamande, vers 1700
420 : 2S0 cent. — Ancienne collection du Chateau Dubraucke
Vente par Kunstauktionshaus Continental, Berlin
les 3 et 4 Octobre 1930
Tapestry. Flemish, about 1700
420 by 280 cent. — Formerly in the castle of Dubraucke
To be sold by auction by Kunstauktionshaus Continental, Berlin
on the 3th and 4th of October 1930
Experten hat sich bedeutend vermehrt und die
Freibeuterei auf diesem Gebiete tiat einen
höchst bedenklichen Umfang angenommen.
Wenn man der Unsicherheit, die beim kunst-
kaufenden Publikum heutigentags in so hohem
Maße herrscht, ein
Ende machen will, dann -:—
muß dieses Publikum
wissen, welche Exper-
tisen Bedeutung und
wirkliche Autorität ha-
ben und welche wert-
los sind.
lerischen Erkenntnissen nachging. Die Worps-
weder Zeit hat diese Einsichten zu einem
stark realistischen Ausdruck reifen lassen und
etwa Köpfe wie: Engel, Johannes, Christus,
Blinder, Moorfrau, Bauer und die Bildwerke:
Jüngling, Mädchen (Abbildung Seite 23),
Mutter, Arbeiter, Alfer Mann, Alte Frau
verdeutlichen, daß Hoetgers innere Ent-
wicklung seine äußere Erfüllung gefunden
hat. Seine Erkenntnisse erlebten ihre
künstlerische metaphysische Verankerung. Es
geschah aus derselben Treue, die sich in
seiner Architektur (vom innern Grundriß zur
äußern Struktur) so stark nachweisen läßt.
Antoine Bourdelle, dessen äußeres Schick-
sal so sehr an Hoetger erinnert, schrieb ein-
mal: Der Künstler, der dieses Namens würdig
ist, ist keine Erscheinung, die sich im Nebel
verliert. Zeitströmuhgen können seine Werke
verdecken, die Zukunft wird sie überfluten mil
Licht. Der Künstler muß nur in der Beob-
achtung seines inneren Kompasses verharren,
der allein nur auf schöpferische Arbeit ge-
stimmt sein darf. Bernhard Hoetgers Werk
ist die lebendigste Konseguenz dieser Säße.
Eine ständige Ausstellung wertvoller Ar-
beiten Bernhard Hoetgers befindet sich in
Bremen in der von Ludwig Roselius ge-
sdiaffenen Böttcherstraße hinterm Schütting.
Ludwig Roselius hat fast seinen gesamten
Besiß an Kunstwerken Hoetgers dort im
Hoeigerhof und in der Kunstschau des Paula-
Becker-Modersohn-Hauses der Öffentlichkeit
übergeben. Albert Theile
von immerhin monumentaler Prägung vor uns steht.
Das Leitmotiv schält sich immer stärker heraus, je
weiter der erste, biographische Teil fortschreitet: es
ist die fast monomanisch anmutende Einseitigkeit,
mit der Cezanue eich einzig und allein auf die
steht, m
legend
modern
und kl:
werden
Der
durch c
in der <
dem G
werkski
sehen l
weg di
voller
nisse; 1
Form
bleiben
schnell
nicht z
| bisher
unvern:
wirrunc
scharfe
Süden
I vorzun
Wort
gegen
bei dei
als de
Nach <
stätten
| bardei
I neuen
Das s
unertri
wordei
Jahren
mit de
Techni
I vasi ii
schon
deutsc
von D
enza t
Derute
| alten
fahret
entsta
schüfe
schmi«
tischle
nähen
Revoli
gema«
getam
| jeßt ir
gewei
I sehen
neuen
nalen
Di«
und ;
| schwe
j hinzul
Unbei
I von d
scheit
testet
beiter
ist, n
aus c
I nisch«
umfat
klar <
Kunsl
Lyrik,
i gleid
Plast
eine
Die r
durd
Italiei
gesd
schre
dem
flüssi
einen
zu ei
Luft
habe
hand
beite
deut;
Si
Rav
ganz
seine
führt
sehei
Rede
keit
sehe
küns
dein,
zeid
Anre
zum
mit
aus
Stra
Mee
Bare
kurz
heut
sem
und
auf,
heut
häuf
repr
web
deul
Seid
der
wirc
I
„Eni
der
eine
kom
bod
auf
sein
Sar
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930
Jahrg.
als Theoretiker, oder anerkannte Speziali-
täten dürften Mitglied sein. Auch Händler,
welche in der Praxis ihre Kenntnisse erworben
haben oder als Kenner eines besonderen Ge-
bietes bekannt sind. Die Praxis und der
Umgang mit den Kunstgegenständen selbst
ist der allerbeste Lehrmeister. Aus Büchern
kann man über Kunst lesen, Kunst kennen
Schlafzimmer-Einrichtung. Venedig, um 1700
Aus Schloß Poppendorf in Steiermark
Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, Mitte Oktober 1930
Chambre ä coucher. Venise, vers 1700 _ Bedroom furniture. Venice, about 1700
Provenante du Chateau de~ Poppendorf (La Styrie) Formerly in the castle of Poppendorf, Steiermark
Vente par Kunstauktionshaus Georg A. Samter, Berlin, en Octobre 1930 To be sold by auction by Georg A. Samter, Berlin in the midst of October 1930
Monza und das italienische Kunstgewerbe
Von Gerhard Reinboth (Rom)
Italiens angewandte Kunst wird wieder
interessant. Nach einer Periode unerträglicher
Kopiererei und Stagnation, nach einem
Niederbruch, der schon einem Zuendegehen
ähnlich sah, ist durch die Initiative der Künst-
ler, die vom Futurismus übrig geblieben sind
und die mit dem siegenden Faschismus, an
dessen Wiege sie standen, offiziellen Einfluß
bekommen haben, eine Wiedergeburt des ita-
lienischen Kunsthandwerks vorbereitet worden.
Dank des energischen Eingreifens halbstaat-
licher Institute, vor allem des „Ente per l’Arti—
gianato", hat diese stilistische Reform sich
durchseßen können und die Triennale von
Monza rückte Italiens angewandte Kunst in
eine Reihe neben der Deutschlands, Schwe-
dens, Englands. Aber es soll hier, drei Mo-
nate nach der Eröffnung von Monza, keine Be-
sprechung der Ausstellung, keine langweilige
Aufzählung von Namen vorgenommen werden,
sondern lediglich einige Probleme, vor deren
Überwindung das italienische Kunsthandwerk
verbunden ist. Eigentlich ist Paris nur der Ab-
schluß jahrelangen Ringens um Form und Mittel.
Werke wie: Jüngling, Tauzieher, Emile, weiter
jene herrlichen weiblichen Torsen (Abbildung
Seite 23) umreißen den Begriff Paris und
erläutern ihn. Wenn auch nicht vollkommen,
so lassen jene Plastiken doch die Grund-
züge der Pariser Epoche überzeugend genug
rekonstruieren. In jene Zeit hinein fällt Hoet-
gers Abkehr vom Impressionismus (der in
Rodin gipfelte) zur monumentalen Form.
Zeugnisse der Darmstädter Periode sind
am eindeutigsten die Bildwerke des Platanen-
hains zu Darmstadt, aber auch die Einzel-
werke, etwa die Köpfe Dülberg zeigen, mit
welchem Ernst Hoetger seinen neuen künst-
Cezanne
Joachim Gasquet: „Cezanne“. Deutsche Ausgabe
von E. Glaser. 164 Seiten, mit 48 Lichtdrucktafeln.
Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1930.
(Numerierte Auflage von 500 Exemplaren auf
Bütten; in Halbpergament geb. 70,— M.)
Dies Buch, ist ein sehr wertvoller Beitrag zur
Kenntnis des Wesens Cezannes. Nicht als ob es
ganz ungeahnte Wahrheiten sagte und Ausblicke er-
öffnete, die bisher völlig verschlossen waren. Nicht
auch, als ob das Malertum Cezannes als solches eine
ganz neue Beleuchtung erführe. Es handelt sich viel-
mehr um eine ganz und gar -unakademische Bericht-
erstattung über das Leben des großen Meisters, wie
es Gasquet aus persönlicher Berührung bekannt ge-
worden war. Dennoch ist weder oberflächliche Re-
portage, noch so etwas wie ein historischer Roman
daraus geworden. Sondern die innere Bedeutsam-
keit des Themas hat den Beobachter und Berichter
zu einer -solchen Konzentration veranlaßt, um nicht
zu sagen: gezwungen, daß eine einheitliche Leistung
LITERATUR
Bücher
Berliner Cemäldeqalerie
„Die deutschen und altniederländischen Meister“.
500 Abbildungen. Verlag Paul Cassirer,
Berlin, 1929.
Nach dem Muster der Kataloge- der Londoner Na-
tional Gallery beginnen die Berliner Museen eine
Serie von 6 Bänden herauszugeben, die einschließlich
eines kritischen Kataloges die gesamten Bestände
der Gemäldegalerie vollzählig in scharfen und dan-
kenswerterweise nicht zu kleinen Abbildungen ver-
öffentlichen. Der vorliegende erste Band umfaßt die
deutschen und altniederländischen Meister, die in die-
sen Tagen erscheinenden Bände 2 und 3 in je etwa
300 Autotypien die Italiener, Band 4 die späten Nie-
derländer und Band 5 die Franzosen, Engländer und
Spanier. Auf diese Weise wird ein Korpus geschaffen,
das, da es auch die wertvolleren Bestände des Depots
berücksichtigt, sowohl für die Kreise der Kunst-
freunde, in denen eine weite Verbreitung schon
wegen des erstaunlich billigen Preises möglich ist,
wie für den Kunstforscher, dem ein moderner und
vollwertiger Ersatz für den längst vergriffenen illu-
strierten Katalog von Posse geboten wird, von größ-
tem Interesse ist. Die Anordnung innerhalb der ein-
zelnen Bände geschieht in alphabetischer Namens-
folge, was das Auffinden manches in seiner Zuschrei-
bung strittigen Werkes mangels eines chronologi-
schen Verzeichnisses zwar vielfach erschwert und auf
manchen Seiten, wo ein gotisches Tafelbild neben
einem Rokokogemälde steht, Diskrepanzen ergibt, je-
doch für den einfacheren Museumsbesucher das Auf;
finden erleichtert. Vielleicht wäre aber doch bei
einer nach so bewußt entwicklungsgeschiehtlichen
Gesichtspunkten angelegten Gemäldesammlung wie
der Berliner eine Anordnung nach Schulzusammen-
hängen wie in dem Poss-eschen Katalog adäquater
und aufschlußreicher gewesen. Nützlich wäre uns
auch erschienen, Malgrund und Masse statt in einem
gesonderten Nummernverzeichnis, direkt unter den
Abbildungen anzugeben, um ein unnötiges Nach-
schlagen zu vermeiden. Druck und Ausstattung der
Bände sind vortrefflich klar und sachlich und man
darf für diese „Geburtstagsgabe“, die eine wichtige
Lücke schließt, den Berliner Museen herzlich dank-
bar sein. D.
Realisation seiner malerischen Vision einstellt. Alles
andere wird vor dieser Faszination zunichte.
Nun, auch diese Erkenntnis ist nicht ganz neu.
Auch den früheren Biographen ist diese Einseitig-
keit aufgefallen. Aber sie ist wohl nirgends sonst
mit dieser Eindringlichkeit umrissen worden. Das
noch Wesentliehere aber ist das Gefühl für die seelische
Dynamik, die sich gewissermaßen zwischen Leben
und Arbeitsleistung einschaltet. Mit Sätzen, die man
nicht ohne Erschütterung lesen kann, umschreibt
Gasquet die innere Zwiespältigkeit: äußerste Reizbar-
keit im Kampf mit abstrakter Vernunft. Cdzanne
war zuweilen der verrückte Phantast, den der qual-
volle Drang nach Wahrheit zur Übersteigerung ins
Unwirkliche drängte, wie ihn Zola charakterisiert hat,
— ein qualvoller Drang, der seit seiner Jugend in
ihm grollte. , „Sein ganzes Leben war ein einziger
Kampf gegen dieses Leiden;, seine, ganze Kunst,
seine strenge Beobachtungsweise, sein andächtiger
Wirklichkeitssinn, seine liebevolle Unterordnung
waren nur die Heilmittel, die . er brauchte.“ Man
kann gewiß gegen die romantisierende Ableitung der
Art Cezannes Einwände- erheben, aber es ist damit
ein Leitmotiv angeschlagen, dem man näher nach-
forschen sollte.
Während der erste Teil biographischer Natur , ist,
arrangiert der zweite Teil briefliche und mündliche
Äußerungen Ctaiannes in der Form von Dialogen und
Berichten von Erlebnissen mit Cezanne. Im Mittel-
punkt jeder Unterhaltung steht ein Hauptelement der
Kunst und des Kunstlebens. Das erste Gespräch be-
handelt „Das Motiv“, das zweite den Louvre, das
dritte „Das Atelier“, überall mit anregenden Ge-
danken und Notizen. . v. S.
(Fortsetzung der Literatur auf Seite 26)
J. B. de la Faille, Die Expertise
(Fortsetzung von Seite 11)
Das Publikum muß
und
hol-
bis
ver-
müßfe genau festgelegt werden. Jedenfalls
darf der Zugang nicht sehr leicht werden. Das
Publikum wird bald davon unterrichtet sein,
daß es im eigenen Interesse nur Expertisen
von Mitgliedern dieses Vereins akzeptieren
soll. Die moralische Verantwortlichkeit der
Experten, die dem Verein angehören, wird
dadurch gesteigert. Nicht nur Kunstgelehrte,
Der Laie, der Bilder
kauft, ist oft schon zu-
frieden, wenn der
Händler ihm nur sagt:
das Bild hat ein Zerti-
fikat. Würde es nicht
möglich sein, daß in
Europa die gesamten
Experten einen in-
ternationalen
Verein gründeten?
Die Mitglieder müßten
ihre Expertisen unter
Angabe ihrer Zugehö-
rigkeit zu diesem Ver-
ein unterzeichnen. Je-
des Zertifikat müßte
auf die Rückseite der
Photographie geschrie-
ben werden. Für jede
Bescheinigung wäre
eine feste (niedrige)
Summe zu entrichten,
ganz unabhängig von
dem Ergebnis der Un-
tersuchung und der Zu-
schreibung. Damit wird
es dann zugleich un-
möglich gemacht, daß
man tür ein Zertifikat
für Vermeer mehr zu
bezahlen hat, als für
die Echtheitsbescheini-
gung über irgendeinen
Meister dritten Ranges,
fordern, daß die Auktionsfirmen in ihren Kata-
logen Zertifikate von Mitgliedern des Vereins
angeben. Händler werden gerne diese Bestäti-
gungen vorlegen. Welche Forderungen für
den Beitritt zum Verein zu stellen wären.
Schreibzeug aus Meißen, um 1745
Porzellane aus ausländischem Staatsbesitz
Versteigerung bei Rudolph Lepke, Berlin, am 21. u. 22. Oktober 1930
Ecritoire, Saxe, vers 1745
Porcellaines des collections des etats etrangers
Vente chez Rudolph Lepke, Berlin les 21 et 22 Octobre 1930
Inkstand, Meissen about 1745
Ä „ ,, , .. . Porcelains of foreign state collections
io oe sota by auction by Rudolph Lepke, Berlin, on the 2ith and 22th ofOctober 1930
rvLnen kann man allein durch Betrachtung der
Objekte selbst. Man kann ein vortrefflicher
Kunstdozent sein, ohne ein gefälschtes Ge-
mälde als solches erkennen zu können.
Es handelt sich bei meinem Vorschlag also
nicht um ein Experten-Büro oder eine Stan-
deskammer für Exper-
tisen. Geheimrat Fried-
länder schreibt sehr
richtig: „Die ,Kenner',
die in Betracht kom-
men, die gefragt wer-
den, können nicht ge-
zwungen werden, sich
einer höheren Instanz
zu unterwerfen. Kein
.Kenner' wird einen an-
deren, geschweige eine
Kommission, als seinen
Richter anerkennen."
übrigens besteht noch
eine zweite Möglich-
keit, dem Publikum zu
helfen. Der verstorbe-
ne Dr. C. Hofstede de
Groot hat seine ganze
Photographien-Samm-
lung, Abbildungen
Notizen über die
ländische Malerei
1800 dem Staate
macht unter der Bedin-
gung, daß der Staat
diese so umfangreiche
Sammlung unter wis-
senschaftliche Leitung
stellt und dem Publi-
kum zugänglich macht.
Der Leiter soll mit uie-
sem reichen Material
jedem behilflich sein,
Bilder zu identifizieren.
Der Staat hat die Ver-
pflichtung, jährlich eine
Summe aufzuwenden,
um die Sammlung zu
vergrößern. Natürlich
muß man alle Experten
bis heutzutage berück-
sichtigen, damit man
sich auch über die mo-
derne Kunst orientieren
kann. Der Leiter die-
ses Dokumentationsbü-
ros würde keine At-
teste abgeben, sondern
nur seine Meinung auf Grund seines Materials.
Auf jeden Fall muß etwas geschehen. Falls
jener Verein zustande käme und in jedem
Lande ein öffentliches Institut für Dokumen-
tation und Identifizierung von Bildern, könnte
man das unterminierte Vertrauen beim Publi-
kum wieder herstellen und die Künstler gegen
ihre Verfälscher in Schuß nehmen.
Gobelin. Flämisch, um 1700
420 : 280 cm — Aus Schloß Dubraucke
Versteigerung durch das Kunstauktionshaus Continental, Berlin, am 3. und 4. Oktober 1930
Tapisserie flamande, vers 1700
420 : 2S0 cent. — Ancienne collection du Chateau Dubraucke
Vente par Kunstauktionshaus Continental, Berlin
les 3 et 4 Octobre 1930
Tapestry. Flemish, about 1700
420 by 280 cent. — Formerly in the castle of Dubraucke
To be sold by auction by Kunstauktionshaus Continental, Berlin
on the 3th and 4th of October 1930
Experten hat sich bedeutend vermehrt und die
Freibeuterei auf diesem Gebiete tiat einen
höchst bedenklichen Umfang angenommen.
Wenn man der Unsicherheit, die beim kunst-
kaufenden Publikum heutigentags in so hohem
Maße herrscht, ein
Ende machen will, dann -:—
muß dieses Publikum
wissen, welche Exper-
tisen Bedeutung und
wirkliche Autorität ha-
ben und welche wert-
los sind.
lerischen Erkenntnissen nachging. Die Worps-
weder Zeit hat diese Einsichten zu einem
stark realistischen Ausdruck reifen lassen und
etwa Köpfe wie: Engel, Johannes, Christus,
Blinder, Moorfrau, Bauer und die Bildwerke:
Jüngling, Mädchen (Abbildung Seite 23),
Mutter, Arbeiter, Alfer Mann, Alte Frau
verdeutlichen, daß Hoetgers innere Ent-
wicklung seine äußere Erfüllung gefunden
hat. Seine Erkenntnisse erlebten ihre
künstlerische metaphysische Verankerung. Es
geschah aus derselben Treue, die sich in
seiner Architektur (vom innern Grundriß zur
äußern Struktur) so stark nachweisen läßt.
Antoine Bourdelle, dessen äußeres Schick-
sal so sehr an Hoetger erinnert, schrieb ein-
mal: Der Künstler, der dieses Namens würdig
ist, ist keine Erscheinung, die sich im Nebel
verliert. Zeitströmuhgen können seine Werke
verdecken, die Zukunft wird sie überfluten mil
Licht. Der Künstler muß nur in der Beob-
achtung seines inneren Kompasses verharren,
der allein nur auf schöpferische Arbeit ge-
stimmt sein darf. Bernhard Hoetgers Werk
ist die lebendigste Konseguenz dieser Säße.
Eine ständige Ausstellung wertvoller Ar-
beiten Bernhard Hoetgers befindet sich in
Bremen in der von Ludwig Roselius ge-
sdiaffenen Böttcherstraße hinterm Schütting.
Ludwig Roselius hat fast seinen gesamten
Besiß an Kunstwerken Hoetgers dort im
Hoeigerhof und in der Kunstschau des Paula-
Becker-Modersohn-Hauses der Öffentlichkeit
übergeben. Albert Theile
von immerhin monumentaler Prägung vor uns steht.
Das Leitmotiv schält sich immer stärker heraus, je
weiter der erste, biographische Teil fortschreitet: es
ist die fast monomanisch anmutende Einseitigkeit,
mit der Cezanue eich einzig und allein auf die
steht, m
legend
modern
und kl:
werden
Der
durch c
in der <
dem G
werkski
sehen l
weg di
voller
nisse; 1
Form
bleiben
schnell
nicht z
| bisher
unvern:
wirrunc
scharfe
Süden
I vorzun
Wort
gegen
bei dei
als de
Nach <
stätten
| bardei
I neuen
Das s
unertri
wordei
Jahren
mit de
Techni
I vasi ii
schon
deutsc
von D
enza t
Derute
| alten
fahret
entsta
schüfe
schmi«
tischle
nähen
Revoli
gema«
getam
| jeßt ir
gewei
I sehen
neuen
nalen
Di«
und ;
| schwe
j hinzul
Unbei
I von d
scheit
testet
beiter
ist, n
aus c
I nisch«
umfat
klar <
Kunsl
Lyrik,
i gleid
Plast
eine
Die r
durd
Italiei
gesd
schre
dem
flüssi
einen
zu ei
Luft
habe
hand
beite
deut;
Si
Rav
ganz
seine
führt
sehei
Rede
keit
sehe
küns
dein,
zeid
Anre
zum
mit
aus
Stra
Mee
Bare
kurz
heut
sem
und
auf,
heut
häuf
repr
web
deul
Seid
der
wirc
I
„Eni
der
eine
kom
bod
auf
sein
Sar