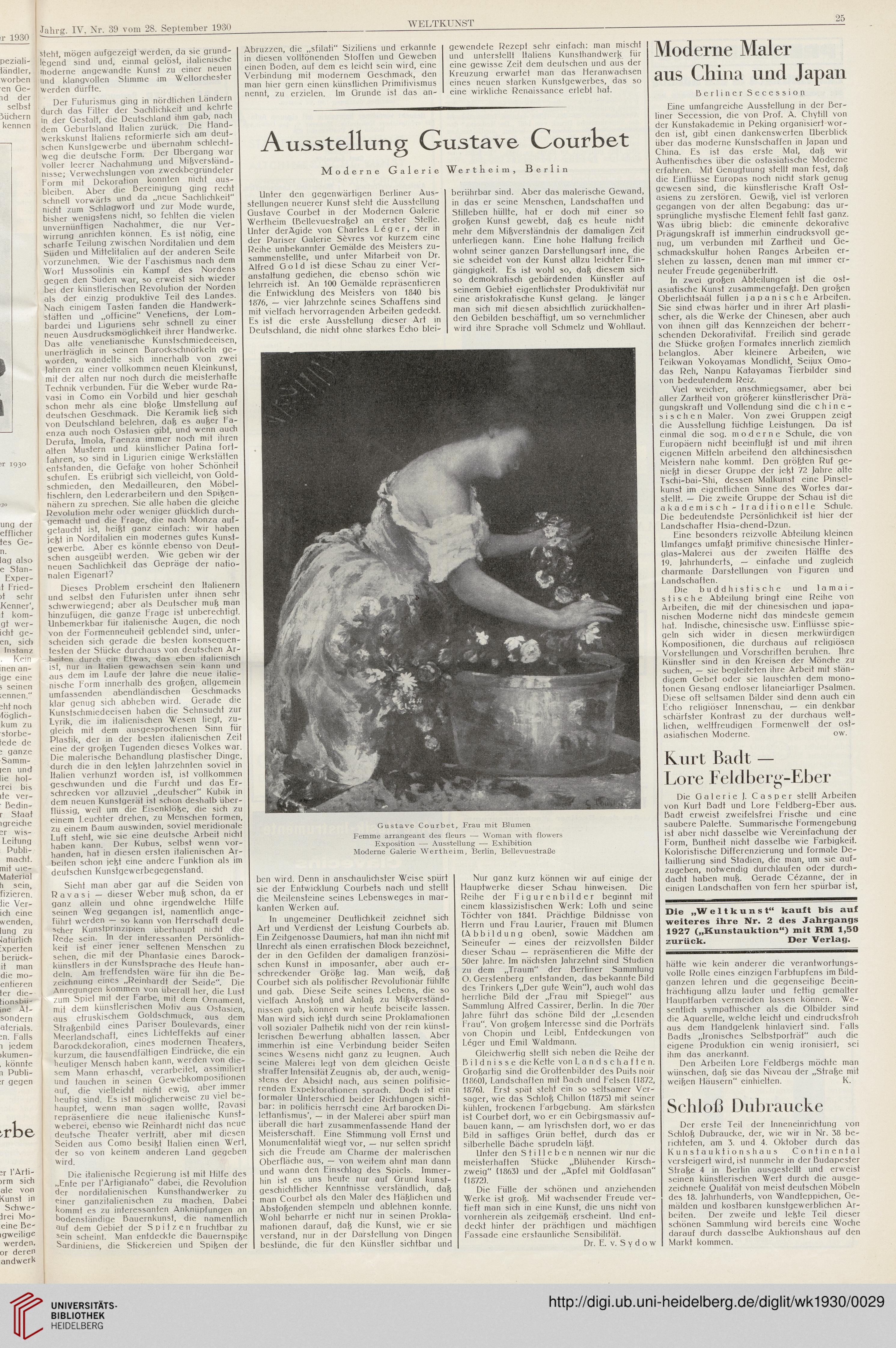>r 1930
Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930
WELTKUNST
25
peziali-
iändler,
worben
en Ge-
ld der
selbst
Jüchern
kennen
>
i
;r 1930
130
ung der
efflicher
tes Ge-
rn
lag also
e Stan-
Exper-
it Fried-
>t sehr
Kenner',
t kom- |
gt wer- :
icht ge- I
en, sich
Instanz
Kein
inen an-
ige eine *
s seinen
tennen."
iht noch
/löglich-
kum zu
storbe-
lede de
: ganze
Samm-
ien und |
lie hol-
:rei bis
ite ver- |
■ Bedin- |
r Staat
igreiche |
er wis-
Leitung
Publi-
macht.
mit uie-
Material
h sein,
fizieren.
iie Ver- j
ich eine
wenden, !
lung zu
Natürlich
ixperten .
berück-
st man
die mo- '
entieren
ter die- I
fionsbü-
ine At-
sondern j
aterials. |
in. Falls i
i jedem i
>kumen- i
, könnte
i Publi- |
:r gegen
er l’Arli-
>rm sich
ale von
Kunst in
Schwe-
irei Mo-
eine Be-
igweilige
werden,
or deren
andwerk
steht, mögen aufgezeigt werden, da sie grund-
legend sind und, einmal gelöst, italienische
moderne angewandte Kunst zu einer neuen
Und klangvollen Stimme im Weltorchester
Werden dürfte.
Der Futurismus ging in nördlichen Ländern
durch das Filter der Sachlichkeit und kehrte
in der Gestalt, die Deutschland ihm gab, nach
dem Geburtsland Italien zurück. Die Hand-
werkskunst Italiens reformierte sich am deut-
schen Kunsigewerbe und übernahm schlecht-
weg die deutsche Form. Der Übergang war
voller leerer Nachahmung und Mißverständ-
nisse; Verwechslungen von zweckbegründeter
Form’ mit Dekoration konnten nicht aus-
bleiben. Aber die Bereinigung ging recht
schnell vorwärts und da „neue Sachlichkeit“
nicht zum Schlagwort und zur Mode wurde,
bisher wenigstens nicht, so fehlten die vielen
unvernünftigen Nachahmer, die nur Ver-
wirrung anrichfen können. Es ist nötig, eine
scharfe Teilung zwischen Norditalien und dem
Süden und Mittelitalien auf der anderen Seite
vorzunehmen. Wie der Faschismus nach dem
Wort Mussolinis ein Kampf des Nordens
gegen den Süden war, so erweist sich wieder
bei der künstlerischen Revolution der Norden
als der einzig produktive Teil des Landes.
Nach einigem Tasten fanden die Handwerk-
stätten und „officine“ Venetiens, der Lom-
bardei und Liguriens sehr schnell zu einer
neuen Ausdrucksmöghchkeil ihrer Handwerke.
Das alte veneiianische Kunstschmiedeeisen,
unerträglich in seinen Barockschnörkeln ge-
worden, wandelte sich innerhalb von zwei
Jahren zu einer vollkommen neuen Kleinkunst,
mit der alten nur noch durch die meisterhafte
Technik verbunden. Für die Weber wurde Ra-
vasi in Como ein Vorbild und hier geschah
schon mehr als eine bloße Umstellung auf
deutschen Geschmack. Die Keramik ließ sich
von Deutschland belehren, daß es außer Fa-
enza auch noch Ostasien gibt, und wenn auch
Deruta, Imola, Faenza immer noch mit ihren
alten Mustern und künstlicher Patina fort-
fahren, so sind in Ligurien einige Werkstätten
entstanden, die Gefäße von hoher Schönheit
schufen. Es erübrigt sich vielleicht, von Gold-
schmieden, den Medailleuren, den Möbel-
tischlern, den Lederarbeitern und den Spißen-
nähern zu sprechen. Sie alle haben die gleiche
Revolution mehr oder weniger glücklich durch-
gemacht und die Frage, die nach Monza auf-
getaucht ist, heißt ganz einfach: wir haben
jeßt in Norditalien ein modernes gutes Kunst-
gewerbe. Aber es könnte ebenso von Deut-
schen ausgeübt werden. Wie geben wir der
neuen Sachlichkeit das Gepräge der natio-
nalen Eigenart?
Dieses Problem erscheint den Italienern
und selbst den Futuristen unter ihnen sehr
schwerwiegend; aber als Deutscher muß man
hinzufügen, die ganze Frage ist unberechtigt.
Llnbemerkbar für italienische Augen, die noch
von der Formenneuheit geblendet sind, unter-
scheiden sich gerade die besten konseguen-
testen der Stücke durchaus von deutschen Ar-
beiten durch ein Etwas, das eben italienisch
ist, nur in Italien gewachsen sein kann und
aus dem im Laufe der Jahre die neue italie-
nische Form innerhalb des großen, allgemein
umfassenden abendländischen Geschmacks
klar genug sich abheben wird. Gerade die
Kunstschmiedeeisen haben die Sehnsucht zur
Lyrik, die im italienischen Wesen liegt, zu-
gleich mit dem ausgesprochenen Sinn für
Plastik, der in der besten italienischen Zeit
eine der großen Tugenden dieses Volkes war.
Die malerische Behandlung plastischer Dinge,
durch die in den leßten Jahrzehnten soviel in
Italien verhunzt worden ist, ist vollkommen
geschwunden und die Furcht und das Er-
schrecken vor allzuviel „deutscher“ Kubik in
dem neuen Kunstgerät ist schon deshalb über-
flüssig, weil um die Eisenklöße, die sich zu
einem Leuchter drehen, zu Menschen formen,
zu einem Baum auswinden, soviel meridionale
Luft steht, wie sie eine deutsche Arbeit nicht
haben kann. Der Kubus, selbst wenn vor-
handen, hat in diesen ersten italienischen Ar-
beiten schon jeßt eine andere Funktion als im
deutschen Kunstgewerbegegenstand.
Sieht man aber gar auf die Seiden von
Ravasi — dieser Weber muß schon, da er
ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe
seinen Weg gegangen ist, namentlich ange-
führt werden — so kann von Herrschaft deut-
scher Kunstprinzipien überhaupt nicht die
Rede sein. In der interessanten Persönlich-
keit ist einer jener seltenen Menschen zu
sehen, die mit der Phantasie eines Barock-
künstlers in der Kunstsprache des Heute han-
deln. Am treffendsten wäre für ihn die Be-
zeichnung eines „Reinhardt der Seide“. Die
Anregungen kommen von überall her, die Lust
zum Spiel mit der Farbe, mil dem Ornament
mit dem künstlerischen Motiv aus Ostasien’
aus etruskischem Goldschmuck, aus dem
Straßenbild eines Pariser Boulevards, einer
Meerlandschaft, eines Lichteffekts auf einer
Barockdekoration, eines modernen Theaters,
kurzum, die tausendfältigen Eindrücke, die ein
heutiger Mensch haben kann, werden von die-
sem Mann erhascht, verarbeitet, assimiliert
und tauchen in seinen Gewebkomposiiionen
auf, die vielleicht nicht ewig, aber immer
heutig sind. Es ist möglicherweise zu viel be-
hauptet, wenn man sagen wollte, Ravasi
repräsentiere die neue italienische Kunst-
weberei, ebenso wie Reinhardt nicht das neue
deutsche Theater vertritt, aber mit diesen
Seiden aus Como besißt Italien einen Wert,
der so von keinem anderen Land gegeben
wird.
Die italienische Regierung ist mit Hilfe des
„Ente per I’Artigianato“ dabei, die Revolution
der norditalienischen Kunsthandwerker zu
einer ganziialienischen zu machen. Dabei
kommt es zu interessanten Anknüpfungen an
bodenständige Bauernkunst, die namentlich
auf dem Gebiet der Spitzen fruchtbar zu
sein scheint. Man entdeckte die Bauernspiße
Sardiniens, die Stickereien und Spißen der
Abruzzen, die „sfilati“ Siziliens und erkannte
in diesen volltönenden Stoffen und Geweben
einen Boden, auf dem es leicht sein wird, eine
Verbindung mit modernem Geschmack, den
man hier gern einen künstlichen Primitivismus
nennt, zu erzielen. Im Grunde ist das an-
gewendete Rezept sehr einfach: man mischt
und unterstellt Italiens Kunsihandwerß für
eine gewisse Zeit dem deutschen und aus der
Kreuzung erwartet man das Heranwachsen
eines neuen starken Kunstgewerbes, das so
eine wirkliche Renaissance erlebt hat.
Ausstellung Gustave Courbet
Moderne Galerie Wert keim ,
Berlin
Unter den gegenwärtigen Berliner Aus-
stellungen neuerer Kunst steht die Ausstellung
Gustave Courbet in der Modernen Galerie
Wertheim (Bellevuestraße) an erster Stelle.
Unter derÄgide von Charles Leger, der in
der Pariser Galerie Sevres vor kurzem eine
Reihe unbekannter Gemälde des Meisters zu-
sammenstellte, und unter Mitarbeit von Dr.
Alfred Gold ist diese Schau zu einer Ver-
anstaltung gediehen, die ebenso schön wie
lehrreich ist. An 100 Gemälde repräsentieren
die Entwicklung des Meisters von 1840 bis
1876, — vier Jahrzehnte seines Schaffens sind
mit vielfach hervorragenden Arbeiten gedeckt.
Es ist die erste Ausstellung dieser Art in
Deutschland, die nicht ohne starkes Echo blei-
beriihrbar sind. Aber das malerische Gewand,
in das er seine Menschen, Landschaften und
Stilleben hüllte, hat er doch mit einer so
großen Kunst gewebt, daß es heute nicht
mehr dem Mißverständnis der damaligen Zeit
unterliegen kann. Eine hohe Haltung freilich
wohnt seiner ganzen Darstellungsart inne, die
sie scheidet von der Kunst allzu leichter Ein-
gängigkeit. Es ist wohl so, daß diesem sich
so demokratisch gebärdenden Künstler auf
seinem Gebiet eigentlichster Produktivität nur
eine aristokratische Kunst gelang. Je länger
man sich mit diesen absichtlich zurückhalten-
den Gebilden beschäftigt, um so vernehmlicher
wird ihre Sprache voll Schmelz und Wohllaut.
Gustave Courbet, Frau mit Blumen
Femme arrangeant des fleurs — Woman with flowers
Exposition — Ausstellung — Exhibition
Moderne Galerie Wertheim, Berlin, Bellevuestraße
ben wird. Denn in anschaulichster Weise spürt
sie der Entwicklung Courbets nach und stellt
die Meilensteine seines Lebensweges in mar-
kanten Werken auf.
In ungemeiner Deutlichkeit zeichnet sich
Art und Verdienst der Leistung Courbets ab.
Ein Zeitgenosse Daumiers, hat man ihn nicht mit
Unrecht als einen erratischen Block bezeichnet,
der in den Gefilden der damaligen französi-
schen Kunst in imposanter, aber auch er-
schreckender Größe lag. Man weiß, daß
Courbet sich als politischer Revolutionär fühlte
und gab. Diese Seite seines Lebens, die so
vielfach Anstoß und Anlaß zu Mißverständ-
nissen gab, können wir heute beiseite lassen.
Man wird sich jeßt durch seine Proklamationen
voll sozialer Pathetik nicht von der rein künst-
lerischen Bewertung abhalten lassen. Aber
immerhin ist eine Verbindung beider Seiten
seines Wesens nicht ganz zu leugnen. Auch
seine Malerei legt von dem gleichen Geiste
straffer Intensität Zeugnis ab, der auch , wenig-
stens der Absicht nach, aus seinen politisie-
renden Expektorationen sprach. Doch ist ein
formaler Unterschied beider Richtungen sicht-
bar: in politicis herrscht eine Art barocken Di-
lettantismus’, — in der Malerei aber spürt man
überall die hart zusammenfassende Hand der
Meisterschaft. Eine Stimmung voll Ernst und
Monumentalität wiegt vor, — nur selten spricht
sich die Freude am Charme der malerischen
Oberfläche aus, — von weitem ahnt man dann
und wann den Einschlag des Spiels. Immer-
hin ist es uns heute nur auf Grund kunst-
geschichtlicher Kenntnisse verständlich, daß
man Courbet als den Maler des Häßlichen und
Abstoßenden stempeln und ablehnen konnte.
Wohl beharrte er nicht nur in seinen Prokla-
mationen darauf, daß die Kunst, wie er sie
verstand, nur in der Darstellung von Dingen
bestünde, die für den Künstler sichtbar und
Nur ganz kurz können wir auf einige der
Hauptwerke dieser Schau hinweisen. Die
Reihe der Figurenbilder beginnt mit
einem klassizistischen Werk: Loth und seine
Töchter von 1841. Prächtige Bildnisse von
Herrn und Frau Laurier, Frauen mit Blumen
(Abbildung oben), sowie Mädchen am
Seineufer ~ eines der reizvollsten Bilder
dieser Schau — repräsentieren die Mitte der
50er Jahre. Im nächsten Jahrzehnt sind Studien
zu dem „Traum" der Berliner Sammlung
O. Gersienberg entstanden, das bekannte Bild
des Trinkers („Der gute Wein“), auch wohl das
herrliche Bild der „Frau mit Spiegel“ aus
Sammlung Alfred Cassirer, Berlin. In die 70er
Jahre führt das schöne Bild der „Lesenden
Frau“. Von großem Interesse sind die Porträts
von Chopin und Leibi, Entdeckungen von
Leger und Emil Waldmann.
Gleichwertig stellt sich neben die Reihe der
Bildnisse die Kette von Landschaften.
Großartig sind die Grottenbilder des Puifs noir
(1860), Landschaften mit Bach und Felsen (1872,
1876). Erst spät steht ein so seltsamer Ver-
sager, wie das Schloß Chillon (1875) mit seiner
kühlen, trockenen Farbgebung. Am stärksten
ist Courbet dort, wo er ein Gebirgsmassiv auf-
bauen kann, — am lyrischsten dort, wo er das
Bild in saftiges Grün bettet, durch das er
silberhelle Bäche sprudeln läßt.
Unter den S t i 11 e b e n nennen wir nur die
meisterhaften Stücke „Blühender Kirsch-
zweig“ (1863) und der ,Apfel mit Goldfasan“
(1872).
Die Fülle der schönen und anziehenden
Werke ist groß. Mit wachsender Freude ver-
tieft man sich in eine Kunst, die uns nicht von
vornherein als zeitgemäß erscheint. Und ent-
deckt hinter der prächtigen und mächtigen
Fassade eine erstaunliche Sensibilität.
Dr. E. v. S y d o w
Moderne Maler
aus China und Japan
Berliner Secession
Eine umfangreiche Ausstellung in der Ber-
liner Secession, die von Prof. A. Chytill von
der Kunstakademie in Peking organisiert wor-
den ist, gibt einen dankenswerten Überblick
über das moderne Kunstschaffen in Japan und
China. Es ist das erste Mal, daß wir
Authentisches über die ostasiatische Moderne
erfahren. Mit Genugtuung stellt man fest, daß
die Einflüsse Europas noch nicht stark genug
gewesen sind, die künstlerische Kraft Ost-
asiens zu zerstören. Gewiß, viel ist verloren
gegangen von der alten Begabung: das ur-
sprüngliche mystische Element fehlt fast ganz.
Was übrig blieb: die eminente dekorative
Prägungskraft ist immerhin eindrucksvoll ge-
nug, um verbunden mit Zartheit und Ge-
schmackskultur hohen Ranges Arbeiten er-
stehen zu lassen, denen man mit immer er-
neuter Freude gegenübertritt.
In zwei großen Abteilungen ist die ost-
asiatische Kunst zusammengefaßt. Den großen
Oberlichtsaäl füllen japanische Arbeiten.
Sie sind etwas härter und in ihrer Art plasti-
scher, als die Werke der Chinesen, aber auch
von ihnen gilt das Kennzeichen der beherr-
schenden Dekorativität. Freilich sind gerade
die Stücke großen Formates innerlich ziemlich
belanglos. Aber kleinere Arbeiten, wie
Teikwan Yokoyamas Mondlicht, Seijux Omo-
das Reh, Nanpu Katayamas Tierbilder sind
von bedeutendem Reiz.
Viel weicher, anschmiegsamer, aber bei
aller Zartheit von größerer künstlerischer Prä-
gungskraft und Vollendung sind die chine-
sischen Maler. Von zwei Gruppen zeigt
die Ausstellung tüchtige Leistungen. Da ist
einmal die sog. moderne Schule, die von
Europäern nicht beeinflußt ist und mit ihren
eigenen Mitteln arbeitend den altchinesischen
Meistern nahe kommt. Den größten Ruf ge-
nießt in dieser Gruppe der jeßt 72 Jahre alle
Tschi-bai-Shi, dessen Malkunst eine Pinsel-
kunst im eigentlichen Sinne des Wortes dar-
stellt. — Die zweite Gruppe der Schau ist die
akademisch - traditionelle Schule.
Die bedeutendste Persönlichkeit list hier der
Landschafter Hsia-chend-Dzun.
Eine besonders reizvolle Abteilung kleinen
Umfanges umfaßt primitive chinesische Hinter-
glas-Malerei aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, — einfache und zugleich
charmante Darstellungen von Figuren und
Landschaften.
Die buddhistische und lamai-
stische Abteilung bringt eine Reihe von
Arbeiten, die mit der chinesischen und japa-
nischen Moderne nicht das mindeste gemein
hat. Indische, chinesische usw. Einflüsse spie-
geln sich wider in diesen merkwürdigen
Kompositionen, die durchaus auf religiösen
Vorstellungen und Vorschriften beruhen. Ihre
Künstler sind in den Kreisen der Mönche zu
suchen, — sie begleiteten ihre Arbeit mit stän-
digem Gebet oder sie lauschten dem mono-
tonen Gesang endloser litaneiartiger Psalmen.
Diese oft seltsamen Bilder sind denn auch ein
Echo religiöser Innenschau, — ein denkbar
schärfster Kontrast zu der durchaus welt-
lichen, weltfreudigen Formenwelt der ost-
asiatischen Moderne. ow.
Kurt Badt —
Lore Feldherr-Eber
Die Galerie J. Casper stellt Arbeiten
von Kurt Badt und Lore Feldberg-Eber aus.
Badt erweist zweifelsfrei Frische und eine
saubere Palette. Summarische Formengebung
ist aber nicht dasselbe wie Vereinfachung der
Form, Buntheit nicht dasselbe wie Farbigkeit.
Koloristische Differenzierung und formale De-
taillierung sind Stadien, die man, um sie auf-
zugeben, notwendig durchlaufen oder durch-
dacht haben muß. Gerade Cezanne, der in
einigen Landschaften von fern her spürbar ist,
Die „W eit kuns t“ kauft bis auf
weiteres ihre Nr. 2 des Jahrgangs
1927 („Kunstauktion“) mit RM 1,50
zurück. Der Verlag.
hätte wie kein anderer die verantwortungs-
volle Rolle eines einzigen Farbtupfens im Bild-
ganzen lehren und die gegenseitige Beein-
trächtigung allzu lauter und fettig gemalter
Hauptfarben vermeiden lassen können. We-
sentlich sympathischer als die Ölbilder sind
die Aguarelle, welche leicht und eindrucksfroh
aus dem Handgelenk hinlaviert sind. Falls
Badts „Ironisches Selbstporträt“ auch die
eigene Produktion ein wenig ironisiert, sei
ihm das anerkannt.
Den Arbeiten Lore Feldbergs möchte man
wünschen, daß sie das Niveau der „Straße mit
weißen Häusern“ einhielten. K.
Schloß Dubraucke
Der erste Teil der Inneneinrichtung von
Schloß Dubraucke, der, wie wir in Nr. 38 be-
richteten, am 3. und 4. Oktober durch das
K u n s t a u k t i o n s h a u s Continental
versteigert wird, ist nunmehr in der Budapester
Straße 4 in Berlin ausgestellt und erweist
seinen künstlerischen Wert durch die ausge-
zeichnete Qualität von meist deutschen Möbeln
des 18. Jahrhunderts, von Wandteppichen, Ge-
mälden und kostbaren kunstgewerblichen Ar-
beiten. Der zweite und leßte Teil dieser
schönen Sammlung wird bereits eine Woche
darauf durch dasselbe Aukfionshaus auf den
Markt kommen.
Jahrg. IV, Nr. 39 vom 28. September 1930
WELTKUNST
25
peziali-
iändler,
worben
en Ge-
ld der
selbst
Jüchern
kennen
>
i
;r 1930
130
ung der
efflicher
tes Ge-
rn
lag also
e Stan-
Exper-
it Fried-
>t sehr
Kenner',
t kom- |
gt wer- :
icht ge- I
en, sich
Instanz
Kein
inen an-
ige eine *
s seinen
tennen."
iht noch
/löglich-
kum zu
storbe-
lede de
: ganze
Samm-
ien und |
lie hol-
:rei bis
ite ver- |
■ Bedin- |
r Staat
igreiche |
er wis-
Leitung
Publi-
macht.
mit uie-
Material
h sein,
fizieren.
iie Ver- j
ich eine
wenden, !
lung zu
Natürlich
ixperten .
berück-
st man
die mo- '
entieren
ter die- I
fionsbü-
ine At-
sondern j
aterials. |
in. Falls i
i jedem i
>kumen- i
, könnte
i Publi- |
:r gegen
er l’Arli-
>rm sich
ale von
Kunst in
Schwe-
irei Mo-
eine Be-
igweilige
werden,
or deren
andwerk
steht, mögen aufgezeigt werden, da sie grund-
legend sind und, einmal gelöst, italienische
moderne angewandte Kunst zu einer neuen
Und klangvollen Stimme im Weltorchester
Werden dürfte.
Der Futurismus ging in nördlichen Ländern
durch das Filter der Sachlichkeit und kehrte
in der Gestalt, die Deutschland ihm gab, nach
dem Geburtsland Italien zurück. Die Hand-
werkskunst Italiens reformierte sich am deut-
schen Kunsigewerbe und übernahm schlecht-
weg die deutsche Form. Der Übergang war
voller leerer Nachahmung und Mißverständ-
nisse; Verwechslungen von zweckbegründeter
Form’ mit Dekoration konnten nicht aus-
bleiben. Aber die Bereinigung ging recht
schnell vorwärts und da „neue Sachlichkeit“
nicht zum Schlagwort und zur Mode wurde,
bisher wenigstens nicht, so fehlten die vielen
unvernünftigen Nachahmer, die nur Ver-
wirrung anrichfen können. Es ist nötig, eine
scharfe Teilung zwischen Norditalien und dem
Süden und Mittelitalien auf der anderen Seite
vorzunehmen. Wie der Faschismus nach dem
Wort Mussolinis ein Kampf des Nordens
gegen den Süden war, so erweist sich wieder
bei der künstlerischen Revolution der Norden
als der einzig produktive Teil des Landes.
Nach einigem Tasten fanden die Handwerk-
stätten und „officine“ Venetiens, der Lom-
bardei und Liguriens sehr schnell zu einer
neuen Ausdrucksmöghchkeil ihrer Handwerke.
Das alte veneiianische Kunstschmiedeeisen,
unerträglich in seinen Barockschnörkeln ge-
worden, wandelte sich innerhalb von zwei
Jahren zu einer vollkommen neuen Kleinkunst,
mit der alten nur noch durch die meisterhafte
Technik verbunden. Für die Weber wurde Ra-
vasi in Como ein Vorbild und hier geschah
schon mehr als eine bloße Umstellung auf
deutschen Geschmack. Die Keramik ließ sich
von Deutschland belehren, daß es außer Fa-
enza auch noch Ostasien gibt, und wenn auch
Deruta, Imola, Faenza immer noch mit ihren
alten Mustern und künstlicher Patina fort-
fahren, so sind in Ligurien einige Werkstätten
entstanden, die Gefäße von hoher Schönheit
schufen. Es erübrigt sich vielleicht, von Gold-
schmieden, den Medailleuren, den Möbel-
tischlern, den Lederarbeitern und den Spißen-
nähern zu sprechen. Sie alle haben die gleiche
Revolution mehr oder weniger glücklich durch-
gemacht und die Frage, die nach Monza auf-
getaucht ist, heißt ganz einfach: wir haben
jeßt in Norditalien ein modernes gutes Kunst-
gewerbe. Aber es könnte ebenso von Deut-
schen ausgeübt werden. Wie geben wir der
neuen Sachlichkeit das Gepräge der natio-
nalen Eigenart?
Dieses Problem erscheint den Italienern
und selbst den Futuristen unter ihnen sehr
schwerwiegend; aber als Deutscher muß man
hinzufügen, die ganze Frage ist unberechtigt.
Llnbemerkbar für italienische Augen, die noch
von der Formenneuheit geblendet sind, unter-
scheiden sich gerade die besten konseguen-
testen der Stücke durchaus von deutschen Ar-
beiten durch ein Etwas, das eben italienisch
ist, nur in Italien gewachsen sein kann und
aus dem im Laufe der Jahre die neue italie-
nische Form innerhalb des großen, allgemein
umfassenden abendländischen Geschmacks
klar genug sich abheben wird. Gerade die
Kunstschmiedeeisen haben die Sehnsucht zur
Lyrik, die im italienischen Wesen liegt, zu-
gleich mit dem ausgesprochenen Sinn für
Plastik, der in der besten italienischen Zeit
eine der großen Tugenden dieses Volkes war.
Die malerische Behandlung plastischer Dinge,
durch die in den leßten Jahrzehnten soviel in
Italien verhunzt worden ist, ist vollkommen
geschwunden und die Furcht und das Er-
schrecken vor allzuviel „deutscher“ Kubik in
dem neuen Kunstgerät ist schon deshalb über-
flüssig, weil um die Eisenklöße, die sich zu
einem Leuchter drehen, zu Menschen formen,
zu einem Baum auswinden, soviel meridionale
Luft steht, wie sie eine deutsche Arbeit nicht
haben kann. Der Kubus, selbst wenn vor-
handen, hat in diesen ersten italienischen Ar-
beiten schon jeßt eine andere Funktion als im
deutschen Kunstgewerbegegenstand.
Sieht man aber gar auf die Seiden von
Ravasi — dieser Weber muß schon, da er
ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe
seinen Weg gegangen ist, namentlich ange-
führt werden — so kann von Herrschaft deut-
scher Kunstprinzipien überhaupt nicht die
Rede sein. In der interessanten Persönlich-
keit ist einer jener seltenen Menschen zu
sehen, die mit der Phantasie eines Barock-
künstlers in der Kunstsprache des Heute han-
deln. Am treffendsten wäre für ihn die Be-
zeichnung eines „Reinhardt der Seide“. Die
Anregungen kommen von überall her, die Lust
zum Spiel mit der Farbe, mil dem Ornament
mit dem künstlerischen Motiv aus Ostasien’
aus etruskischem Goldschmuck, aus dem
Straßenbild eines Pariser Boulevards, einer
Meerlandschaft, eines Lichteffekts auf einer
Barockdekoration, eines modernen Theaters,
kurzum, die tausendfältigen Eindrücke, die ein
heutiger Mensch haben kann, werden von die-
sem Mann erhascht, verarbeitet, assimiliert
und tauchen in seinen Gewebkomposiiionen
auf, die vielleicht nicht ewig, aber immer
heutig sind. Es ist möglicherweise zu viel be-
hauptet, wenn man sagen wollte, Ravasi
repräsentiere die neue italienische Kunst-
weberei, ebenso wie Reinhardt nicht das neue
deutsche Theater vertritt, aber mit diesen
Seiden aus Como besißt Italien einen Wert,
der so von keinem anderen Land gegeben
wird.
Die italienische Regierung ist mit Hilfe des
„Ente per I’Artigianato“ dabei, die Revolution
der norditalienischen Kunsthandwerker zu
einer ganziialienischen zu machen. Dabei
kommt es zu interessanten Anknüpfungen an
bodenständige Bauernkunst, die namentlich
auf dem Gebiet der Spitzen fruchtbar zu
sein scheint. Man entdeckte die Bauernspiße
Sardiniens, die Stickereien und Spißen der
Abruzzen, die „sfilati“ Siziliens und erkannte
in diesen volltönenden Stoffen und Geweben
einen Boden, auf dem es leicht sein wird, eine
Verbindung mit modernem Geschmack, den
man hier gern einen künstlichen Primitivismus
nennt, zu erzielen. Im Grunde ist das an-
gewendete Rezept sehr einfach: man mischt
und unterstellt Italiens Kunsihandwerß für
eine gewisse Zeit dem deutschen und aus der
Kreuzung erwartet man das Heranwachsen
eines neuen starken Kunstgewerbes, das so
eine wirkliche Renaissance erlebt hat.
Ausstellung Gustave Courbet
Moderne Galerie Wert keim ,
Berlin
Unter den gegenwärtigen Berliner Aus-
stellungen neuerer Kunst steht die Ausstellung
Gustave Courbet in der Modernen Galerie
Wertheim (Bellevuestraße) an erster Stelle.
Unter derÄgide von Charles Leger, der in
der Pariser Galerie Sevres vor kurzem eine
Reihe unbekannter Gemälde des Meisters zu-
sammenstellte, und unter Mitarbeit von Dr.
Alfred Gold ist diese Schau zu einer Ver-
anstaltung gediehen, die ebenso schön wie
lehrreich ist. An 100 Gemälde repräsentieren
die Entwicklung des Meisters von 1840 bis
1876, — vier Jahrzehnte seines Schaffens sind
mit vielfach hervorragenden Arbeiten gedeckt.
Es ist die erste Ausstellung dieser Art in
Deutschland, die nicht ohne starkes Echo blei-
beriihrbar sind. Aber das malerische Gewand,
in das er seine Menschen, Landschaften und
Stilleben hüllte, hat er doch mit einer so
großen Kunst gewebt, daß es heute nicht
mehr dem Mißverständnis der damaligen Zeit
unterliegen kann. Eine hohe Haltung freilich
wohnt seiner ganzen Darstellungsart inne, die
sie scheidet von der Kunst allzu leichter Ein-
gängigkeit. Es ist wohl so, daß diesem sich
so demokratisch gebärdenden Künstler auf
seinem Gebiet eigentlichster Produktivität nur
eine aristokratische Kunst gelang. Je länger
man sich mit diesen absichtlich zurückhalten-
den Gebilden beschäftigt, um so vernehmlicher
wird ihre Sprache voll Schmelz und Wohllaut.
Gustave Courbet, Frau mit Blumen
Femme arrangeant des fleurs — Woman with flowers
Exposition — Ausstellung — Exhibition
Moderne Galerie Wertheim, Berlin, Bellevuestraße
ben wird. Denn in anschaulichster Weise spürt
sie der Entwicklung Courbets nach und stellt
die Meilensteine seines Lebensweges in mar-
kanten Werken auf.
In ungemeiner Deutlichkeit zeichnet sich
Art und Verdienst der Leistung Courbets ab.
Ein Zeitgenosse Daumiers, hat man ihn nicht mit
Unrecht als einen erratischen Block bezeichnet,
der in den Gefilden der damaligen französi-
schen Kunst in imposanter, aber auch er-
schreckender Größe lag. Man weiß, daß
Courbet sich als politischer Revolutionär fühlte
und gab. Diese Seite seines Lebens, die so
vielfach Anstoß und Anlaß zu Mißverständ-
nissen gab, können wir heute beiseite lassen.
Man wird sich jeßt durch seine Proklamationen
voll sozialer Pathetik nicht von der rein künst-
lerischen Bewertung abhalten lassen. Aber
immerhin ist eine Verbindung beider Seiten
seines Wesens nicht ganz zu leugnen. Auch
seine Malerei legt von dem gleichen Geiste
straffer Intensität Zeugnis ab, der auch , wenig-
stens der Absicht nach, aus seinen politisie-
renden Expektorationen sprach. Doch ist ein
formaler Unterschied beider Richtungen sicht-
bar: in politicis herrscht eine Art barocken Di-
lettantismus’, — in der Malerei aber spürt man
überall die hart zusammenfassende Hand der
Meisterschaft. Eine Stimmung voll Ernst und
Monumentalität wiegt vor, — nur selten spricht
sich die Freude am Charme der malerischen
Oberfläche aus, — von weitem ahnt man dann
und wann den Einschlag des Spiels. Immer-
hin ist es uns heute nur auf Grund kunst-
geschichtlicher Kenntnisse verständlich, daß
man Courbet als den Maler des Häßlichen und
Abstoßenden stempeln und ablehnen konnte.
Wohl beharrte er nicht nur in seinen Prokla-
mationen darauf, daß die Kunst, wie er sie
verstand, nur in der Darstellung von Dingen
bestünde, die für den Künstler sichtbar und
Nur ganz kurz können wir auf einige der
Hauptwerke dieser Schau hinweisen. Die
Reihe der Figurenbilder beginnt mit
einem klassizistischen Werk: Loth und seine
Töchter von 1841. Prächtige Bildnisse von
Herrn und Frau Laurier, Frauen mit Blumen
(Abbildung oben), sowie Mädchen am
Seineufer ~ eines der reizvollsten Bilder
dieser Schau — repräsentieren die Mitte der
50er Jahre. Im nächsten Jahrzehnt sind Studien
zu dem „Traum" der Berliner Sammlung
O. Gersienberg entstanden, das bekannte Bild
des Trinkers („Der gute Wein“), auch wohl das
herrliche Bild der „Frau mit Spiegel“ aus
Sammlung Alfred Cassirer, Berlin. In die 70er
Jahre führt das schöne Bild der „Lesenden
Frau“. Von großem Interesse sind die Porträts
von Chopin und Leibi, Entdeckungen von
Leger und Emil Waldmann.
Gleichwertig stellt sich neben die Reihe der
Bildnisse die Kette von Landschaften.
Großartig sind die Grottenbilder des Puifs noir
(1860), Landschaften mit Bach und Felsen (1872,
1876). Erst spät steht ein so seltsamer Ver-
sager, wie das Schloß Chillon (1875) mit seiner
kühlen, trockenen Farbgebung. Am stärksten
ist Courbet dort, wo er ein Gebirgsmassiv auf-
bauen kann, — am lyrischsten dort, wo er das
Bild in saftiges Grün bettet, durch das er
silberhelle Bäche sprudeln läßt.
Unter den S t i 11 e b e n nennen wir nur die
meisterhaften Stücke „Blühender Kirsch-
zweig“ (1863) und der ,Apfel mit Goldfasan“
(1872).
Die Fülle der schönen und anziehenden
Werke ist groß. Mit wachsender Freude ver-
tieft man sich in eine Kunst, die uns nicht von
vornherein als zeitgemäß erscheint. Und ent-
deckt hinter der prächtigen und mächtigen
Fassade eine erstaunliche Sensibilität.
Dr. E. v. S y d o w
Moderne Maler
aus China und Japan
Berliner Secession
Eine umfangreiche Ausstellung in der Ber-
liner Secession, die von Prof. A. Chytill von
der Kunstakademie in Peking organisiert wor-
den ist, gibt einen dankenswerten Überblick
über das moderne Kunstschaffen in Japan und
China. Es ist das erste Mal, daß wir
Authentisches über die ostasiatische Moderne
erfahren. Mit Genugtuung stellt man fest, daß
die Einflüsse Europas noch nicht stark genug
gewesen sind, die künstlerische Kraft Ost-
asiens zu zerstören. Gewiß, viel ist verloren
gegangen von der alten Begabung: das ur-
sprüngliche mystische Element fehlt fast ganz.
Was übrig blieb: die eminente dekorative
Prägungskraft ist immerhin eindrucksvoll ge-
nug, um verbunden mit Zartheit und Ge-
schmackskultur hohen Ranges Arbeiten er-
stehen zu lassen, denen man mit immer er-
neuter Freude gegenübertritt.
In zwei großen Abteilungen ist die ost-
asiatische Kunst zusammengefaßt. Den großen
Oberlichtsaäl füllen japanische Arbeiten.
Sie sind etwas härter und in ihrer Art plasti-
scher, als die Werke der Chinesen, aber auch
von ihnen gilt das Kennzeichen der beherr-
schenden Dekorativität. Freilich sind gerade
die Stücke großen Formates innerlich ziemlich
belanglos. Aber kleinere Arbeiten, wie
Teikwan Yokoyamas Mondlicht, Seijux Omo-
das Reh, Nanpu Katayamas Tierbilder sind
von bedeutendem Reiz.
Viel weicher, anschmiegsamer, aber bei
aller Zartheit von größerer künstlerischer Prä-
gungskraft und Vollendung sind die chine-
sischen Maler. Von zwei Gruppen zeigt
die Ausstellung tüchtige Leistungen. Da ist
einmal die sog. moderne Schule, die von
Europäern nicht beeinflußt ist und mit ihren
eigenen Mitteln arbeitend den altchinesischen
Meistern nahe kommt. Den größten Ruf ge-
nießt in dieser Gruppe der jeßt 72 Jahre alle
Tschi-bai-Shi, dessen Malkunst eine Pinsel-
kunst im eigentlichen Sinne des Wortes dar-
stellt. — Die zweite Gruppe der Schau ist die
akademisch - traditionelle Schule.
Die bedeutendste Persönlichkeit list hier der
Landschafter Hsia-chend-Dzun.
Eine besonders reizvolle Abteilung kleinen
Umfanges umfaßt primitive chinesische Hinter-
glas-Malerei aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, — einfache und zugleich
charmante Darstellungen von Figuren und
Landschaften.
Die buddhistische und lamai-
stische Abteilung bringt eine Reihe von
Arbeiten, die mit der chinesischen und japa-
nischen Moderne nicht das mindeste gemein
hat. Indische, chinesische usw. Einflüsse spie-
geln sich wider in diesen merkwürdigen
Kompositionen, die durchaus auf religiösen
Vorstellungen und Vorschriften beruhen. Ihre
Künstler sind in den Kreisen der Mönche zu
suchen, — sie begleiteten ihre Arbeit mit stän-
digem Gebet oder sie lauschten dem mono-
tonen Gesang endloser litaneiartiger Psalmen.
Diese oft seltsamen Bilder sind denn auch ein
Echo religiöser Innenschau, — ein denkbar
schärfster Kontrast zu der durchaus welt-
lichen, weltfreudigen Formenwelt der ost-
asiatischen Moderne. ow.
Kurt Badt —
Lore Feldherr-Eber
Die Galerie J. Casper stellt Arbeiten
von Kurt Badt und Lore Feldberg-Eber aus.
Badt erweist zweifelsfrei Frische und eine
saubere Palette. Summarische Formengebung
ist aber nicht dasselbe wie Vereinfachung der
Form, Buntheit nicht dasselbe wie Farbigkeit.
Koloristische Differenzierung und formale De-
taillierung sind Stadien, die man, um sie auf-
zugeben, notwendig durchlaufen oder durch-
dacht haben muß. Gerade Cezanne, der in
einigen Landschaften von fern her spürbar ist,
Die „W eit kuns t“ kauft bis auf
weiteres ihre Nr. 2 des Jahrgangs
1927 („Kunstauktion“) mit RM 1,50
zurück. Der Verlag.
hätte wie kein anderer die verantwortungs-
volle Rolle eines einzigen Farbtupfens im Bild-
ganzen lehren und die gegenseitige Beein-
trächtigung allzu lauter und fettig gemalter
Hauptfarben vermeiden lassen können. We-
sentlich sympathischer als die Ölbilder sind
die Aguarelle, welche leicht und eindrucksfroh
aus dem Handgelenk hinlaviert sind. Falls
Badts „Ironisches Selbstporträt“ auch die
eigene Produktion ein wenig ironisiert, sei
ihm das anerkannt.
Den Arbeiten Lore Feldbergs möchte man
wünschen, daß sie das Niveau der „Straße mit
weißen Häusern“ einhielten. K.
Schloß Dubraucke
Der erste Teil der Inneneinrichtung von
Schloß Dubraucke, der, wie wir in Nr. 38 be-
richteten, am 3. und 4. Oktober durch das
K u n s t a u k t i o n s h a u s Continental
versteigert wird, ist nunmehr in der Budapester
Straße 4 in Berlin ausgestellt und erweist
seinen künstlerischen Wert durch die ausge-
zeichnete Qualität von meist deutschen Möbeln
des 18. Jahrhunderts, von Wandteppichen, Ge-
mälden und kostbaren kunstgewerblichen Ar-
beiten. Der zweite und leßte Teil dieser
schönen Sammlung wird bereits eine Woche
darauf durch dasselbe Aukfionshaus auf den
Markt kommen.