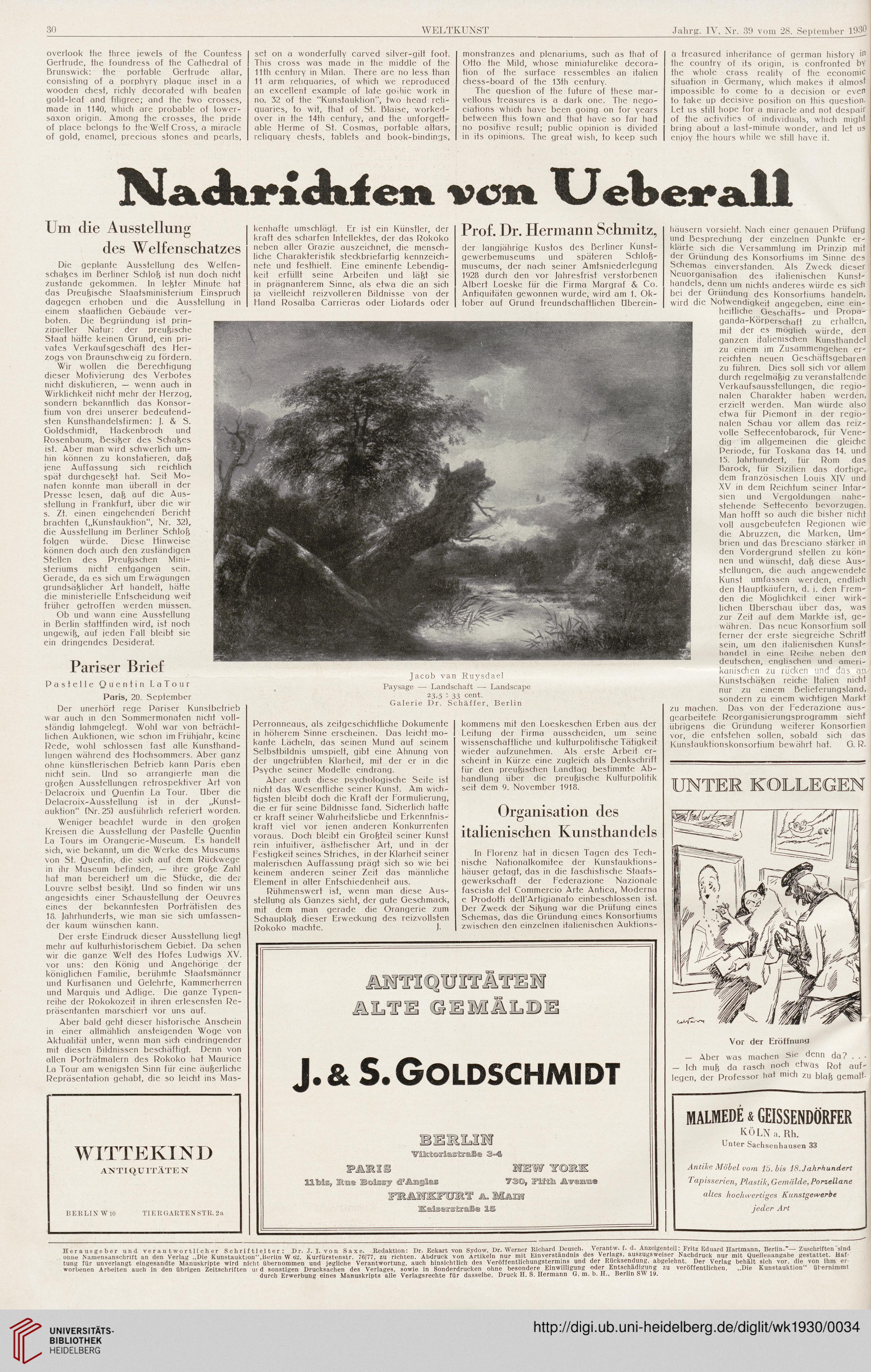30
WELTKUNST
Jahrg. IV. Nr. 39 vom 28. September 19-30
overlook the three jewels of the Countess
Gertrude, the foundress of the Cathedra! of
Brunswick: the portable Gertrude altar,
consisting of a porphyry plague inset in a
wooden ehest, richly decorated with besten
gold-leaf and filigree; and the two crosses,
made in 1140, which are probable of lower-
saxon origin. Among the crosses, the pride
of place belongs to the Welf Cross, a miracle
of gold, enamel, precious stones and pearls.
set on a wonderfully carved silver-gilt foot.
This cross was made in the middle of the
I Ith Century in Milan. There are no less than
II arm rehguaries, of which we reproduced
an excellent example of late goihic work in
no. 32 of the "Kunstaukfion”, two head reli-
quaries, to wit, that of St. Blaise, worked-
over in the 14th Century, and the unforgett-
able Herme of St. Cosmas, portable altars,
religuary chests, tablets and book-bindings.
monstranzes and plenariums, such as that of
Otto the Mild, whose miniaturelike decora-
tion of the surface ressembles an Italien
chess-board of the 13th Century.
The quesiion of the future of these mar-
vellous freasures is a dark one. The nego-
ciations which have been going on for years
between this town and that have so far had
no positive result; public opinion is divided
in its opinions. The great wish, io keep such
a treasured inheritance of german history in
the country of its origin, is confronted bY
the whole crass reality of the economic
Situation in Germany, which makes it almost
impossible to come to a decision or even
to take up decisive Position on this guestion-
Let us still hope for a miracle and not despair
of the activities of individuals, which might
bring about a last-minute wonder, and let us
enjoy the hours while we still have it.
en von Uefeetfall
Um die Ausstellung
des Welfenscliatzes
Oie geplante Ausstellung des Welfen-
schaßes im Berliner Schloß ist nun doch nicht
zustande gekommen. In leßter Minute hat
das Preußische Staatsministerium Einspruch
dagegen erhoben und die Ausstellung in
einem staatlichen Gebäude ver-
boten. Die Begründung ist prin-
zipieller Natur: der preußische
Staat hätte keinen Grund, ein pri-
vates Verkaufsgeschäff des Her-
zogs von Braunschweig zu fördern.
Wir wollen die Berechtigung
dieser Motivierung des Verbotes
nicht diskutieren, — wenn auch in
Wirklichkeit nicht mehr der Herzog,
sondern bekanntlich das Konsor-
tium von drei unserer bedeutend-
sten Kunsthandelsfirmen: J. & S.
Goldschmidt, Hackenbroch und
Rosenbaum, Besißer des Schaßes
ist. Aber man wird schwerlich um-
hin können zu konstatieren, daß
jene Auffassung sich reichlich
spät durchgeseßt hat. Seit Mo-
naten konnte man überall in der
Presse lesen, daß auf die Aus-
stellung in Frankfurt, über die wir
s. Zf. einen eingehenden Bericht
brachten („Kunstauktion", Nr. 32),
die Ausstellung im Berliner Schloß
folgen würde. Diese Hinweise
können doch auch den zuständigen
Stellen des Preußischen Mini-
steriums nicht entgangen sein.
Gerade, da es sich um Erwägungen
grundsäßlicher Art handelt, hätte
die ministerielle Entscheidung weit
früher getroffen werden müssen.
Ob und wann eine Ausstellung
in Berlin stattfinden wird, ist noch
ungewiß, auf jeden Fall bleibt sie
ein dringendes Desiderat.
Pariser Brief
Pastelle Quentin LaTour
Paris, 20. September
Der unerhört rege Pariser Kunstbetrieb
war auch in den Sommermonaten nicht voll-
ständig lahmgelegt. Wohl war von beträcht-
lichen Auktionen, wie schon im Frühjahr, keine
Rede, wohl schlossen fast alle Kunsthand-
lungen während des Hochsommers. Aber ganz
ohne künstlerischen Betrieb kann Paris eben
nicht sein. Und so arrangierte man die
großen Ausstellungen retrospektiver Art von
Delacroix und Quentin La Tour. Über die
Delacroix-Ausstellung ist in der „Kunst-
auktion“ (Nr. 25) ausführlich referiert worden.
Weniger beachtet wurde in den großen
Kreisen die Ausstellung der Pastelle Quentin
La Tours im Orangerie-Museum. Es handelt
sich, wie bekannt, um die Werke des Museums
von St. Quentin, die sich auf dem Rückwege
in ihr Museum befinden, — ihre große Zahl
hat man bereichert um die Stücke, die der
Louvre selbst besißt. Und so finden wir uns
angesichts einer Schaustellung der Oeuvres
eines der bekanntesten Porträtisten des
18. Jahrhunderts, wie man sie sich umfassen-
der kaum wünschen kann.
Der erste Eindruck dieser Ausstellung liegt
mehr auf kulturhistorischem Gebiet. Da sehen
wir die ganze Welt des Hofes Ludwigs XV.
vor uns: den König und Angehörige der
königlichen Familie, berühmte Staatsmänner
und Kurtisanen und Gelehrte, Kammerherren
und Marquis und Adlige. Die ganze Typen-
reihe der Rokokozeit in ihren erlesensten Re-
präsentanten marschiert vor uns auf.
Aber bald geht dieser historische Anschein
in einer allmählich ansteigenden Woge von
Aktualität unter, wenn man sich eindringender
mit diesen Bildnissen beschäftigt. Denn von
allen Porträtmalern des Rokoko hat Maurice
La Tour am wenigsten Sinn für eine äußerliche
Repräsentation gehabt, die so leicht ins Mas-
kenhafte umschlägt. Er ist ein Künstler, der
kraft des scharfen Intellektes, der das Rokoko
neben aller Grazie auszeichnet, die mensch-
liche Charakteristik steckbriefartig kennzeich-
nete und festhielt. Eine eminente Lebendig-
keit erfüllt seine Arbeiten und läßt sie
in prägnanterem Sinne, als etwa die an sich
ja vielleicht reizvolleren Bildnisse von der
Hand Rosalba Carrieras oder Liotards oder
Perronneaus, als zeitgeschichtliche Dokumente
in höherem Sinne erscheinen. Das leicht mo-
kante Lächeln, das seinen Mund auf seinem
Selbstbildnis umspielt, gibt eine Ahnung von
der ungetrübten Klarheit, mit der er in die
Psyche seiner Modelle eindrang.
Aber auch diese psychologische Seite ist
nicht das Wesentliche seiner Kunst. Am wich-
tigsten bleibt doch die Kraft der Formulierung,
die er für seine Bildnisse fand. Sicherlich hatte
er kraft seiner Wahrheitsliebe und Erkenntnis-
kraft viel vor jenen anderen Konkurrenten
voraus. Doch bleibt ein Großteil seiner Kunst
rein intuitiver, ästhetischer Art, und in der
Festigkeit seines Striches, in der Klarheit seiner
malerischen Auffassung prägt sich so wie bei
keinem anderen seiner Zeit das männliche
Element in aller Entschiedenheit aus.
Rühmenswert ist, wenn man diese Aus-
stellung als Ganzes sieht, der gute Geschmack,
mit dem man gerade die Orangerie zum
Schauplaß dieser Erweckung des reizvollsten
Rokoko machte. J.
Prof. Dr. Hermann Schmitz,
der langjährige Kustos des Berliner Kunst-
gewerbemuseums und späteren Schloß-
museums, der nach seiner Amtsniederlegung
1928 durch den vor Jahresfrist verstorbenen
Albert Loeske für die Firma Margraf & Co.
Antiquitäten gewonnen wurde, wird am 1. Ok-
tober auf Grund freundschaftlichen Überein-
kommens mit den Loeskeschen Erben aus der
Leitung der Firma ausscheiden, um seine
wissenschaftliche und kulturpolitische Tätigkeit
wieder aufzunehmen. Als erste Arbeit er-
scheint in Kürze eine zugleich als Denkschrift
für den preußischen Landtag bestimmte Ab-
handlung über die preußische Kulturpolitik
seif dem 9. November 1918.
Organisation des
italienischen Kunsthan dels
In Florenz hat in diesen Tagen des Tech-
nische Nationalkomitee der Kunstauktions-
häuser getagt, das in die faschistische Staats-
gewerkschaft der Federazione Nazionale
fascista del Commercio Arte Antica, Moderna
e Prodotti dell’Artigianato einbeschlossen ist.
Der Zweck der Sißung war die Prüfung eines
Schemas, das die Gründung eines Konsortiums
zwischen den einzelnen italienischen Auktions-
häusern vorsieht. Nach einer genauen Prüfung
und Besprechung der einzelnen Punkte er-
klärte sich die Versammlung im Prinzip mit
der Gründung des Konsortiums im Sinne des
Schemas einverstanden. Als Zweck dieser
Neuorganisation des italienischen Kunst'
handels, denn um nichts anderes würde es sich
bei der Gründung des Konsortiums handeln,
wird die Notwendigkeit angegeben, eine ein-
heitliche Geschäfts- und Propa-
ganda-Körperschaft zu erhalten,
mit der es möglich würde, den
ganzen italienischen Kunsthandel
zu einem im Zusammengehen er'
reichten neuen Geschäftsgebaren
zu führen. Dies soll sich vor allem
durch regelmäßig zu veranstaltende
Verkaufsausstellungen, die regio'
nalen Charakter haben werden,
erzielt werden. Man würde also
etwa für Piemont in der regiö'
nalen Schau vor allem das reiz-
volle Seftecentobarock, für Vene-
dig im allgemeinen die gleiche
Periode, für Toskana das 14. und
15. Jahrhundert, für Rom das
Barock, für Sizilien das dortige,
dem französischen Louis XIV und
XV in dem Reichtum seiner Intar-
sien und Vergoldungen nahe-
stehende Settecento bevorzugen.
Man hofft so auch die bisher nicht
voll ausgebeuteten Regionen wie
die Abruzzen, die Marken, Um-
brien und das Bresciano stärker in
den Vordergrund stellen zu kön-
nen und wünscht, daß diese Aus-
stellungen, die auch angewendete
Kunst umfassen werden, endlich
den Hauptkäufern, d. i. den Frem-
den die Möglichkeit einer wirk-
lichen Überschau über das, was
zur Zeit auf dem Markte ist, ge-
währen. Das neue Konsortium soll
ferner der erste siegreiche Schritt
sein, um den italienischen Kunst-
handel in eine Reihe neben den
deutschen, englischen und ameri-
kanischen zu rücken und das an
Kunstschäßen reiche Italien nicht
nur zu einem Belieferungsland,
sondern zu einem wichtigen Markt
zu machen. Das von der Federazione aus-
gearbeitete Reorganisierungsprogramm sieht
übrigens die Gründung weiterer Konsortien
vor, die entstehen sollen, sobald sich das
Kunstauktionskonsortium bewährt hat. G. R.
UNTER KOLLEGEN
Vor der Eröffnung
— Aber was machen Sie denn da? . . -
— Ich muß da rasch noch etwas Rot auf-
legen, der Professor hat mich zu blaß gemalt-
MALMEDE « GEISSENDÖRFER
Köln a. Rh.
Unter Sachsenhausen 33
Antike Möbel vom 15. bis 18.J ahrhundert
Tapisserien, Plastik, Gemälde, Porzellane
altes hochwertiges Kunstgewerbe
jeder Art
J.&S. Goldschmidt
Wtsteadastealß® 3-4
PARIS NEW YORK
M. Ms, Ita« Bolssy d’Asaglas 73©, Fifth &vouw
a Mm
KaisearstaraBe IS
Jacob van Ruysdael
Paysage — Landschaft —■ Landscape
23>5 • 33 cent.
Galerie Dr. Schäffer, Berlin
Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Dr. J. I. von Saxe. Redaktion: Dr. Eckart von Sydow, Dr. Werner Richard Deusch. Verantw. f. d. Anzeigenteil: Fritz Eduard Hartmann, Berlin.’—Zuschriften sind
ohne Namensanschrift an den Verlag „Die Kunstauktion“,Berlin W 62, Kurfürstens.tr. 76/77, zu richten. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haf-
tung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag behält sich vor, die von ihm er-
worbenen Arbeiten auch in den übrigen Zeitschriften ui d sonstigen Drucksachen des Verlages, sowie in Sonderdrucken ohne besondere Einwilligung oder Entschädigung zu veröffentlichen. „Die Kunstauktion“ übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H„ Berlin SW 19.
WELTKUNST
Jahrg. IV. Nr. 39 vom 28. September 19-30
overlook the three jewels of the Countess
Gertrude, the foundress of the Cathedra! of
Brunswick: the portable Gertrude altar,
consisting of a porphyry plague inset in a
wooden ehest, richly decorated with besten
gold-leaf and filigree; and the two crosses,
made in 1140, which are probable of lower-
saxon origin. Among the crosses, the pride
of place belongs to the Welf Cross, a miracle
of gold, enamel, precious stones and pearls.
set on a wonderfully carved silver-gilt foot.
This cross was made in the middle of the
I Ith Century in Milan. There are no less than
II arm rehguaries, of which we reproduced
an excellent example of late goihic work in
no. 32 of the "Kunstaukfion”, two head reli-
quaries, to wit, that of St. Blaise, worked-
over in the 14th Century, and the unforgett-
able Herme of St. Cosmas, portable altars,
religuary chests, tablets and book-bindings.
monstranzes and plenariums, such as that of
Otto the Mild, whose miniaturelike decora-
tion of the surface ressembles an Italien
chess-board of the 13th Century.
The quesiion of the future of these mar-
vellous freasures is a dark one. The nego-
ciations which have been going on for years
between this town and that have so far had
no positive result; public opinion is divided
in its opinions. The great wish, io keep such
a treasured inheritance of german history in
the country of its origin, is confronted bY
the whole crass reality of the economic
Situation in Germany, which makes it almost
impossible to come to a decision or even
to take up decisive Position on this guestion-
Let us still hope for a miracle and not despair
of the activities of individuals, which might
bring about a last-minute wonder, and let us
enjoy the hours while we still have it.
en von Uefeetfall
Um die Ausstellung
des Welfenscliatzes
Oie geplante Ausstellung des Welfen-
schaßes im Berliner Schloß ist nun doch nicht
zustande gekommen. In leßter Minute hat
das Preußische Staatsministerium Einspruch
dagegen erhoben und die Ausstellung in
einem staatlichen Gebäude ver-
boten. Die Begründung ist prin-
zipieller Natur: der preußische
Staat hätte keinen Grund, ein pri-
vates Verkaufsgeschäff des Her-
zogs von Braunschweig zu fördern.
Wir wollen die Berechtigung
dieser Motivierung des Verbotes
nicht diskutieren, — wenn auch in
Wirklichkeit nicht mehr der Herzog,
sondern bekanntlich das Konsor-
tium von drei unserer bedeutend-
sten Kunsthandelsfirmen: J. & S.
Goldschmidt, Hackenbroch und
Rosenbaum, Besißer des Schaßes
ist. Aber man wird schwerlich um-
hin können zu konstatieren, daß
jene Auffassung sich reichlich
spät durchgeseßt hat. Seit Mo-
naten konnte man überall in der
Presse lesen, daß auf die Aus-
stellung in Frankfurt, über die wir
s. Zf. einen eingehenden Bericht
brachten („Kunstauktion", Nr. 32),
die Ausstellung im Berliner Schloß
folgen würde. Diese Hinweise
können doch auch den zuständigen
Stellen des Preußischen Mini-
steriums nicht entgangen sein.
Gerade, da es sich um Erwägungen
grundsäßlicher Art handelt, hätte
die ministerielle Entscheidung weit
früher getroffen werden müssen.
Ob und wann eine Ausstellung
in Berlin stattfinden wird, ist noch
ungewiß, auf jeden Fall bleibt sie
ein dringendes Desiderat.
Pariser Brief
Pastelle Quentin LaTour
Paris, 20. September
Der unerhört rege Pariser Kunstbetrieb
war auch in den Sommermonaten nicht voll-
ständig lahmgelegt. Wohl war von beträcht-
lichen Auktionen, wie schon im Frühjahr, keine
Rede, wohl schlossen fast alle Kunsthand-
lungen während des Hochsommers. Aber ganz
ohne künstlerischen Betrieb kann Paris eben
nicht sein. Und so arrangierte man die
großen Ausstellungen retrospektiver Art von
Delacroix und Quentin La Tour. Über die
Delacroix-Ausstellung ist in der „Kunst-
auktion“ (Nr. 25) ausführlich referiert worden.
Weniger beachtet wurde in den großen
Kreisen die Ausstellung der Pastelle Quentin
La Tours im Orangerie-Museum. Es handelt
sich, wie bekannt, um die Werke des Museums
von St. Quentin, die sich auf dem Rückwege
in ihr Museum befinden, — ihre große Zahl
hat man bereichert um die Stücke, die der
Louvre selbst besißt. Und so finden wir uns
angesichts einer Schaustellung der Oeuvres
eines der bekanntesten Porträtisten des
18. Jahrhunderts, wie man sie sich umfassen-
der kaum wünschen kann.
Der erste Eindruck dieser Ausstellung liegt
mehr auf kulturhistorischem Gebiet. Da sehen
wir die ganze Welt des Hofes Ludwigs XV.
vor uns: den König und Angehörige der
königlichen Familie, berühmte Staatsmänner
und Kurtisanen und Gelehrte, Kammerherren
und Marquis und Adlige. Die ganze Typen-
reihe der Rokokozeit in ihren erlesensten Re-
präsentanten marschiert vor uns auf.
Aber bald geht dieser historische Anschein
in einer allmählich ansteigenden Woge von
Aktualität unter, wenn man sich eindringender
mit diesen Bildnissen beschäftigt. Denn von
allen Porträtmalern des Rokoko hat Maurice
La Tour am wenigsten Sinn für eine äußerliche
Repräsentation gehabt, die so leicht ins Mas-
kenhafte umschlägt. Er ist ein Künstler, der
kraft des scharfen Intellektes, der das Rokoko
neben aller Grazie auszeichnet, die mensch-
liche Charakteristik steckbriefartig kennzeich-
nete und festhielt. Eine eminente Lebendig-
keit erfüllt seine Arbeiten und läßt sie
in prägnanterem Sinne, als etwa die an sich
ja vielleicht reizvolleren Bildnisse von der
Hand Rosalba Carrieras oder Liotards oder
Perronneaus, als zeitgeschichtliche Dokumente
in höherem Sinne erscheinen. Das leicht mo-
kante Lächeln, das seinen Mund auf seinem
Selbstbildnis umspielt, gibt eine Ahnung von
der ungetrübten Klarheit, mit der er in die
Psyche seiner Modelle eindrang.
Aber auch diese psychologische Seite ist
nicht das Wesentliche seiner Kunst. Am wich-
tigsten bleibt doch die Kraft der Formulierung,
die er für seine Bildnisse fand. Sicherlich hatte
er kraft seiner Wahrheitsliebe und Erkenntnis-
kraft viel vor jenen anderen Konkurrenten
voraus. Doch bleibt ein Großteil seiner Kunst
rein intuitiver, ästhetischer Art, und in der
Festigkeit seines Striches, in der Klarheit seiner
malerischen Auffassung prägt sich so wie bei
keinem anderen seiner Zeit das männliche
Element in aller Entschiedenheit aus.
Rühmenswert ist, wenn man diese Aus-
stellung als Ganzes sieht, der gute Geschmack,
mit dem man gerade die Orangerie zum
Schauplaß dieser Erweckung des reizvollsten
Rokoko machte. J.
Prof. Dr. Hermann Schmitz,
der langjährige Kustos des Berliner Kunst-
gewerbemuseums und späteren Schloß-
museums, der nach seiner Amtsniederlegung
1928 durch den vor Jahresfrist verstorbenen
Albert Loeske für die Firma Margraf & Co.
Antiquitäten gewonnen wurde, wird am 1. Ok-
tober auf Grund freundschaftlichen Überein-
kommens mit den Loeskeschen Erben aus der
Leitung der Firma ausscheiden, um seine
wissenschaftliche und kulturpolitische Tätigkeit
wieder aufzunehmen. Als erste Arbeit er-
scheint in Kürze eine zugleich als Denkschrift
für den preußischen Landtag bestimmte Ab-
handlung über die preußische Kulturpolitik
seif dem 9. November 1918.
Organisation des
italienischen Kunsthan dels
In Florenz hat in diesen Tagen des Tech-
nische Nationalkomitee der Kunstauktions-
häuser getagt, das in die faschistische Staats-
gewerkschaft der Federazione Nazionale
fascista del Commercio Arte Antica, Moderna
e Prodotti dell’Artigianato einbeschlossen ist.
Der Zweck der Sißung war die Prüfung eines
Schemas, das die Gründung eines Konsortiums
zwischen den einzelnen italienischen Auktions-
häusern vorsieht. Nach einer genauen Prüfung
und Besprechung der einzelnen Punkte er-
klärte sich die Versammlung im Prinzip mit
der Gründung des Konsortiums im Sinne des
Schemas einverstanden. Als Zweck dieser
Neuorganisation des italienischen Kunst'
handels, denn um nichts anderes würde es sich
bei der Gründung des Konsortiums handeln,
wird die Notwendigkeit angegeben, eine ein-
heitliche Geschäfts- und Propa-
ganda-Körperschaft zu erhalten,
mit der es möglich würde, den
ganzen italienischen Kunsthandel
zu einem im Zusammengehen er'
reichten neuen Geschäftsgebaren
zu führen. Dies soll sich vor allem
durch regelmäßig zu veranstaltende
Verkaufsausstellungen, die regio'
nalen Charakter haben werden,
erzielt werden. Man würde also
etwa für Piemont in der regiö'
nalen Schau vor allem das reiz-
volle Seftecentobarock, für Vene-
dig im allgemeinen die gleiche
Periode, für Toskana das 14. und
15. Jahrhundert, für Rom das
Barock, für Sizilien das dortige,
dem französischen Louis XIV und
XV in dem Reichtum seiner Intar-
sien und Vergoldungen nahe-
stehende Settecento bevorzugen.
Man hofft so auch die bisher nicht
voll ausgebeuteten Regionen wie
die Abruzzen, die Marken, Um-
brien und das Bresciano stärker in
den Vordergrund stellen zu kön-
nen und wünscht, daß diese Aus-
stellungen, die auch angewendete
Kunst umfassen werden, endlich
den Hauptkäufern, d. i. den Frem-
den die Möglichkeit einer wirk-
lichen Überschau über das, was
zur Zeit auf dem Markte ist, ge-
währen. Das neue Konsortium soll
ferner der erste siegreiche Schritt
sein, um den italienischen Kunst-
handel in eine Reihe neben den
deutschen, englischen und ameri-
kanischen zu rücken und das an
Kunstschäßen reiche Italien nicht
nur zu einem Belieferungsland,
sondern zu einem wichtigen Markt
zu machen. Das von der Federazione aus-
gearbeitete Reorganisierungsprogramm sieht
übrigens die Gründung weiterer Konsortien
vor, die entstehen sollen, sobald sich das
Kunstauktionskonsortium bewährt hat. G. R.
UNTER KOLLEGEN
Vor der Eröffnung
— Aber was machen Sie denn da? . . -
— Ich muß da rasch noch etwas Rot auf-
legen, der Professor hat mich zu blaß gemalt-
MALMEDE « GEISSENDÖRFER
Köln a. Rh.
Unter Sachsenhausen 33
Antike Möbel vom 15. bis 18.J ahrhundert
Tapisserien, Plastik, Gemälde, Porzellane
altes hochwertiges Kunstgewerbe
jeder Art
J.&S. Goldschmidt
Wtsteadastealß® 3-4
PARIS NEW YORK
M. Ms, Ita« Bolssy d’Asaglas 73©, Fifth &vouw
a Mm
KaisearstaraBe IS
Jacob van Ruysdael
Paysage — Landschaft —■ Landscape
23>5 • 33 cent.
Galerie Dr. Schäffer, Berlin
Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Dr. J. I. von Saxe. Redaktion: Dr. Eckart von Sydow, Dr. Werner Richard Deusch. Verantw. f. d. Anzeigenteil: Fritz Eduard Hartmann, Berlin.’—Zuschriften sind
ohne Namensanschrift an den Verlag „Die Kunstauktion“,Berlin W 62, Kurfürstens.tr. 76/77, zu richten. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haf-
tung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag behält sich vor, die von ihm er-
worbenen Arbeiten auch in den übrigen Zeitschriften ui d sonstigen Drucksachen des Verlages, sowie in Sonderdrucken ohne besondere Einwilligung oder Entschädigung zu veröffentlichen. „Die Kunstauktion“ übernimmt
durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H„ Berlin SW 19.