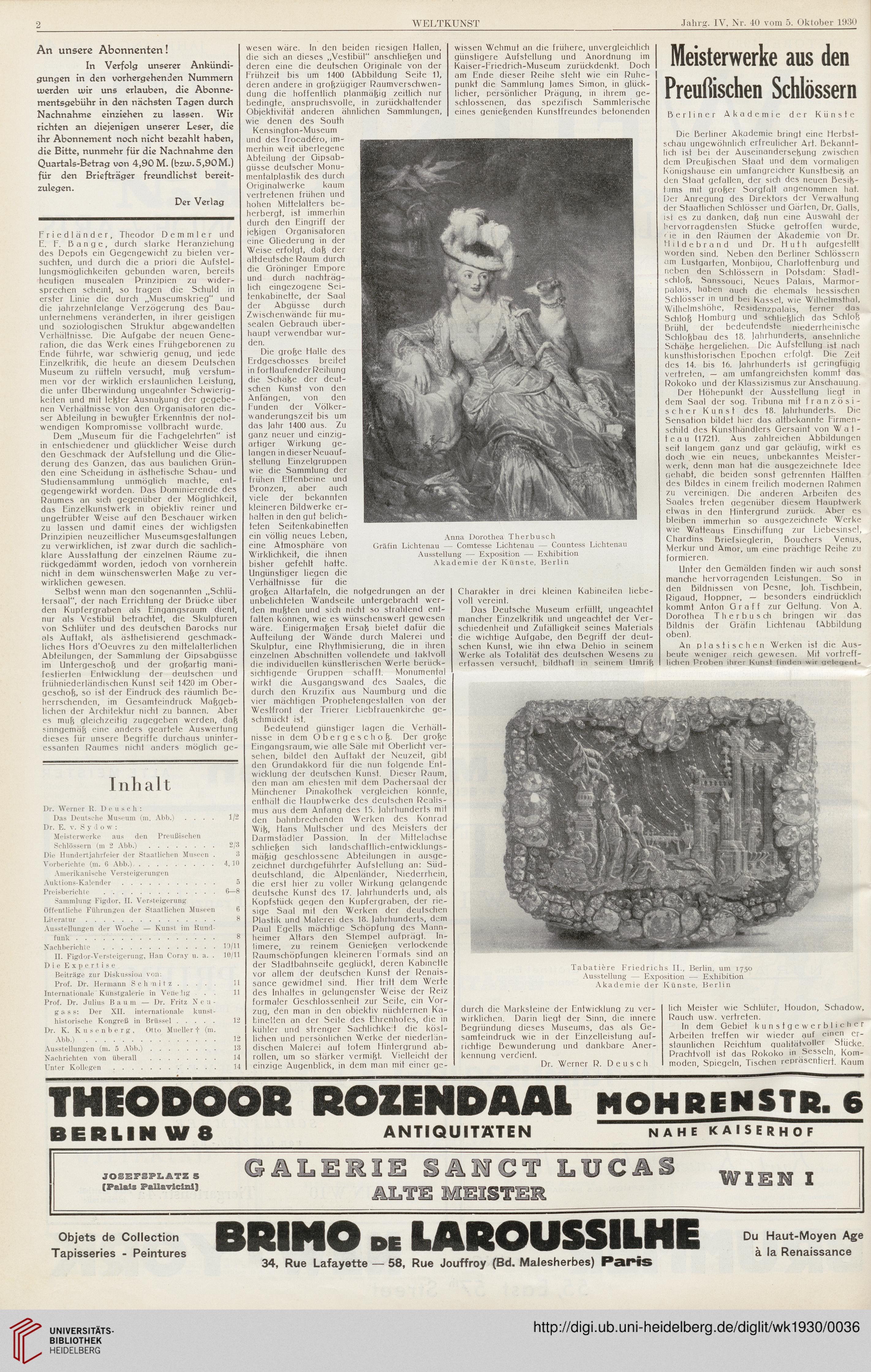2
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 40 vom 5. Oktober 1930
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündi-
gungen in den vorhergehenden Nummern
werden wir uns erlauben, die Abonne-
mentsgebühr in den nächsten Tagen durch
Nachnahme einziehen zu lassen. Wir
richten an diejenigen unserer Leser, die
ihr Abonnement noch nicht bezahlt haben,
die Bitte, nunmehr für die Nachnahme den
Quartals-Betrag von 4,90 M. (bzw.5,90M.)
für den Briefträger freundlichst bereit-
zulegen.
Der Verlag
Friedländer, Theodor Demmler und
E. F. Bange, durch starke Heranziehung
des Depots ein Gegengewicht zu bieten ver-
suchten, und durch die a priori die Aufstel-
lungsmöglichkeiten gebunden waren, bereits
heutigen musealen Prinzipien zu wider-
sprechen scheint, so tragen die Schuld in
erster Linie die durch „Museumskrieg“ und
die jahrzehntelange Verzögerung des Bau-
unfernehmens veränderten, in ihrer geistigen
und soziologischen Struktur abgewandelten
Verhältnisse. Die Aufgabe der neuen Gene-
ration, die das Werk eines Frühgeborenen zu
Ende führte, war schwierig genug, und jede
Einzelkritik, die heute an diesem Deutschen
Museum zu rütteln versucht, muß verstum-
men vor der wirklich erstaunlichen Leistung,
die unter Überwindung ungeahnter Schwierig-
keiten und mit leister Ausnußung der gegebe-
nen Verhältnisse von den Organisatoren die-
ser Abteilung in bewußter Erkenntnis der not-
wendigen Kompromisse vollbracht wurde.
Dem „Museum für die Fachgelehrten“ ist
in entschiedener und glücklicher Weise durch
den Geschmack der Aufstellung und die Glie-
derung des Ganzen, das aus baulichen Grün-
den eine Scheidung in ästhetische Schau- und
Studiensammlung unmöglich machte, ent-
gegengewirkt worden. Das Dominierende des
Raumes an sich gegenüber der Möglichkeit,
das Einzelkunsiwerk in objektiv reiner und
ungetrübter Weise auf den Beschauer wirken
zu lassen und damit eines der wichtigsten
Prinzipien neuzeitlicher Museumsgestaltungen
zu verwirklichen, ist zwar durch die sachlich-
klare Ausstattung der einzelnen Räume zu-
rückgedämmt worden, jedoch von vornherein
nicht in dem wünschenswerten Mage zu ver-
wirklichen gewesen.
Selbst wenn man den sogenannten „Schlü-
tersaal“, der nach Errichtung der Brücke über
den Kupfergraben als Eingangsraum dient,
nur als Vestibül betrachtet, die Skulpturen
von Schlüter und des deutschen Barocks nur
als Auftakt, als ästhetisierend geschmack-
liches Hors d’Oeuvres zu den mittelalterlichen
Abteilungen, der Sammlung der Gipsabgüsse
im Untergeschoß und der großartig mani-
festierten Entwicklung der deutschen und
frühniederländischen Kunst seit 1420 im Ober-
geschoß, so ist der Eindruck des räumlich Be-
herrschenden, im Gesamteindruck Maßgeb-
lichen der Architektur nicht zu bannen. Aber
es muß gleichzeitig zugegeben werden, daß
sinngemäß eine anders geartete Auswertung
dieses für unsere Begriffe durchaus uninter-
essanten Raumes nicht anders möglich ge-
Inhalt
Dr. Werner R. Den s.c h :
Das Deutsche Museum (m. Abb.) .... 1/2
Dr. E. v. S y d o w :
Meisterwerke aus den Preußischen
Schlössern (m 2 Abb.) . 2/3
Die Hundertjahrfeier der Staatlichen Museen . 3
Vorberichte (m. 6 Abb.),. . 4,10
Amerikanische Versteigerungen
Auktions-Kalender . . 5
Preisberichte .6—8
Sammlung Figdor, II. Versteigerung
öffentliche Führungen der Staatlichen Museen 6
Literatur. 8
Ausstellungen der Woche — Kunst im Rund-
funk . 8
Nachberichte .10/11
II. Figdor-Versteigerung, Han Coray u. a. . 10/11
Die Expertise
Beiträge zur Diskussion von:
Prof. Dr. Hermann Schmitz. 11
Internationale Kunstgalerie in Venelig . . 11
Prof. Dr. Julius Baum — Dr. Fritz N e u -
g a s s: Der XII. internationale kunst-
historische Kongreß in Brüssel ..... 12
Dr. K. Kusenberg, Otto Mueller f (m.
Abb.) . 12
Ausstellungen (m. 5 Abb.). 13
Nachrichten von überall . 14
Unter Kollegen . 14
wesen wäre. In den beiden riesigen Hallen,
die sich an dieses „Vestibül“ anschließen und
deren eine die deutschen Originale von der
Frühzeit bis um 1400 (Abbildung Seite 1),
deren andere in großzügiger Raumverschwen-
dung die hoffentlich planmäßig zeitlich nur
bedingte, anspruchsvolle, in zurückhaltender
Objektivität anderen ähnlichen Sammlungen,
wie denen des South
Kensington-Museum
und des Trocadero, im-
merhin weit überlegene
Abteilung der Gipsab-
güsse deutscher Monu-
mentalplastik des durch
Originalwerke kaum
vertretenen frühen und
hohen Mittelalters be-
herbergt, ist immerhin
durch den Eingriff der
jeßigen Organisatoren
eine Gliederung in der
Weise erfolgt, daß der
altdeutsche Raum durch
die Gröninger Empore
und durch nachträg-
lich eingezogene Sei-
tenkabinette, der Saal
der Abgüsse durch
Zwischenwände für mu-
sealen Gebrauch über-
haupt verwendbar wur-
den.
Die große Halle des
Erdgeschosses breitet
in fortlaufender Reihung
die Schäße der deut-
schen Kunst von den
Anfängen, von den
Funden der Völker-
wanderungszeit bis um
das Jahr 1400 aus. Zu
ganz neuer und einzig-
artiger Wirkung ge-
langen in dieserNeuauf-
stellung Einzelgruppen
wie die Sammlung der
frühen Elfenbeine und
Bronzen, aber auch
viele der bekannten
kleineren Bildwerke er-
halten in den gut belich-
teten Seitenkabinetten
ein völlig neues Leben,
eine Atmosphäre von
Wirklichkeit, die ihnen
bisher gefehlt hatte.
Ungünstiger liegen die
Verhältnisse für die
großen Altartafeln, die notgedrungen an der
unbelichteten Wandseite untergebracht wer-
den mußten und sich nicht so strahlend ent-
falten können, wie es wünschenswert gewesen
wäre. Einigermaßen Ersaß bietet dafür die
Aufteilung der Wände durch Malerei und
Skulptur, eine Rhythmisierung, die in ihren
einzelnen Abschnitten vollendete und taktvoll
die individuellen künstlerischen Werte berück-
sichtigende Gruppen schafft. Monumental
wirkt die Ausgangswand des Saales, die
durch den Kruzifix aus Naumburg und die
vier mächtigen Prophetengestalfen von der
Westfront der Trierer Liebfrauenkirche ge-
schmückt ist.
Bedeutend günstiger lagen die Verhält-
nisse in dem Obergeschoß. Der große
Eingangsraum, wie alle Säle mit Oberlicht ver-
sehen, bildet den Auftakt der Neuzeit, gibt
den Grundakkord für die nun folgende Ent-
wicklung der deutschen Kunst. Dieser Raum,
den man am ehesten mit dem Pachersaal der
Münchener Pinakothek vergleichen könnte,
enthält die Hauptwerke des deutschen Realis-
mus aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts mit
den bahnbrechenden Werken des Konrad
Wiß, Hans Multscher und des Meisters der
Darmstädter Passion. In der Mitlelachse
schließen sich landschaftlich-entwicklungs-
mäßig geschlossene Abteilungen in ausge-
zeichnet durchgeführter Aufstellung an: Süd-
deutschland, die Alpenländer, Niederrhein,
die erst hier zu voller Wirkung gelangende
deutsche Kunst des 17. Jahrhunderts und, als
Kopfstück gegen den Kupfergraben, der rie-
sige Saal mit den Werken der deutschen
Plastik und Malerei des 18. Jahrhunderts, dem
Paul Egells mächtige Schöpfung des Mann-
heimer Altars den Stempel aufprägt. In-
timere, zu reinem Genießen verlockende
Raumschöpfungen kleineren Formats sind an
der Stadibahnseite geglückt, deren Kabinette
vor allem der deutschen Kunst der Renais-
sance gewidmet sind. Hier tritt dem Werte
des Inhaltes in gelungenster Weise der Reiz
formaler Geschlossenheit zur Seite, ein Vor-
zug, den man in den objektiv nüchternen Ka-
binetten an der Seite des Ehrenhofes, die in
kühler und strenger Sachlichkeit die köst-
lichen und persönlichen Werke der niederlän-
dischen Malerei auf totem Hintergrund ab-
rollen, um so stärker vermißt. Vielleicht der
einzige Augenblick, in dem man mit einer ge-
wissen Wehmut an die frühere, unvergleichlich
günstigere Aufstellung und Anordnung im
Kaiser-Friedrich-Museum zurückdenkt. Doch
am Ende dieser Reihe steht wie ein Ruhe-
punkt die Sammlung James Simon, in glück-
licher, persönlicher Prägung, in ihrem ge-
schlossenen, das spezifisch Sammlerische
eines genießenden Kunstfreundes betonenden
Charakter in drei kleinen Kabinetten liebe-
voll vereint.
Das Deutsche Museum erfüllt, ungeachtet
mancher Einzelkrifik und ungeachtet der Ver-
schiedenheit und Zufälligkeit seines Materials
die wichtige Aufgabe, den Begriff der deut-
schen Kunst, wie ihn etwa Dehio in seinem
Werke als Totalität des deutschen Wesens zu
erfassen versucht, bildhaft in seinem Umriß
durch die Marksteine der Entwicklung zu ver-
wirklichen. Darin liegt der Sinn, die innere
Begründung dieses Museums, das als Ge-
samteindruck wie in der Einzelleisfung auf-
richtige Bewunderung und dankbare Aner-
kennung verdient.
Dr. Werner R. Deusch
I Meisterwerke aus den
Preußischen Schlössern
Berliner Akademie der Künste
Die Berliner Akademie bringt eine Herbst-
schau ungewöhnlich erfreulicher Art. Bekannt-
lich ist bei der Auseinanderseßung zwischen
dem Preußischen Staat und dem vormaligen
Königshause ein umfangreicher Kunstbesiß an
den Staat gefallen, der sich des neuen Besiß-
tums mit großer Sorgfalt angenommen hat.
Der Anregung des Direktors der Verwaltung
der Staatlichen Schlösser und Gärten, Dr. Galls,
ist es zu danken, daß nun eine Auswahl der
hervorragdensten Stücke getroffen wurde,
die in den Räumen der Akademie von Dr.
Hildebrand und Dr. Huth aufgestellt
worden sind. Neben den Berliner Schlössern
am Lustgarten, Monbijou, Charlottenburg und
neben den Schlössern in Potsdam: Stadt-
schloß, Sanssouci, Neues Palais, Marmor-
palais, haben auch die ehemals hessischen
Schlösser in und bei Kassel, wie Wilhelmsthal,
Wilhelmshöhe, Residenzpalais, ferner das
Schloß Homburg und schließlich das Schloß
Brühl, der bedeutendste niederrheinische
Schloßbau des 18. Jahrhunderts, ansehnliche
Schäße hergeliehen. Die Aufstellung ist nach
kunsthistorischen Epochen erfolgt. Die Zeit
des 14. bis 16. Jahrhunderts ist geringfügig
vertreten, — am umfangreichsten kommt das
Rokoko und der Klassizismus zur Anschauung.
Der Höhepunkt der Ausstellung liegt in
dem Saal der sog. Tribuna mit französi-
scher Kunst des 18. Jahrhunderts. Die
Sensation bildet hier das altbekannte Firmen-
schild des Kunsthändlers Gersaint von Wat-
teau (1721). Aus zahlreichen Abbildungen
seit langem ganz und gar geläufig, wirkt es
doch wie ein neues, unbekanntes Meister-
werk, denn man hat die ausgezeichnete Idee
gehabt, die beiden sonst getrennten Hälften
des Bildes in einem freilich modernen Rahmen
zu vereinigen. Die anderen Arbeiten des
Saales treten gegenüber diesem Hauptwerk
etwas in den Hintergrund zurück. Aber es
bleiben immerhin so ausgezeichnete Werke
wie Wafteaus Einschiffung zur Liebesinsel,
Chardins Briefsieglerin, Bouchers Venus,
Merkur und Amor, um eine prächtige Reihe zu
formieren.
Unter den Gemälden finden wir auch sonst
manche hervorragenden Leistungen. So in
den Bildnissen von Pesne, Joh. Tischbein,
Rigaud, Höppner, — besonders eindrücklich
kommt Anton Graff zur Geltung. Von A.
Dorothea Th e r b u s ch bringen wir das
Bildnis der Gräfin Lichfenau (Abbildung
oben).
An plastischen Werken ist die Aus-
beute weniger reich gewesen. Mit vortreff-
lichen Proben ihrer Kunst finden wir gelegent-
lich Meister wie Schlüter, Houdon, Schadow,
Rauch usw. vertreten.
In dem Gebiet kunstgewerblicher
Arbeiten treffen wir wieder auf einen er-
staunlichen Reichtum qualitätvoller Stücke.
Prachtvoll ist das Rokoko in Sesseln, Kom-
moden, Spiegeln, Tischen repräsentiert. Kaum
Anna Dorothea Therbusch
Gräfin Lichtenau — Comtesse Lichtenau — Countess Lichtenau
Ausstellung — Exposition — Exhibition
Akademie der Künste, Berlin
Tabatiere Friedrichs II., Berlin, um 1750
Ausstellung — Exposition — Exhibition
Akademie der Künste, Berlin
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRING de LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Paris
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 40 vom 5. Oktober 1930
An unsere Abonnenten!
In Verfolg unserer Ankündi-
gungen in den vorhergehenden Nummern
werden wir uns erlauben, die Abonne-
mentsgebühr in den nächsten Tagen durch
Nachnahme einziehen zu lassen. Wir
richten an diejenigen unserer Leser, die
ihr Abonnement noch nicht bezahlt haben,
die Bitte, nunmehr für die Nachnahme den
Quartals-Betrag von 4,90 M. (bzw.5,90M.)
für den Briefträger freundlichst bereit-
zulegen.
Der Verlag
Friedländer, Theodor Demmler und
E. F. Bange, durch starke Heranziehung
des Depots ein Gegengewicht zu bieten ver-
suchten, und durch die a priori die Aufstel-
lungsmöglichkeiten gebunden waren, bereits
heutigen musealen Prinzipien zu wider-
sprechen scheint, so tragen die Schuld in
erster Linie die durch „Museumskrieg“ und
die jahrzehntelange Verzögerung des Bau-
unfernehmens veränderten, in ihrer geistigen
und soziologischen Struktur abgewandelten
Verhältnisse. Die Aufgabe der neuen Gene-
ration, die das Werk eines Frühgeborenen zu
Ende führte, war schwierig genug, und jede
Einzelkritik, die heute an diesem Deutschen
Museum zu rütteln versucht, muß verstum-
men vor der wirklich erstaunlichen Leistung,
die unter Überwindung ungeahnter Schwierig-
keiten und mit leister Ausnußung der gegebe-
nen Verhältnisse von den Organisatoren die-
ser Abteilung in bewußter Erkenntnis der not-
wendigen Kompromisse vollbracht wurde.
Dem „Museum für die Fachgelehrten“ ist
in entschiedener und glücklicher Weise durch
den Geschmack der Aufstellung und die Glie-
derung des Ganzen, das aus baulichen Grün-
den eine Scheidung in ästhetische Schau- und
Studiensammlung unmöglich machte, ent-
gegengewirkt worden. Das Dominierende des
Raumes an sich gegenüber der Möglichkeit,
das Einzelkunsiwerk in objektiv reiner und
ungetrübter Weise auf den Beschauer wirken
zu lassen und damit eines der wichtigsten
Prinzipien neuzeitlicher Museumsgestaltungen
zu verwirklichen, ist zwar durch die sachlich-
klare Ausstattung der einzelnen Räume zu-
rückgedämmt worden, jedoch von vornherein
nicht in dem wünschenswerten Mage zu ver-
wirklichen gewesen.
Selbst wenn man den sogenannten „Schlü-
tersaal“, der nach Errichtung der Brücke über
den Kupfergraben als Eingangsraum dient,
nur als Vestibül betrachtet, die Skulpturen
von Schlüter und des deutschen Barocks nur
als Auftakt, als ästhetisierend geschmack-
liches Hors d’Oeuvres zu den mittelalterlichen
Abteilungen, der Sammlung der Gipsabgüsse
im Untergeschoß und der großartig mani-
festierten Entwicklung der deutschen und
frühniederländischen Kunst seit 1420 im Ober-
geschoß, so ist der Eindruck des räumlich Be-
herrschenden, im Gesamteindruck Maßgeb-
lichen der Architektur nicht zu bannen. Aber
es muß gleichzeitig zugegeben werden, daß
sinngemäß eine anders geartete Auswertung
dieses für unsere Begriffe durchaus uninter-
essanten Raumes nicht anders möglich ge-
Inhalt
Dr. Werner R. Den s.c h :
Das Deutsche Museum (m. Abb.) .... 1/2
Dr. E. v. S y d o w :
Meisterwerke aus den Preußischen
Schlössern (m 2 Abb.) . 2/3
Die Hundertjahrfeier der Staatlichen Museen . 3
Vorberichte (m. 6 Abb.),. . 4,10
Amerikanische Versteigerungen
Auktions-Kalender . . 5
Preisberichte .6—8
Sammlung Figdor, II. Versteigerung
öffentliche Führungen der Staatlichen Museen 6
Literatur. 8
Ausstellungen der Woche — Kunst im Rund-
funk . 8
Nachberichte .10/11
II. Figdor-Versteigerung, Han Coray u. a. . 10/11
Die Expertise
Beiträge zur Diskussion von:
Prof. Dr. Hermann Schmitz. 11
Internationale Kunstgalerie in Venelig . . 11
Prof. Dr. Julius Baum — Dr. Fritz N e u -
g a s s: Der XII. internationale kunst-
historische Kongreß in Brüssel ..... 12
Dr. K. Kusenberg, Otto Mueller f (m.
Abb.) . 12
Ausstellungen (m. 5 Abb.). 13
Nachrichten von überall . 14
Unter Kollegen . 14
wesen wäre. In den beiden riesigen Hallen,
die sich an dieses „Vestibül“ anschließen und
deren eine die deutschen Originale von der
Frühzeit bis um 1400 (Abbildung Seite 1),
deren andere in großzügiger Raumverschwen-
dung die hoffentlich planmäßig zeitlich nur
bedingte, anspruchsvolle, in zurückhaltender
Objektivität anderen ähnlichen Sammlungen,
wie denen des South
Kensington-Museum
und des Trocadero, im-
merhin weit überlegene
Abteilung der Gipsab-
güsse deutscher Monu-
mentalplastik des durch
Originalwerke kaum
vertretenen frühen und
hohen Mittelalters be-
herbergt, ist immerhin
durch den Eingriff der
jeßigen Organisatoren
eine Gliederung in der
Weise erfolgt, daß der
altdeutsche Raum durch
die Gröninger Empore
und durch nachträg-
lich eingezogene Sei-
tenkabinette, der Saal
der Abgüsse durch
Zwischenwände für mu-
sealen Gebrauch über-
haupt verwendbar wur-
den.
Die große Halle des
Erdgeschosses breitet
in fortlaufender Reihung
die Schäße der deut-
schen Kunst von den
Anfängen, von den
Funden der Völker-
wanderungszeit bis um
das Jahr 1400 aus. Zu
ganz neuer und einzig-
artiger Wirkung ge-
langen in dieserNeuauf-
stellung Einzelgruppen
wie die Sammlung der
frühen Elfenbeine und
Bronzen, aber auch
viele der bekannten
kleineren Bildwerke er-
halten in den gut belich-
teten Seitenkabinetten
ein völlig neues Leben,
eine Atmosphäre von
Wirklichkeit, die ihnen
bisher gefehlt hatte.
Ungünstiger liegen die
Verhältnisse für die
großen Altartafeln, die notgedrungen an der
unbelichteten Wandseite untergebracht wer-
den mußten und sich nicht so strahlend ent-
falten können, wie es wünschenswert gewesen
wäre. Einigermaßen Ersaß bietet dafür die
Aufteilung der Wände durch Malerei und
Skulptur, eine Rhythmisierung, die in ihren
einzelnen Abschnitten vollendete und taktvoll
die individuellen künstlerischen Werte berück-
sichtigende Gruppen schafft. Monumental
wirkt die Ausgangswand des Saales, die
durch den Kruzifix aus Naumburg und die
vier mächtigen Prophetengestalfen von der
Westfront der Trierer Liebfrauenkirche ge-
schmückt ist.
Bedeutend günstiger lagen die Verhält-
nisse in dem Obergeschoß. Der große
Eingangsraum, wie alle Säle mit Oberlicht ver-
sehen, bildet den Auftakt der Neuzeit, gibt
den Grundakkord für die nun folgende Ent-
wicklung der deutschen Kunst. Dieser Raum,
den man am ehesten mit dem Pachersaal der
Münchener Pinakothek vergleichen könnte,
enthält die Hauptwerke des deutschen Realis-
mus aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts mit
den bahnbrechenden Werken des Konrad
Wiß, Hans Multscher und des Meisters der
Darmstädter Passion. In der Mitlelachse
schließen sich landschaftlich-entwicklungs-
mäßig geschlossene Abteilungen in ausge-
zeichnet durchgeführter Aufstellung an: Süd-
deutschland, die Alpenländer, Niederrhein,
die erst hier zu voller Wirkung gelangende
deutsche Kunst des 17. Jahrhunderts und, als
Kopfstück gegen den Kupfergraben, der rie-
sige Saal mit den Werken der deutschen
Plastik und Malerei des 18. Jahrhunderts, dem
Paul Egells mächtige Schöpfung des Mann-
heimer Altars den Stempel aufprägt. In-
timere, zu reinem Genießen verlockende
Raumschöpfungen kleineren Formats sind an
der Stadibahnseite geglückt, deren Kabinette
vor allem der deutschen Kunst der Renais-
sance gewidmet sind. Hier tritt dem Werte
des Inhaltes in gelungenster Weise der Reiz
formaler Geschlossenheit zur Seite, ein Vor-
zug, den man in den objektiv nüchternen Ka-
binetten an der Seite des Ehrenhofes, die in
kühler und strenger Sachlichkeit die köst-
lichen und persönlichen Werke der niederlän-
dischen Malerei auf totem Hintergrund ab-
rollen, um so stärker vermißt. Vielleicht der
einzige Augenblick, in dem man mit einer ge-
wissen Wehmut an die frühere, unvergleichlich
günstigere Aufstellung und Anordnung im
Kaiser-Friedrich-Museum zurückdenkt. Doch
am Ende dieser Reihe steht wie ein Ruhe-
punkt die Sammlung James Simon, in glück-
licher, persönlicher Prägung, in ihrem ge-
schlossenen, das spezifisch Sammlerische
eines genießenden Kunstfreundes betonenden
Charakter in drei kleinen Kabinetten liebe-
voll vereint.
Das Deutsche Museum erfüllt, ungeachtet
mancher Einzelkrifik und ungeachtet der Ver-
schiedenheit und Zufälligkeit seines Materials
die wichtige Aufgabe, den Begriff der deut-
schen Kunst, wie ihn etwa Dehio in seinem
Werke als Totalität des deutschen Wesens zu
erfassen versucht, bildhaft in seinem Umriß
durch die Marksteine der Entwicklung zu ver-
wirklichen. Darin liegt der Sinn, die innere
Begründung dieses Museums, das als Ge-
samteindruck wie in der Einzelleisfung auf-
richtige Bewunderung und dankbare Aner-
kennung verdient.
Dr. Werner R. Deusch
I Meisterwerke aus den
Preußischen Schlössern
Berliner Akademie der Künste
Die Berliner Akademie bringt eine Herbst-
schau ungewöhnlich erfreulicher Art. Bekannt-
lich ist bei der Auseinanderseßung zwischen
dem Preußischen Staat und dem vormaligen
Königshause ein umfangreicher Kunstbesiß an
den Staat gefallen, der sich des neuen Besiß-
tums mit großer Sorgfalt angenommen hat.
Der Anregung des Direktors der Verwaltung
der Staatlichen Schlösser und Gärten, Dr. Galls,
ist es zu danken, daß nun eine Auswahl der
hervorragdensten Stücke getroffen wurde,
die in den Räumen der Akademie von Dr.
Hildebrand und Dr. Huth aufgestellt
worden sind. Neben den Berliner Schlössern
am Lustgarten, Monbijou, Charlottenburg und
neben den Schlössern in Potsdam: Stadt-
schloß, Sanssouci, Neues Palais, Marmor-
palais, haben auch die ehemals hessischen
Schlösser in und bei Kassel, wie Wilhelmsthal,
Wilhelmshöhe, Residenzpalais, ferner das
Schloß Homburg und schließlich das Schloß
Brühl, der bedeutendste niederrheinische
Schloßbau des 18. Jahrhunderts, ansehnliche
Schäße hergeliehen. Die Aufstellung ist nach
kunsthistorischen Epochen erfolgt. Die Zeit
des 14. bis 16. Jahrhunderts ist geringfügig
vertreten, — am umfangreichsten kommt das
Rokoko und der Klassizismus zur Anschauung.
Der Höhepunkt der Ausstellung liegt in
dem Saal der sog. Tribuna mit französi-
scher Kunst des 18. Jahrhunderts. Die
Sensation bildet hier das altbekannte Firmen-
schild des Kunsthändlers Gersaint von Wat-
teau (1721). Aus zahlreichen Abbildungen
seit langem ganz und gar geläufig, wirkt es
doch wie ein neues, unbekanntes Meister-
werk, denn man hat die ausgezeichnete Idee
gehabt, die beiden sonst getrennten Hälften
des Bildes in einem freilich modernen Rahmen
zu vereinigen. Die anderen Arbeiten des
Saales treten gegenüber diesem Hauptwerk
etwas in den Hintergrund zurück. Aber es
bleiben immerhin so ausgezeichnete Werke
wie Wafteaus Einschiffung zur Liebesinsel,
Chardins Briefsieglerin, Bouchers Venus,
Merkur und Amor, um eine prächtige Reihe zu
formieren.
Unter den Gemälden finden wir auch sonst
manche hervorragenden Leistungen. So in
den Bildnissen von Pesne, Joh. Tischbein,
Rigaud, Höppner, — besonders eindrücklich
kommt Anton Graff zur Geltung. Von A.
Dorothea Th e r b u s ch bringen wir das
Bildnis der Gräfin Lichfenau (Abbildung
oben).
An plastischen Werken ist die Aus-
beute weniger reich gewesen. Mit vortreff-
lichen Proben ihrer Kunst finden wir gelegent-
lich Meister wie Schlüter, Houdon, Schadow,
Rauch usw. vertreten.
In dem Gebiet kunstgewerblicher
Arbeiten treffen wir wieder auf einen er-
staunlichen Reichtum qualitätvoller Stücke.
Prachtvoll ist das Rokoko in Sesseln, Kom-
moden, Spiegeln, Tischen repräsentiert. Kaum
Anna Dorothea Therbusch
Gräfin Lichtenau — Comtesse Lichtenau — Countess Lichtenau
Ausstellung — Exposition — Exhibition
Akademie der Künste, Berlin
Tabatiere Friedrichs II., Berlin, um 1750
Ausstellung — Exposition — Exhibition
Akademie der Künste, Berlin
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRING de LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Paris
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance