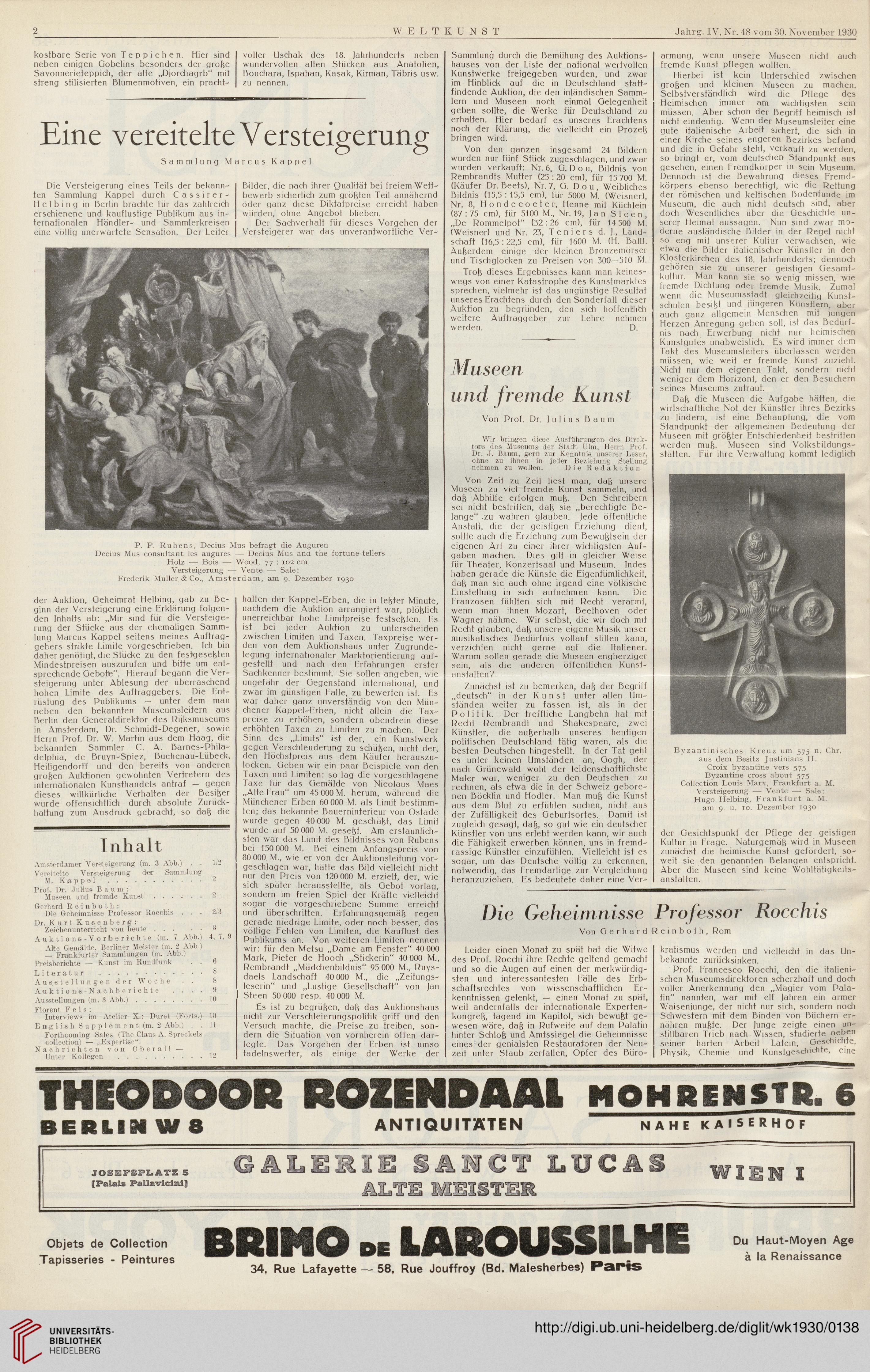2
WELT KUNST
Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930
kostbare Serie von Teppichen. Hier sind
neben einigen Gobelins besonders der große
Savonnerieteppich, der alte „Djorchagrb“ mit
streng stilisierten Blumenmotiven, ein pracht-
voller Uschak des 18. Jahrhunderts neben
wundervollen alten Stücken aus Anatolien,
Bouchara, Ispahan, Kasak, Kirman, Täbris usw.
zu nennen.
Eine vereitelte Versteigerung
Sammlung Marcus Kappel
Die Versteigerung eines Teils der bekann-
ten Sammlung Kappel durch Cassirer-
II e 1 b i n g in Berlin brachte für das zahlreich
erschienene und kauflustige Publikum aus in-
ternationalen Händler- und Sammlerkreisen
eine völlig unerwartete Sensation. Der Leiter
Bilder, die nach ihrer Qualität bei freiem Wett-
bewerb sicherlich zum größten Teil annähernd
oder ganz diese Diktatpreise erreicht haben
würden, ohne Angebot blieben.
Der Sachverhalt für dieses Vorgehen der
Versteigerer war das unverantwortliche Ver-
P. P. Rubens, Decius Mus befragt die Auguren
Decius Mus Consultant les augures — Decius Mus ana the fortune-tellers
Holz — Bois — Wood, 77 : 102 cm
Versteigerung — Vente — Sale:
Frederik Muller & Co., Amsterdam, am 9. Dezember 1930
der Auktion, Geheimrat Helbing, gab zu Be-
ginn der Versteigerung eine Erklärung folgen-
den Inhalts ab: „Mir sind für die Versteige-
rung der Stücke aus der ehemaligen Samm-
lung Marcus Kappel seitens meines Auftrag-
gebers strikte Limite vorgeschrieben. Ich bin
daher genötigt, die Stücke zu den fesfgeseßten
Mindestpreisen auszurufen und bitte um ent-
sprechende Gebote". Hierauf begann die Ver-
steigerung unter Ablesung der überraschend
hohen Limite des Auftraggebers. Die Ent-
rüstung des Publikums — unter dem man
neben den bekannten Museumsleitern aus
Berlin den Generaldirektor des Rijksmuseums
in Amsterdam, Dr. Schmidt-Degener, sowie
Herrn Prof. Dr. W. Martin aus dem Haag, die
bekannten Sammler C. A. Barnes-Phila-
delphia, de Bruyn-Spiez, Buchenau-Lübeck,
Heiligendorff und den bereits von anderen
großen Auktionen gewohnten Vertretern des
internationalen Kunsthandels antraf — gegen
dieses willkürliche Verhalten der Besißer
wurde offensichtlich durch absolute Zurück-
haltung zum Ausdruck gebracht, so daß die
Inhalt
Amsterdamer Versteigerung (m. 3 Abb.) . .. 112
Vereitelte Versteigerung deir Sammlung
M, K a p p e 1 .. -
Prof. Dr. Julius Baum:
Museen und fremde Kunst.2
Gerhard R e i n b 0 t h :
Die Geheimnisse Professor Rocchis ... 213
Dr. K ur t K usenberg :
Zeichenunterricht von heute ... • • 3
Auktione-Vorberichte (m. 7 Abb.) 4,7,9
Alte Gemälde. Berliner Meister (m. 2 Abb.)
— Frankfurter Sammlungen (m. Abb.)
Preisberichte — Kunst im Rundfunk ... 6
Literatur . 8
Ausstellungen der Woche . . 8
A u k t i 0 n's - N a c h b e r i c h t e . . . . 9
Ausstellungen (m. 3 Abb.).10
Florent Fels:
Interviews im Atelier X.: Duret (Forts.) 10
E n g 1 i s h Supplement (m. 2 Abb.) . . 11
Forthcoming Sales (The Claus A. Spreckels
Collection) — ^Expertise“'
Nachrichten von Überall —
Unter Kollegen ..12
halten der Kappel-Erben, die in leßter Minute,
nachdem die Auktion arrangiert war, plößlich
unerreichbar hohe Limitpreise festseßten. Es
ist bei jeder Auktion zu unterscheiden
zwischen Limiten und Taxen. Taxpreise wer-
den von dem Auktionshaus unter Zugrunde-
legung internationaler Marktorientierung auf-
gestellt und nach den Erfahrungen erster
Sachkenner bestimmt. Sie sollen angeben, wie
ungefähr der Gegenstand international, und
zwar im günstigen Falle, zu bewerten ist. Es
war daher ganz unverständig von den Mün-
chener Kappel-Erben, nicht allein die Tax-
preise zu erhöhen, sondern obendrein diese
erhöhten Taxen zu Limiten zu machen. Der
Sinn des „Limits" ist der, ein Kunstwerk
gegen Verschleuderung zu Schüßen, nicht der,
den Höchstpreis aus dem Käufer herauszu-
locken. Geben wir ein paar Beispiele von den
Taxen und Limiten: so lag die vorgeschlagene
Taxe für das Gemälde von Nicolaus Maes
„Alte Frau“ um 45 000 M. herum, während die
Münchener Erben 60 000 M. als Limit bestimm-
ten; das bekannte Bauerninterieur von Ostade
wurde gegen 40 000 M. geschäßt, das Limit
wurde auf 50 000 M. geseßt. Am erstaunlich-
sten war das Limit des Bildnisses von Rubens
bei 150 000 M. Bei einem Anfangspreis von
80 000 M., wie er von der Auktionsleitung vor-
geschlagen war, hätte das Bild vielleicht nicht
nur den Preis von 120 000 M. erzielt, der, wie
sich später herausstellte, als Gebot vorlag,
sondern im freien Spiel der Kräfte vielleicht
sogar die vorgeschriebene Summe erreicht
und überschritten. Erfahrungsgemäß regen
gerade niedrige Limite, oder noch besser, das
völlige Fehlen von Limiten, die Kauflust des
Publikums an. Von weiteren Limiten nennen
wir: für den Meisu „Dame am Fenster" 40 000
Mark, Pieter de Hooch „Stickerin" 40 000 M.,
Rembrandt „Mädchenbildnis" 95 000 M., Ruys-
daels Landschaft 40 000 M., die „Zeitungs-
leserin“ und „Lustige Gesellschaft" von Jan
Steen 50 000 resp. 40 000 M.
Es ist zu begrüßen, daß das Auktionshaus
nicht zur Verschleierungspolitik griff und den
Versuch machte, die Preise zu treiben, son-
dern die Situation von vornherein offen dar-
legte. Das Vorgehen der Erben ist umso
tadelnswerter, als einige der Werke der
Sammlung durch die Bemühung des Auktions-
hauses von der Liste der national wertvollen
Kunstwerke freigegeben wurden, und zwar
im Hinblick auf die in Deutschland statt-
findende Auktion, die den inländischen Samm-
lern und Museen noch einmal Gelegenheit
geben sollte, die Werke für Deutschland zu
erhalten. Hier bedarf es unseres Erachtens
noch der Klärung, die vielleicht ein Prozeß
bringen wird.
Von den ganzen insgesamt 24 Bildern
wurden nur fünf Stück zugeschlagen, und zwar
wurden verkauft: Nr. 6, G. D o u, Bildnis von
Rembrandts Mutter (25:20 cm), für 15 700 M.
(Käufer Dr. Beets), Nr. 7, G. Dou, Weibliches
Bildnis (15,5 : 15,5 cm), für 5000 M. (Weisner),
Nr. 8, H o n d e c o e t e r, Henne mit Küchlein
(87 : 75 cm), für 5100 M., Nr. 19, Jan Steen,
„De Rommelpot“ (32:26 cm), für 14 500 M.
(Weisner) und Nr. 23, Teniers d. ]., Land-
schaft (16,5:22,5 cm), für 1600 M. (H. Ball).
Außerdem einige der kleinen Bronzemörser
und Tischglocken zu Preisen von 300—510 M.
Troß dieses Ergebnisses kann man keines-
wegs von einer Katastrophe des Kunsimarktes
sprechen, vielmehr ist das ungünstige Resultat
unseres Erachtens durch den Sonderfall dieser
Auktion zu begründen, den sich hoffenHibh
weitere Auftraggeber zur Lehre nehmen
werden. D.
Museen
und fremde Kunst
Von Prof. Dr. Julius Baum
Wir bringen diene Ausführungen de® Direk-
tors de® Museums der Stadt Ulm, Herrn Prof..
Dr. J. Baum, gern zur Kenntnis, unserer Leser,
ohne zu ihnen in jeder Beziehung Stellung
nehmen zu wollen. Die Redaktion
Von Zeit zu Zeit liest man, daß unsere
Museen zu viel fremde Kunst sammeln, und
daß Abhilfe erfolgen muß. Den Schreibern
sei nicht bestritten, daß sie „berechtigte Be-
lange" zu wahren glauben. Jede öffentliche
Anstali, die der geistigen Erziehung dient,
sollte auch die Erziehung zum Bewußtsein der
eigenen Art zu einer ihrer wichtigsten Auf-
gaben machen. Dies gilt in gleicher Weise
für Theater, Konzertsaal und Museum. Indes
haben gerade die Künste die Eigentümlichkeit,
daß man sie auch ohne irgend eine völkische
Einstellung in sich aufnehmen kann. Die
Franzosen fühlten sich mit Recht verarmt,
wenn man ihnen Mozart, Beelhoven oder
Wagner nähme. Wir selbst, die wir doch mit
Recht glauben, daß unsere eigene Musik unser
musikalisches Bedürfnis vollauf stillen kann,
verzichten nicht gerne auf die Italiener.
Warum sollen gerade die Museen engherziger
sein, als die anderen öffentlichen Kunst-
anstalten?
Zunächst ist zu bemerken, daß der Begriff
„deutsch“ in der Kunst unter allen Um-
ständen weiter zu fassen ist, als in der
Politik. Der treffliche Langbehn hat mit
Recht Rembrandt und Shakespeare, zwei
Künstler, die außerhalb unseres heutigen
politischen Deutschland tätig waren, als die
besten Deutschen hingestellt. In der Tat geht
es unter keinen Umständen an, Gogh, der
nach Grünewald wohl der leidenschaftlichste
Maler war, weniger zu den Deutschen zu
rechnen, als etwa die in der Schweiz gebore-
nen Böcklin und Hodler. Man muß die Kunst
aus dem Blut zu erfühlen suchen, nicht aus
der Zufälligkeit des Geburtsortes. Damit ist
zugleich gesagt, daß, so gut wie ein deutscher
Künstler von uns erlebt werden kann, wir auch
die Fähigkeit erwerben können, uns in fremd-
rassige Künstler einzufühlen. Vielleicht ist es
sogar, um das Deutsche völlig zu erkennen,
notwendig, das Fremdartige zur Vergleichung
heranzuziehen. Es bedeutete daher eine Ver-
armung, wenn unsere Museen nicht auch
fremde Kunst pflegen wollten.
Hierbei ist kein Unterschied zwischen
großen und kleinen Museen zu machen.
Selbstverständlich wird die Pflege des
Heimischen immer am wichtigsten sein
müssen. Aber schon der Begriff heimisch ist
nicht eindeutig. Wenn der Museumsleiter eine
gute italienische Arbeit sichert, die sich in
einer Kirche seines engeren Bezirkes befand
und die in Gefahr steht, verkauft zu werden,
so bringt er, vom deutschen Standpunkt aus
gesehen, einen Fremdkörper in sein Museum.
Dennoch ist die Bewahrung dieses Fremd-
körpers ebenso berechtigt, wie die Rettung
der römischen und keltischen Bodenfunde im
Museum, die auch nicht deutsch sind, aber
doch Wesentliches über die Geschichte un-
serer Heimat aussagen. Nun sind zwar mo-
derne ausländische Bilder in der Regel nicht
so eng mit unserer Kultur verwachsen, wie
etwa die Bilder italienischer Künstler in den
Klosterkirchen des 18. Jahrhunderts; dennoch
gehören sie zu unserer geistigen Gesamt-
kultur. Man kann sie so wenig missen, wie
fremde Dichtung oder fremde Musik. Zumal
wenn die Museumsstadt gleichzeitig Kunst-
schulen besißt und jüngeren Künstlern, aber
auch ganz allgemein Menschen mit jungen
Herzen Anregung geben soll, ist das Bedürf-
nis nach Erwerbung nicht nur heimischen
Kunstgules unabweislich. Es wird immer dem
Takt des Museumsleiters überlassen werden
müssen, wie weit er fremde Kunst zuzieht.
Nicht nur dem eigenen Takt, sondern nicht
weniger dem Horizont, den er den Besuchern
seines Museums zufrauf.
Daß die Museen die Aufgabe hätten, die
wirtschaftliche Not der Künstler ihres Bezirks
zu lindern, ist eine Behauptung, die vom
Standpunkt der allgemeinen Bedeutung der
Museen mit größter Entschiedenheit bestritten
werden muß. Museen sind Volksbildungs-
stätten. Für ihre Verwaltung kommt lediglich
Byzantinisches Kreuz um 575 n. Chr.
aus dem Besitz Justinians II.
Croix byzantine vers 575
Byzantine cross about 575
Collection Louis Marx, Frankfurt a. M.
Versteigerung — Vente — Sale:
Hugo Helbing, Frankfurt a. M.
am 9. u. 10. Dezember 1930
der Gesichtspunkt der Pflege der geistigen
Kultur in Frage. Naturgemäß wird in Museen
zunächst die heimische Kunst gefördert, so-
weit sie den genannten Belangen entspricht.
Aber die Museen sind keine Wohltätigkeits-
anstalten.
Die
Geheimnisse Professor Rocchis
Von Gerhard Reinboth, Rom
Leider einen Monat zu spät hat die Witwe
des Prof. Rocchi ihre Rechte geltend gemacht
und so die Augen auf einen der merkwürdig-
sten und interessantesten Fälle des Erb-
schaftsrechtes von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen gelenkt, — einen Monat zu spät,
weil andernfalls der internationale Experten-
kongreß, tagend im Kapitol, sich bewußt ge-
wesen wäre, daß in Rufweite auf dem Palatin
hinter Schloß und Amtssiegel die Geheimnisse
eines der genialsten Restauratoren der Neu-
zeit unter Staub zerfallen, Opfer des Büro-
kratismus werden und vielleicht in das Un-
bekannte zurücksinken.
Prof. Francesco Rocchi, den die italieni-
schen Museumsdirektoren scherzhaft und doch
voller Anerkennung den „Magier vom Pala-
tin" nannten, war mit elf Jahren ein armer
Waisenjunge, der nicht nur sich, sondern noch
Schwestern mit dem Binden von Büchern er-
nähren mußte. Der Junge zeigte einen un-
stillbaren Trieb nach Wissen, studierte neben
seiner harten Arbeit Latein, Geschichte,
Physik, Chemie und Kunstgeschichte, eine
JOSEFSPL^TZ 5
(Palais Fallaväciaal]
G&LOIS SÄMCT lücas
ALTS
WIO I
THEODOOR ROZENDAAL mohrehstr. 6
BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN nahe kaiserhof “
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRING oe LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance
WELT KUNST
Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930
kostbare Serie von Teppichen. Hier sind
neben einigen Gobelins besonders der große
Savonnerieteppich, der alte „Djorchagrb“ mit
streng stilisierten Blumenmotiven, ein pracht-
voller Uschak des 18. Jahrhunderts neben
wundervollen alten Stücken aus Anatolien,
Bouchara, Ispahan, Kasak, Kirman, Täbris usw.
zu nennen.
Eine vereitelte Versteigerung
Sammlung Marcus Kappel
Die Versteigerung eines Teils der bekann-
ten Sammlung Kappel durch Cassirer-
II e 1 b i n g in Berlin brachte für das zahlreich
erschienene und kauflustige Publikum aus in-
ternationalen Händler- und Sammlerkreisen
eine völlig unerwartete Sensation. Der Leiter
Bilder, die nach ihrer Qualität bei freiem Wett-
bewerb sicherlich zum größten Teil annähernd
oder ganz diese Diktatpreise erreicht haben
würden, ohne Angebot blieben.
Der Sachverhalt für dieses Vorgehen der
Versteigerer war das unverantwortliche Ver-
P. P. Rubens, Decius Mus befragt die Auguren
Decius Mus Consultant les augures — Decius Mus ana the fortune-tellers
Holz — Bois — Wood, 77 : 102 cm
Versteigerung — Vente — Sale:
Frederik Muller & Co., Amsterdam, am 9. Dezember 1930
der Auktion, Geheimrat Helbing, gab zu Be-
ginn der Versteigerung eine Erklärung folgen-
den Inhalts ab: „Mir sind für die Versteige-
rung der Stücke aus der ehemaligen Samm-
lung Marcus Kappel seitens meines Auftrag-
gebers strikte Limite vorgeschrieben. Ich bin
daher genötigt, die Stücke zu den fesfgeseßten
Mindestpreisen auszurufen und bitte um ent-
sprechende Gebote". Hierauf begann die Ver-
steigerung unter Ablesung der überraschend
hohen Limite des Auftraggebers. Die Ent-
rüstung des Publikums — unter dem man
neben den bekannten Museumsleitern aus
Berlin den Generaldirektor des Rijksmuseums
in Amsterdam, Dr. Schmidt-Degener, sowie
Herrn Prof. Dr. W. Martin aus dem Haag, die
bekannten Sammler C. A. Barnes-Phila-
delphia, de Bruyn-Spiez, Buchenau-Lübeck,
Heiligendorff und den bereits von anderen
großen Auktionen gewohnten Vertretern des
internationalen Kunsthandels antraf — gegen
dieses willkürliche Verhalten der Besißer
wurde offensichtlich durch absolute Zurück-
haltung zum Ausdruck gebracht, so daß die
Inhalt
Amsterdamer Versteigerung (m. 3 Abb.) . .. 112
Vereitelte Versteigerung deir Sammlung
M, K a p p e 1 .. -
Prof. Dr. Julius Baum:
Museen und fremde Kunst.2
Gerhard R e i n b 0 t h :
Die Geheimnisse Professor Rocchis ... 213
Dr. K ur t K usenberg :
Zeichenunterricht von heute ... • • 3
Auktione-Vorberichte (m. 7 Abb.) 4,7,9
Alte Gemälde. Berliner Meister (m. 2 Abb.)
— Frankfurter Sammlungen (m. Abb.)
Preisberichte — Kunst im Rundfunk ... 6
Literatur . 8
Ausstellungen der Woche . . 8
A u k t i 0 n's - N a c h b e r i c h t e . . . . 9
Ausstellungen (m. 3 Abb.).10
Florent Fels:
Interviews im Atelier X.: Duret (Forts.) 10
E n g 1 i s h Supplement (m. 2 Abb.) . . 11
Forthcoming Sales (The Claus A. Spreckels
Collection) — ^Expertise“'
Nachrichten von Überall —
Unter Kollegen ..12
halten der Kappel-Erben, die in leßter Minute,
nachdem die Auktion arrangiert war, plößlich
unerreichbar hohe Limitpreise festseßten. Es
ist bei jeder Auktion zu unterscheiden
zwischen Limiten und Taxen. Taxpreise wer-
den von dem Auktionshaus unter Zugrunde-
legung internationaler Marktorientierung auf-
gestellt und nach den Erfahrungen erster
Sachkenner bestimmt. Sie sollen angeben, wie
ungefähr der Gegenstand international, und
zwar im günstigen Falle, zu bewerten ist. Es
war daher ganz unverständig von den Mün-
chener Kappel-Erben, nicht allein die Tax-
preise zu erhöhen, sondern obendrein diese
erhöhten Taxen zu Limiten zu machen. Der
Sinn des „Limits" ist der, ein Kunstwerk
gegen Verschleuderung zu Schüßen, nicht der,
den Höchstpreis aus dem Käufer herauszu-
locken. Geben wir ein paar Beispiele von den
Taxen und Limiten: so lag die vorgeschlagene
Taxe für das Gemälde von Nicolaus Maes
„Alte Frau“ um 45 000 M. herum, während die
Münchener Erben 60 000 M. als Limit bestimm-
ten; das bekannte Bauerninterieur von Ostade
wurde gegen 40 000 M. geschäßt, das Limit
wurde auf 50 000 M. geseßt. Am erstaunlich-
sten war das Limit des Bildnisses von Rubens
bei 150 000 M. Bei einem Anfangspreis von
80 000 M., wie er von der Auktionsleitung vor-
geschlagen war, hätte das Bild vielleicht nicht
nur den Preis von 120 000 M. erzielt, der, wie
sich später herausstellte, als Gebot vorlag,
sondern im freien Spiel der Kräfte vielleicht
sogar die vorgeschriebene Summe erreicht
und überschritten. Erfahrungsgemäß regen
gerade niedrige Limite, oder noch besser, das
völlige Fehlen von Limiten, die Kauflust des
Publikums an. Von weiteren Limiten nennen
wir: für den Meisu „Dame am Fenster" 40 000
Mark, Pieter de Hooch „Stickerin" 40 000 M.,
Rembrandt „Mädchenbildnis" 95 000 M., Ruys-
daels Landschaft 40 000 M., die „Zeitungs-
leserin“ und „Lustige Gesellschaft" von Jan
Steen 50 000 resp. 40 000 M.
Es ist zu begrüßen, daß das Auktionshaus
nicht zur Verschleierungspolitik griff und den
Versuch machte, die Preise zu treiben, son-
dern die Situation von vornherein offen dar-
legte. Das Vorgehen der Erben ist umso
tadelnswerter, als einige der Werke der
Sammlung durch die Bemühung des Auktions-
hauses von der Liste der national wertvollen
Kunstwerke freigegeben wurden, und zwar
im Hinblick auf die in Deutschland statt-
findende Auktion, die den inländischen Samm-
lern und Museen noch einmal Gelegenheit
geben sollte, die Werke für Deutschland zu
erhalten. Hier bedarf es unseres Erachtens
noch der Klärung, die vielleicht ein Prozeß
bringen wird.
Von den ganzen insgesamt 24 Bildern
wurden nur fünf Stück zugeschlagen, und zwar
wurden verkauft: Nr. 6, G. D o u, Bildnis von
Rembrandts Mutter (25:20 cm), für 15 700 M.
(Käufer Dr. Beets), Nr. 7, G. Dou, Weibliches
Bildnis (15,5 : 15,5 cm), für 5000 M. (Weisner),
Nr. 8, H o n d e c o e t e r, Henne mit Küchlein
(87 : 75 cm), für 5100 M., Nr. 19, Jan Steen,
„De Rommelpot“ (32:26 cm), für 14 500 M.
(Weisner) und Nr. 23, Teniers d. ]., Land-
schaft (16,5:22,5 cm), für 1600 M. (H. Ball).
Außerdem einige der kleinen Bronzemörser
und Tischglocken zu Preisen von 300—510 M.
Troß dieses Ergebnisses kann man keines-
wegs von einer Katastrophe des Kunsimarktes
sprechen, vielmehr ist das ungünstige Resultat
unseres Erachtens durch den Sonderfall dieser
Auktion zu begründen, den sich hoffenHibh
weitere Auftraggeber zur Lehre nehmen
werden. D.
Museen
und fremde Kunst
Von Prof. Dr. Julius Baum
Wir bringen diene Ausführungen de® Direk-
tors de® Museums der Stadt Ulm, Herrn Prof..
Dr. J. Baum, gern zur Kenntnis, unserer Leser,
ohne zu ihnen in jeder Beziehung Stellung
nehmen zu wollen. Die Redaktion
Von Zeit zu Zeit liest man, daß unsere
Museen zu viel fremde Kunst sammeln, und
daß Abhilfe erfolgen muß. Den Schreibern
sei nicht bestritten, daß sie „berechtigte Be-
lange" zu wahren glauben. Jede öffentliche
Anstali, die der geistigen Erziehung dient,
sollte auch die Erziehung zum Bewußtsein der
eigenen Art zu einer ihrer wichtigsten Auf-
gaben machen. Dies gilt in gleicher Weise
für Theater, Konzertsaal und Museum. Indes
haben gerade die Künste die Eigentümlichkeit,
daß man sie auch ohne irgend eine völkische
Einstellung in sich aufnehmen kann. Die
Franzosen fühlten sich mit Recht verarmt,
wenn man ihnen Mozart, Beelhoven oder
Wagner nähme. Wir selbst, die wir doch mit
Recht glauben, daß unsere eigene Musik unser
musikalisches Bedürfnis vollauf stillen kann,
verzichten nicht gerne auf die Italiener.
Warum sollen gerade die Museen engherziger
sein, als die anderen öffentlichen Kunst-
anstalten?
Zunächst ist zu bemerken, daß der Begriff
„deutsch“ in der Kunst unter allen Um-
ständen weiter zu fassen ist, als in der
Politik. Der treffliche Langbehn hat mit
Recht Rembrandt und Shakespeare, zwei
Künstler, die außerhalb unseres heutigen
politischen Deutschland tätig waren, als die
besten Deutschen hingestellt. In der Tat geht
es unter keinen Umständen an, Gogh, der
nach Grünewald wohl der leidenschaftlichste
Maler war, weniger zu den Deutschen zu
rechnen, als etwa die in der Schweiz gebore-
nen Böcklin und Hodler. Man muß die Kunst
aus dem Blut zu erfühlen suchen, nicht aus
der Zufälligkeit des Geburtsortes. Damit ist
zugleich gesagt, daß, so gut wie ein deutscher
Künstler von uns erlebt werden kann, wir auch
die Fähigkeit erwerben können, uns in fremd-
rassige Künstler einzufühlen. Vielleicht ist es
sogar, um das Deutsche völlig zu erkennen,
notwendig, das Fremdartige zur Vergleichung
heranzuziehen. Es bedeutete daher eine Ver-
armung, wenn unsere Museen nicht auch
fremde Kunst pflegen wollten.
Hierbei ist kein Unterschied zwischen
großen und kleinen Museen zu machen.
Selbstverständlich wird die Pflege des
Heimischen immer am wichtigsten sein
müssen. Aber schon der Begriff heimisch ist
nicht eindeutig. Wenn der Museumsleiter eine
gute italienische Arbeit sichert, die sich in
einer Kirche seines engeren Bezirkes befand
und die in Gefahr steht, verkauft zu werden,
so bringt er, vom deutschen Standpunkt aus
gesehen, einen Fremdkörper in sein Museum.
Dennoch ist die Bewahrung dieses Fremd-
körpers ebenso berechtigt, wie die Rettung
der römischen und keltischen Bodenfunde im
Museum, die auch nicht deutsch sind, aber
doch Wesentliches über die Geschichte un-
serer Heimat aussagen. Nun sind zwar mo-
derne ausländische Bilder in der Regel nicht
so eng mit unserer Kultur verwachsen, wie
etwa die Bilder italienischer Künstler in den
Klosterkirchen des 18. Jahrhunderts; dennoch
gehören sie zu unserer geistigen Gesamt-
kultur. Man kann sie so wenig missen, wie
fremde Dichtung oder fremde Musik. Zumal
wenn die Museumsstadt gleichzeitig Kunst-
schulen besißt und jüngeren Künstlern, aber
auch ganz allgemein Menschen mit jungen
Herzen Anregung geben soll, ist das Bedürf-
nis nach Erwerbung nicht nur heimischen
Kunstgules unabweislich. Es wird immer dem
Takt des Museumsleiters überlassen werden
müssen, wie weit er fremde Kunst zuzieht.
Nicht nur dem eigenen Takt, sondern nicht
weniger dem Horizont, den er den Besuchern
seines Museums zufrauf.
Daß die Museen die Aufgabe hätten, die
wirtschaftliche Not der Künstler ihres Bezirks
zu lindern, ist eine Behauptung, die vom
Standpunkt der allgemeinen Bedeutung der
Museen mit größter Entschiedenheit bestritten
werden muß. Museen sind Volksbildungs-
stätten. Für ihre Verwaltung kommt lediglich
Byzantinisches Kreuz um 575 n. Chr.
aus dem Besitz Justinians II.
Croix byzantine vers 575
Byzantine cross about 575
Collection Louis Marx, Frankfurt a. M.
Versteigerung — Vente — Sale:
Hugo Helbing, Frankfurt a. M.
am 9. u. 10. Dezember 1930
der Gesichtspunkt der Pflege der geistigen
Kultur in Frage. Naturgemäß wird in Museen
zunächst die heimische Kunst gefördert, so-
weit sie den genannten Belangen entspricht.
Aber die Museen sind keine Wohltätigkeits-
anstalten.
Die
Geheimnisse Professor Rocchis
Von Gerhard Reinboth, Rom
Leider einen Monat zu spät hat die Witwe
des Prof. Rocchi ihre Rechte geltend gemacht
und so die Augen auf einen der merkwürdig-
sten und interessantesten Fälle des Erb-
schaftsrechtes von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen gelenkt, — einen Monat zu spät,
weil andernfalls der internationale Experten-
kongreß, tagend im Kapitol, sich bewußt ge-
wesen wäre, daß in Rufweite auf dem Palatin
hinter Schloß und Amtssiegel die Geheimnisse
eines der genialsten Restauratoren der Neu-
zeit unter Staub zerfallen, Opfer des Büro-
kratismus werden und vielleicht in das Un-
bekannte zurücksinken.
Prof. Francesco Rocchi, den die italieni-
schen Museumsdirektoren scherzhaft und doch
voller Anerkennung den „Magier vom Pala-
tin" nannten, war mit elf Jahren ein armer
Waisenjunge, der nicht nur sich, sondern noch
Schwestern mit dem Binden von Büchern er-
nähren mußte. Der Junge zeigte einen un-
stillbaren Trieb nach Wissen, studierte neben
seiner harten Arbeit Latein, Geschichte,
Physik, Chemie und Kunstgeschichte, eine
JOSEFSPL^TZ 5
(Palais Fallaväciaal]
G&LOIS SÄMCT lücas
ALTS
WIO I
THEODOOR ROZENDAAL mohrehstr. 6
BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN nahe kaiserhof “
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRING oe LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance