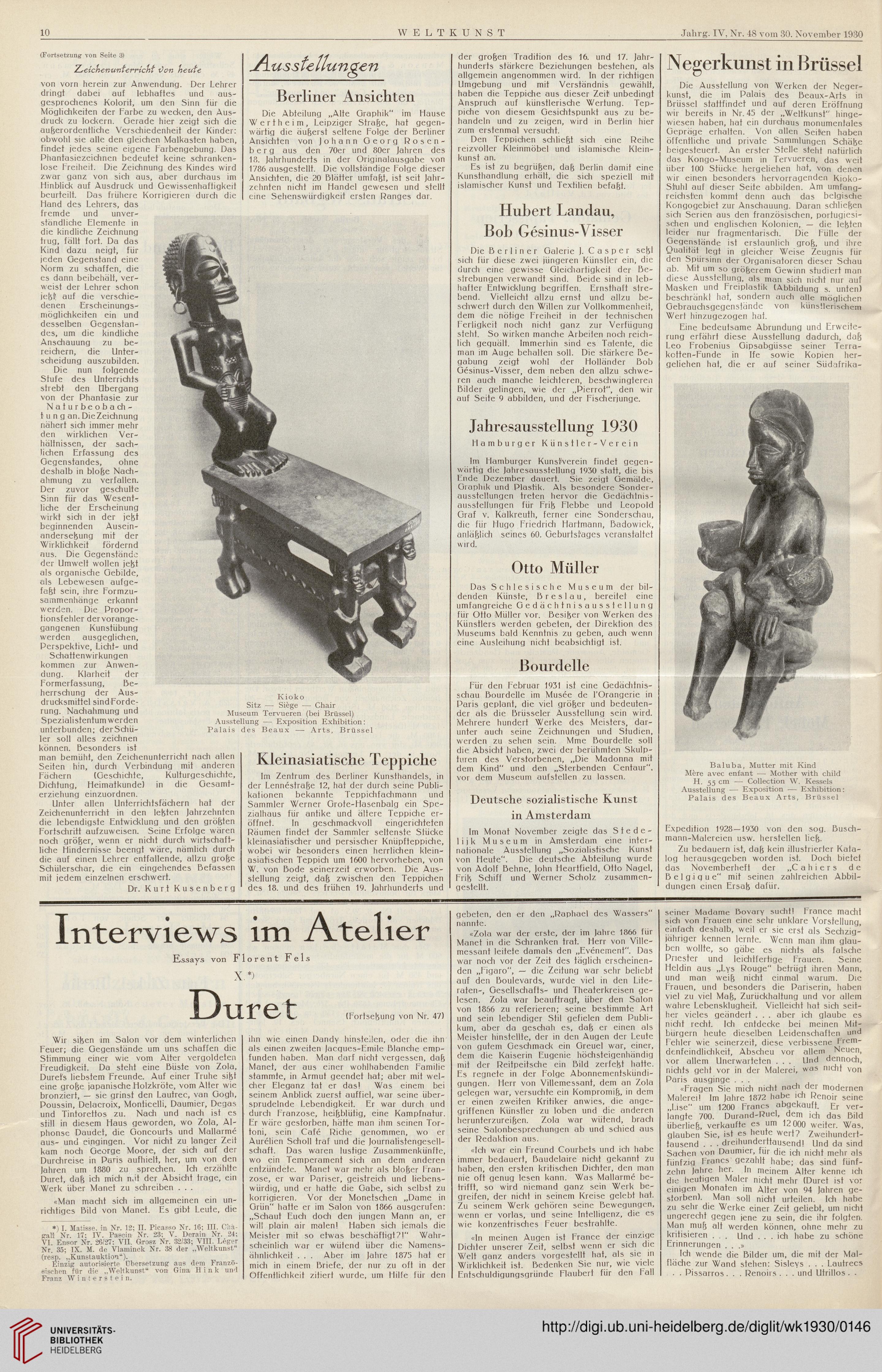10
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930
(Fortsetzung von Seite 3)
Z^eiche.'nuni'erricht Von heute
von vorn herein zur Anwendung. Der Lehrer
dringt dabei auf lebhaftes und aus-
gesprochenes Kolorit, um den Sinn für die
Möglichkeiten der Farbe zu wecken, den Aus-
druck zu lockern. Gerade hier zeigt sich die
außerordentliche Verschiedenheit der Kinder:
obwohl sie alle den gleichen Malkasten haben,
findet jedes seine eigene Farbengebung. Das
Phantasiezeichnen bedeutet keine schranken-
lose Freiheit. Die Zeichnung des Kindes wird
zwar ganz von sich aus, aber durchaus im
Hinblick auf Ausdruck und Gewissenhaftigkeit
beurteilt. Das frühere Korrigieren durch die
Hand des Lehrers, das
fremde und unver-
ständliche Elemente in
die kindliche Zeichnung
trug, fällt fort. Da das
Kind dazu neigt, für
jeden Gegenstand eine
Norm zu schaffen, die
es dann beibehält, ver-
weist der Lehrer schon
jeßij auf die verschie-
denen Erscheinungs-
möglichkeiten ein und
desselben Gegenstan-
des, um die kindliche
Anschauung zu be-
reichern, die Unter-
scheidung auszubilden.
Die nun folgende
Stufe des Unterrichts
strebt den Übergang
von der Phantasie zur
Naturbeo bach-
tung an. Die Zeichnung
nähert sich immer mehr
den wirklichen Ver-
hältnissen, der sach-
lichen Erfassung des
Gegenstandes, ohne
deshalb in bloße Nach-
ahmung zu verfallen.
Der zuvor geschulte
Sinn für das Wesent-
liche der Erscheinung
wirkt sich in der jeßt
beginnenden Ausein-
anderseßung mit der
Wirklichkeit fördernd
aus. Die Gegenstände
der Umwelt wollen jeßt
als organische Gebilde,
als Lebewesen aufge-
faßt sein, ihre Formzu-
sammenhänge erkannt
werden. Die Propor-
tionsfehler dervorange-
gangenen Kunstübung
werden ausgeglichen,
Perspektive, Licht- und
Schattenwirkungen
kommen zur Anwen-
dung. Klarheit der
Formerfassung, Be-
herrschung der Aus-
di ucksmiftel sindForde-
rung. Nachahmung und
Spezialistentum werden
unterbunden; derSchü-
ler soll alles zeichnen
können. Besonders ist
man bemüht, den Zeichenunterricht nach allen
Seiten hin, durch Verbindung mit anderen
Fächern (Geschichte, Kulturgeschichte,
Dichtung, Heimatkunde) in die Gesamt-
erziehung einzuordnen.
Unter allen Unterrichtsfächern hat der
Zeichenunterricht in den leßten Jahrzehnten
die lebendigste Entwicklung und den größten
Fortschritt aufzuweisen. Seine Erfolge wären
noch größer, wenn er nicht durch wirtschaft-
liche Hindernisse beengt wäre, nämlich durch
die auf einen Lehrer entfallende, allzu große
Schülerschar, die ein eingehendes Befassen
mit jedem einzelnen erschwert.
Dr. Kurt Kusenberg
Berliner Ansichten
Die Abteilung „Alte Graphik“ im Hause
Wertheim, Leipziger Straße, hat gegen-
wärtig die äußerst seltene Folge der Berliner
Ansichten von Johann Georg Rosen-
berg aus den 70er und 80er Jahren des
18. Jahrhunderts in der Originalausgabe von
1786 ausgestellt. Die vollständige Folge dieser
Ansichten, die 20 Blätter umfaßt, ist seit Jahr-
zehnten nicht im Handel gewesen und stellt
eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges dar.
Kleinasiatische Teppiche
Im Zentrum des Berliner Kunsthandels, in
der Lennestraße 12, hat der durch seine Publi-
kationen bekannte Teppichfachmann und
Sammler Werner Grote-Hasenbalg ein Spe-
zialhaus für antike und ältere Teppiche er-
öffnet. In geschmackvoll eingerichteten
Räumen findet der Sammler seltenste Stücke
kleinasiatischer und persischer Knüpfteppiche,
wobei wir besonders einen herrlichen klein-
asiatischen Teppich um 1600 hervorheben, von
W. von Bode seinerzeit erworben. Die Aus-
stellung zeigt, daß zwischen den Teppichen
des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts und
Kioko
Sitz —• Siege — Chair
Museum Tervueren (bei Brüssel)
Ausstellung — Exposition Exhibition:
Palais des Beaux — Arts, Brüssel
Ausste Uunge n
der großen Tradition des 16. und 17. Jahr-
hunderts stärkere Beziehungen bestehen, als
allgemein angenommen wird. In der richtigen
Umgebung und mit Verständnis gewählt,
haben die Teppiche aus dieser Zeit unbedingt
Anspruch auf künstlerische Wertung. Tep-
piche von diesem Gesichtspunkt aus zu be-
handeln und zu zeigen, wird in Berlin hier
zum erstenmal versucht.
Den Teppichen schließt sich eine Reihe
reizvoller Kleinmöbel und islamische Klein-
kunst an.
Es ist zu begrüßen, daß Berlin damit eine
Kunsthandlung erhält, die sich speziell mit
islamischer Kunst und Textilien befaßt.
Hubert Landau,
Bob Gesinus-Visser
Die Berliner Galerie J. Casper seßi
sich für diese zwei jüngeren Künstler ein, die
durch eine gewisse Gleichartigkeit der Be-
strebungen verwandt sind. Beide sind in leb-
hafter Entwicklung begriffen. Ernsthaft stre-
bend. Vielleicht allzu ernst und allzu be-
schwert durch den Willen zur Vollkommenheit,
dem die nötige Freiheit in der technischen
Fertigkeit noch nicht ganz zur Verfügung
steht. So wirken manche Arbeiten noch reich-
lich geguält. Immerhin sind es Talente, die
man im Auge behalien soll. Die stärkere Be-
gabung zeigt wohl der Holländer Bob
Gesinus-Visser, dem neben den allzu schwe-
ren auch manche leichteren, beschwingteren
Bilder gelingen, wie der „Pierrot“, den wir
auf Seite 9 abbilden, und der Fischerjunge.
Jahresausstellung 1930
Hamburger Künstler -Verein
Im Hamburger Kunsi’verein findet gegen-
wärtig die Jahresausstellung 1930 statt, die bis
Ende Dezember dauert. Sie zeigt Gemälde,
Graphik und Plastik. Als besondere Sonder-
ausstellungen treten hervor die Gedächtnis-
ausstellungen für Friß Flebbe und Leopold
Graf v. Kalkreuth, ferner eine Sonderschau,
die für Hugo Friedrich Hartmann, Badowiek,
anläßlich seines 60. Geburtstages veranstaltet
wird.
Otto Müller
Das Schlesische Museum der bil-
denden Künste, Breslau, bereitet eine
umfangreiche Gedächtnisausstellung
für Otto Müller vor. Besißer von Werken des
Künstlers werden gebeten, der Direktion des
Museums bald Kenntnis zu geben, auch wenn
eine Ausleihung nicht beabsichtig! ist.
Bour delle
Für den Februar 1931 ist eine Gedächtnis-
schau Bourdelle im Musee de l’Orangerie in
Paris geplant, die viel größer und bedeuten-
der als die Brüsseler Ausstellung sein wird.
Mehrere hundert Werke des Meisters, dar-
unter auch seine Zeichnungen und Studien,
werden zu sehen sein. Mme Bourdelle soll
die Absicht haben, zwei der berühmten Skulp-
turen des Verstorbenen, „Die Madonna mit
dem Kind" und den „Sterbenden Centaur“,
vor dem Museum aufstellen zu lassen.
Deutsche sozialistische Kunst
in Amsterdam
Im Monat November zeigte das Stede-
lijk Museum in Amsterdam eine inter-
nationale Ausstellung „Sozialistische Kunst
von Heute“. Die deutsche Abteilung wurde
von Adolf Behne, John Heartfield, Otto Nagel,
Friß Schiff und Werner Scholz zusammen-
gestellt.
Negerkunst in Brüssel
Die Ausstellung von Werken der Neger-
kunst, die im Palais des Beaux-Arts in
Brüssel stattfindet und auf deren Eröffnung
wir bereits in Nr. 45 der „Weltkunst" hinge-
wiesen haben, hat ein durchaus monumentales
Gepräge erhalten. Von allen Seifen haben
öffentliche und private Sammlungen Schäße
beigesfeuert. An erster Stelle steht natürlich
das Kongo-Museum in Tervueren, das weit
über 100 Stücke hergeliehen hat, von denen
wir einen besonders hervorragenden Kioko-
Stluhl auf dieser Seite abbilden. Am umfang-
reichsten kommt denn auch das belgische
Kongogebiet zur Anschauung. Daran schließen
sich Serien aus den französischen, portugiesi-
schen und englischen Kolonien, — die leßten
leider nur fragmentarisch. Die Fülle der
Gegenstände ist erstaunlich groß, und ihre
Qualität legt in gleicher Weise Zeugnis für
den Spürsinn der Organisatoren dieser Schau
ab. Mit um so größerem Gewinn studiert man
diese Ausstellung, als man sich nicht nur auf
Masken und Freiplastik (Abbildung s. unten)
beschränkt Jiat, sondern auch alle möglichen
Gebrauchsgegenstände von künstlerischem
Wert hinzugezogen hat.
Eine bedeutsame Abrundung und Erweite-
rung erfährt diese Ausstellung dadurch, daß
Leo Frobenius Gipsabgüsse seiner Terra-
kotten-Funde in Ife sowie Kopien her-
geliehen hat, die er auf seiner Südafrika-
Baluba, Mutter mit Kind
Mere avec enfant — Mother with child
H. 55 cm — Collection W. Kessels
Ausstellung ■— Exposition — Exhibition:
Palais des Beaux Arts, Brüssel
Expedition 1928—1930 von den sog. Busch-
mann-Malereien usw. hersfellen ließ.
Zu bedauern ist, daß kein illustrierter Kata-
log herausgegeben worden ist. Doch bietet
das Novemberheft der „Cahiers de
Belg.igue“ mit seinen zahlreichen Abbil-
dungen einen Ersaß dafür.
Interviews im Atelier
Essays von Florent Fels
Duret
(Fortseßung von Nr. 47)
Wir sißen im Salon vor dem winterlichen
Feuer; die Gegenstände um uns schaffen die
Stimmung einer wie vom Alter vergoldeten
Freudigkeit. Da steht eine Büste von Zola,
Durei's liebstem Freunde. Auf einer Truhe sißt
eine große japanische Holzkröte, vom Alter wie
bronziert, — sie grinst den Lautrec, van Gogh,
Poussin, Delacroix, Monticelli, Daumier, Degas
und Tintorettos zu. Nach und nach ist es
siill in diesem Haus geworden, wo Zola, Al-
phonse Daudet, die Goncourts und Mallarme
aus- und eingingen. Vor nicht zu langer Zeit
kam noch George Moore, der sich auf der
Durchreise in Paris aufhielt, her, um von den
Jahren um 1880 zu sprechen. Ich erzählte
Duret, daß ich mich n.it der Absicht trage, ein
Werk über Manet zu schreiben . . .
«Man macht sich im allgemeinen ein un-
richtiges Bild von Manet. Es gibt Leute, die
*) I. Matisse, in Nr. 12; II. Picasso Nr. 16; III. Cha-
gall Nr. 17; IV. Paise-in Nr. 23; V. Dera in Nr. 24;
VI. Ensoir Nr. 26127: VII. Grosz Nr. 32133; VIII. Läger
Nr. 35; IX. M. de Vlaminck Nr. 38 der „Weltkunst“
(resp. „Kunstauktion“).
Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Franzö-
sischen für die ..Weltkunst“ von Gina Hink und
Franz Winterstein.
ihn wie einen Dandy hinstellen, oder die ihn
als einen zweiten Jacgues-Emile Blanche emp-
funden haben. Man darf nicht vergessen, daß
Manet, der aus einer wohlhabenden Familie
stammte, in Armut geendet hat; aber mit wel-
cher Eleganz tat er das! Was einem bei
seinem Anblick zuerst auffiel, war seine über-
sprudelnde Lebendigkeit. Er war durch und
durch Franzose, heißblütig, eine Kampfnatur.
Er wäre gestorben, hätte man ihm seinen Tor-
toni, sein Cafe Riehe genommen, wo er
Aurelien Scholl traf und die Journalistengesell-
schaff. Das waren lustige Zusammenkünfte,
wo ein Temperament sich an dem anderen
entzündete. Manet war mehr als bloßer Fran-
zose, er war Pariser, geistreich und liebens-
würdig, und er hatte die Gabe, sich selbst zu
korrigieren. Vor der Monetschen „Dame in
Grün" hatte er im Salon von 1866 ausgerufen:
„Schaut Euch doch den jungen Mann an, er
will plain air malen! Haben sich jemals die
Meister mit so etwas beschäftigt?!" Wahr-
scheinlich war er wütend über die Namens-
ähnlichkeit . . . Aber im Jahre 1875 hat er
mich in einem Briefe, der nur zu oft in der
Öffentlichkeit zitiert wurde, um Hilfe für den
gebeten, den er den „Raphael des Wassers“
nannte.
«Zola war der erste, der im Jahre 1866 für
Manet in die Schranken trat. Herr von Ville—
messant leitete damals den „Evenement". Das
war noch vor der Zeit des täglich erscheinen-
den „Figaro“, — die Zeitung war sehr beliebt
auf den Boulevards, wurde viel in den Lite-
raten-, Gesellschafts- und Theaterkreisen ge-
lesen. Zola war beauftragt, über den Salon
von 1866 zu referieren; seine bestimmte Art
und sein lebendiger Stil gefielen dem Publi-
kum, aber da geschah es, daß er einen als
Meister hinstellte, der in den Augen der Leute
von gutem Geschmack ein Greuel war, einer,
dem die Kaiserin Eugenie höchsteigenhändig
mit der Reitpeitsche ein Bild zerfeßt hatte.
Es regnete in der Folge Abonnementskündi-
gungen. Herr von Villemessant, dem an Zola
gelegen war, versuchte ein Kompromiß, in dem
er einen zweiten Kritiker anwies, die ange-
griffenen Künstler zu loben und die anderen
herunterzureißen. Zola war wütend, brach
seine Salonbesprechungen ab und schied aus
der Redaktion aus.
«Ich war ein Freund Courbets und ich habe
immer bedauert, Baudelaire nicht gekannt zu
haben, den ersten kritischen Dichter, den man
nie oft genug lesen kann. Was Mallarme be-
trifft, so wird niemand ganz sein Werk be-
greifen, der nicht in seinem Kreise gelebt hat.
Zu seinem Werk gehören seine Bewegungen,
wenn er vorlas, und seine Intelligenz, die es
wie konzentrisches Feuer bestrahlte.
«In meinen Augen ist France der einzige
Dichter unserer Zeit, selbst wenn er sich die
Welt ganz anders vorgestellt hat, als sie in
Wirklichkeit ist. Bedenken Sie nur, wie viele
Entschuldigungsgründe Flaubert für den Fall
seiner Madame Bovary sucht! France macht
sich von Frauen eine sehr unklare Vorstellung,
einfach deshalb, weil er sie erst als Sechzig-
jähriger kennen lernte. Wenn man ihm glau-
ben wollte, so gäbe es nichts als falsche
Priester und leichtfertige Frauen. Seine
Heldin aus „Lys Rouge" betrügt ihren Mann,
und man weiß nicht einmal warum. Die
Frauen, und besonders die Pariserin, haben
viel zu viel Maß, Zurückhaltung und vor allem
wahre Lebensklugheit. Vielleicht hat sich seit-
her vieles geändert . . . aber ich glaube es
nicht recht. Ich entdecke bei meinen Mit-
bürgern heute dieselben Leidenschaften und
Fehler wie seinerzeit, diese verbissene Frem-
denfeindlichkeit, Abscheu vor allem Neuen,
vor allem Unerwarteten . . . Und dennoch,
nichts geht vor in der Malerei, was nicht von
Paris ausginge . . .
«Fragen Sie mich nicht nach der modernen
Malerei! Im Jahre 1872 habe ich Renoir seine
„l.ise" um 1200 Francs abgekauft. Er ver-
langte 700. Durand-Ruel, dem ich das Bild
überließ, verkaufte es um 12 000 weiter. Was,
glauben Sie, ist es heute wert? Zweihundert-
tausend . . - dreihunderttausend! Und da sind
Sachen von Daumier, für die ich nicht mehr als
fünfzig Francs gezahlt habe; das sind fünf-
zehn Jahre her. In meinem Alter kenne ich
die heutigen Maler nicht mehr (Duret ist vor
einigen Monaten im Alter von 94 Jahren ge-
storben). Man soll nicht urteilen. Ich habe
zu sehr die Werke einer Zeit geliebt, um nicht
ungerecht gegen jene zu sein, die ihr folgten.
Man muß alt werden können, ohne mehr zu
kritisieren . . . Und ... ich habe zu schöne
Erinnerungen . . .»
Ich wende die Bilder um, die mit der Mal-
fläche zur Wand stehen: Sisleys . . . Lautrecs
• . Pissarros. . . Renoirs . . . und Ufrillos . .
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 48 vom 30. November 1930
(Fortsetzung von Seite 3)
Z^eiche.'nuni'erricht Von heute
von vorn herein zur Anwendung. Der Lehrer
dringt dabei auf lebhaftes und aus-
gesprochenes Kolorit, um den Sinn für die
Möglichkeiten der Farbe zu wecken, den Aus-
druck zu lockern. Gerade hier zeigt sich die
außerordentliche Verschiedenheit der Kinder:
obwohl sie alle den gleichen Malkasten haben,
findet jedes seine eigene Farbengebung. Das
Phantasiezeichnen bedeutet keine schranken-
lose Freiheit. Die Zeichnung des Kindes wird
zwar ganz von sich aus, aber durchaus im
Hinblick auf Ausdruck und Gewissenhaftigkeit
beurteilt. Das frühere Korrigieren durch die
Hand des Lehrers, das
fremde und unver-
ständliche Elemente in
die kindliche Zeichnung
trug, fällt fort. Da das
Kind dazu neigt, für
jeden Gegenstand eine
Norm zu schaffen, die
es dann beibehält, ver-
weist der Lehrer schon
jeßij auf die verschie-
denen Erscheinungs-
möglichkeiten ein und
desselben Gegenstan-
des, um die kindliche
Anschauung zu be-
reichern, die Unter-
scheidung auszubilden.
Die nun folgende
Stufe des Unterrichts
strebt den Übergang
von der Phantasie zur
Naturbeo bach-
tung an. Die Zeichnung
nähert sich immer mehr
den wirklichen Ver-
hältnissen, der sach-
lichen Erfassung des
Gegenstandes, ohne
deshalb in bloße Nach-
ahmung zu verfallen.
Der zuvor geschulte
Sinn für das Wesent-
liche der Erscheinung
wirkt sich in der jeßt
beginnenden Ausein-
anderseßung mit der
Wirklichkeit fördernd
aus. Die Gegenstände
der Umwelt wollen jeßt
als organische Gebilde,
als Lebewesen aufge-
faßt sein, ihre Formzu-
sammenhänge erkannt
werden. Die Propor-
tionsfehler dervorange-
gangenen Kunstübung
werden ausgeglichen,
Perspektive, Licht- und
Schattenwirkungen
kommen zur Anwen-
dung. Klarheit der
Formerfassung, Be-
herrschung der Aus-
di ucksmiftel sindForde-
rung. Nachahmung und
Spezialistentum werden
unterbunden; derSchü-
ler soll alles zeichnen
können. Besonders ist
man bemüht, den Zeichenunterricht nach allen
Seiten hin, durch Verbindung mit anderen
Fächern (Geschichte, Kulturgeschichte,
Dichtung, Heimatkunde) in die Gesamt-
erziehung einzuordnen.
Unter allen Unterrichtsfächern hat der
Zeichenunterricht in den leßten Jahrzehnten
die lebendigste Entwicklung und den größten
Fortschritt aufzuweisen. Seine Erfolge wären
noch größer, wenn er nicht durch wirtschaft-
liche Hindernisse beengt wäre, nämlich durch
die auf einen Lehrer entfallende, allzu große
Schülerschar, die ein eingehendes Befassen
mit jedem einzelnen erschwert.
Dr. Kurt Kusenberg
Berliner Ansichten
Die Abteilung „Alte Graphik“ im Hause
Wertheim, Leipziger Straße, hat gegen-
wärtig die äußerst seltene Folge der Berliner
Ansichten von Johann Georg Rosen-
berg aus den 70er und 80er Jahren des
18. Jahrhunderts in der Originalausgabe von
1786 ausgestellt. Die vollständige Folge dieser
Ansichten, die 20 Blätter umfaßt, ist seit Jahr-
zehnten nicht im Handel gewesen und stellt
eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges dar.
Kleinasiatische Teppiche
Im Zentrum des Berliner Kunsthandels, in
der Lennestraße 12, hat der durch seine Publi-
kationen bekannte Teppichfachmann und
Sammler Werner Grote-Hasenbalg ein Spe-
zialhaus für antike und ältere Teppiche er-
öffnet. In geschmackvoll eingerichteten
Räumen findet der Sammler seltenste Stücke
kleinasiatischer und persischer Knüpfteppiche,
wobei wir besonders einen herrlichen klein-
asiatischen Teppich um 1600 hervorheben, von
W. von Bode seinerzeit erworben. Die Aus-
stellung zeigt, daß zwischen den Teppichen
des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts und
Kioko
Sitz —• Siege — Chair
Museum Tervueren (bei Brüssel)
Ausstellung — Exposition Exhibition:
Palais des Beaux — Arts, Brüssel
Ausste Uunge n
der großen Tradition des 16. und 17. Jahr-
hunderts stärkere Beziehungen bestehen, als
allgemein angenommen wird. In der richtigen
Umgebung und mit Verständnis gewählt,
haben die Teppiche aus dieser Zeit unbedingt
Anspruch auf künstlerische Wertung. Tep-
piche von diesem Gesichtspunkt aus zu be-
handeln und zu zeigen, wird in Berlin hier
zum erstenmal versucht.
Den Teppichen schließt sich eine Reihe
reizvoller Kleinmöbel und islamische Klein-
kunst an.
Es ist zu begrüßen, daß Berlin damit eine
Kunsthandlung erhält, die sich speziell mit
islamischer Kunst und Textilien befaßt.
Hubert Landau,
Bob Gesinus-Visser
Die Berliner Galerie J. Casper seßi
sich für diese zwei jüngeren Künstler ein, die
durch eine gewisse Gleichartigkeit der Be-
strebungen verwandt sind. Beide sind in leb-
hafter Entwicklung begriffen. Ernsthaft stre-
bend. Vielleicht allzu ernst und allzu be-
schwert durch den Willen zur Vollkommenheit,
dem die nötige Freiheit in der technischen
Fertigkeit noch nicht ganz zur Verfügung
steht. So wirken manche Arbeiten noch reich-
lich geguält. Immerhin sind es Talente, die
man im Auge behalien soll. Die stärkere Be-
gabung zeigt wohl der Holländer Bob
Gesinus-Visser, dem neben den allzu schwe-
ren auch manche leichteren, beschwingteren
Bilder gelingen, wie der „Pierrot“, den wir
auf Seite 9 abbilden, und der Fischerjunge.
Jahresausstellung 1930
Hamburger Künstler -Verein
Im Hamburger Kunsi’verein findet gegen-
wärtig die Jahresausstellung 1930 statt, die bis
Ende Dezember dauert. Sie zeigt Gemälde,
Graphik und Plastik. Als besondere Sonder-
ausstellungen treten hervor die Gedächtnis-
ausstellungen für Friß Flebbe und Leopold
Graf v. Kalkreuth, ferner eine Sonderschau,
die für Hugo Friedrich Hartmann, Badowiek,
anläßlich seines 60. Geburtstages veranstaltet
wird.
Otto Müller
Das Schlesische Museum der bil-
denden Künste, Breslau, bereitet eine
umfangreiche Gedächtnisausstellung
für Otto Müller vor. Besißer von Werken des
Künstlers werden gebeten, der Direktion des
Museums bald Kenntnis zu geben, auch wenn
eine Ausleihung nicht beabsichtig! ist.
Bour delle
Für den Februar 1931 ist eine Gedächtnis-
schau Bourdelle im Musee de l’Orangerie in
Paris geplant, die viel größer und bedeuten-
der als die Brüsseler Ausstellung sein wird.
Mehrere hundert Werke des Meisters, dar-
unter auch seine Zeichnungen und Studien,
werden zu sehen sein. Mme Bourdelle soll
die Absicht haben, zwei der berühmten Skulp-
turen des Verstorbenen, „Die Madonna mit
dem Kind" und den „Sterbenden Centaur“,
vor dem Museum aufstellen zu lassen.
Deutsche sozialistische Kunst
in Amsterdam
Im Monat November zeigte das Stede-
lijk Museum in Amsterdam eine inter-
nationale Ausstellung „Sozialistische Kunst
von Heute“. Die deutsche Abteilung wurde
von Adolf Behne, John Heartfield, Otto Nagel,
Friß Schiff und Werner Scholz zusammen-
gestellt.
Negerkunst in Brüssel
Die Ausstellung von Werken der Neger-
kunst, die im Palais des Beaux-Arts in
Brüssel stattfindet und auf deren Eröffnung
wir bereits in Nr. 45 der „Weltkunst" hinge-
wiesen haben, hat ein durchaus monumentales
Gepräge erhalten. Von allen Seifen haben
öffentliche und private Sammlungen Schäße
beigesfeuert. An erster Stelle steht natürlich
das Kongo-Museum in Tervueren, das weit
über 100 Stücke hergeliehen hat, von denen
wir einen besonders hervorragenden Kioko-
Stluhl auf dieser Seite abbilden. Am umfang-
reichsten kommt denn auch das belgische
Kongogebiet zur Anschauung. Daran schließen
sich Serien aus den französischen, portugiesi-
schen und englischen Kolonien, — die leßten
leider nur fragmentarisch. Die Fülle der
Gegenstände ist erstaunlich groß, und ihre
Qualität legt in gleicher Weise Zeugnis für
den Spürsinn der Organisatoren dieser Schau
ab. Mit um so größerem Gewinn studiert man
diese Ausstellung, als man sich nicht nur auf
Masken und Freiplastik (Abbildung s. unten)
beschränkt Jiat, sondern auch alle möglichen
Gebrauchsgegenstände von künstlerischem
Wert hinzugezogen hat.
Eine bedeutsame Abrundung und Erweite-
rung erfährt diese Ausstellung dadurch, daß
Leo Frobenius Gipsabgüsse seiner Terra-
kotten-Funde in Ife sowie Kopien her-
geliehen hat, die er auf seiner Südafrika-
Baluba, Mutter mit Kind
Mere avec enfant — Mother with child
H. 55 cm — Collection W. Kessels
Ausstellung ■— Exposition — Exhibition:
Palais des Beaux Arts, Brüssel
Expedition 1928—1930 von den sog. Busch-
mann-Malereien usw. hersfellen ließ.
Zu bedauern ist, daß kein illustrierter Kata-
log herausgegeben worden ist. Doch bietet
das Novemberheft der „Cahiers de
Belg.igue“ mit seinen zahlreichen Abbil-
dungen einen Ersaß dafür.
Interviews im Atelier
Essays von Florent Fels
Duret
(Fortseßung von Nr. 47)
Wir sißen im Salon vor dem winterlichen
Feuer; die Gegenstände um uns schaffen die
Stimmung einer wie vom Alter vergoldeten
Freudigkeit. Da steht eine Büste von Zola,
Durei's liebstem Freunde. Auf einer Truhe sißt
eine große japanische Holzkröte, vom Alter wie
bronziert, — sie grinst den Lautrec, van Gogh,
Poussin, Delacroix, Monticelli, Daumier, Degas
und Tintorettos zu. Nach und nach ist es
siill in diesem Haus geworden, wo Zola, Al-
phonse Daudet, die Goncourts und Mallarme
aus- und eingingen. Vor nicht zu langer Zeit
kam noch George Moore, der sich auf der
Durchreise in Paris aufhielt, her, um von den
Jahren um 1880 zu sprechen. Ich erzählte
Duret, daß ich mich n.it der Absicht trage, ein
Werk über Manet zu schreiben . . .
«Man macht sich im allgemeinen ein un-
richtiges Bild von Manet. Es gibt Leute, die
*) I. Matisse, in Nr. 12; II. Picasso Nr. 16; III. Cha-
gall Nr. 17; IV. Paise-in Nr. 23; V. Dera in Nr. 24;
VI. Ensoir Nr. 26127: VII. Grosz Nr. 32133; VIII. Läger
Nr. 35; IX. M. de Vlaminck Nr. 38 der „Weltkunst“
(resp. „Kunstauktion“).
Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Franzö-
sischen für die ..Weltkunst“ von Gina Hink und
Franz Winterstein.
ihn wie einen Dandy hinstellen, oder die ihn
als einen zweiten Jacgues-Emile Blanche emp-
funden haben. Man darf nicht vergessen, daß
Manet, der aus einer wohlhabenden Familie
stammte, in Armut geendet hat; aber mit wel-
cher Eleganz tat er das! Was einem bei
seinem Anblick zuerst auffiel, war seine über-
sprudelnde Lebendigkeit. Er war durch und
durch Franzose, heißblütig, eine Kampfnatur.
Er wäre gestorben, hätte man ihm seinen Tor-
toni, sein Cafe Riehe genommen, wo er
Aurelien Scholl traf und die Journalistengesell-
schaff. Das waren lustige Zusammenkünfte,
wo ein Temperament sich an dem anderen
entzündete. Manet war mehr als bloßer Fran-
zose, er war Pariser, geistreich und liebens-
würdig, und er hatte die Gabe, sich selbst zu
korrigieren. Vor der Monetschen „Dame in
Grün" hatte er im Salon von 1866 ausgerufen:
„Schaut Euch doch den jungen Mann an, er
will plain air malen! Haben sich jemals die
Meister mit so etwas beschäftigt?!" Wahr-
scheinlich war er wütend über die Namens-
ähnlichkeit . . . Aber im Jahre 1875 hat er
mich in einem Briefe, der nur zu oft in der
Öffentlichkeit zitiert wurde, um Hilfe für den
gebeten, den er den „Raphael des Wassers“
nannte.
«Zola war der erste, der im Jahre 1866 für
Manet in die Schranken trat. Herr von Ville—
messant leitete damals den „Evenement". Das
war noch vor der Zeit des täglich erscheinen-
den „Figaro“, — die Zeitung war sehr beliebt
auf den Boulevards, wurde viel in den Lite-
raten-, Gesellschafts- und Theaterkreisen ge-
lesen. Zola war beauftragt, über den Salon
von 1866 zu referieren; seine bestimmte Art
und sein lebendiger Stil gefielen dem Publi-
kum, aber da geschah es, daß er einen als
Meister hinstellte, der in den Augen der Leute
von gutem Geschmack ein Greuel war, einer,
dem die Kaiserin Eugenie höchsteigenhändig
mit der Reitpeitsche ein Bild zerfeßt hatte.
Es regnete in der Folge Abonnementskündi-
gungen. Herr von Villemessant, dem an Zola
gelegen war, versuchte ein Kompromiß, in dem
er einen zweiten Kritiker anwies, die ange-
griffenen Künstler zu loben und die anderen
herunterzureißen. Zola war wütend, brach
seine Salonbesprechungen ab und schied aus
der Redaktion aus.
«Ich war ein Freund Courbets und ich habe
immer bedauert, Baudelaire nicht gekannt zu
haben, den ersten kritischen Dichter, den man
nie oft genug lesen kann. Was Mallarme be-
trifft, so wird niemand ganz sein Werk be-
greifen, der nicht in seinem Kreise gelebt hat.
Zu seinem Werk gehören seine Bewegungen,
wenn er vorlas, und seine Intelligenz, die es
wie konzentrisches Feuer bestrahlte.
«In meinen Augen ist France der einzige
Dichter unserer Zeit, selbst wenn er sich die
Welt ganz anders vorgestellt hat, als sie in
Wirklichkeit ist. Bedenken Sie nur, wie viele
Entschuldigungsgründe Flaubert für den Fall
seiner Madame Bovary sucht! France macht
sich von Frauen eine sehr unklare Vorstellung,
einfach deshalb, weil er sie erst als Sechzig-
jähriger kennen lernte. Wenn man ihm glau-
ben wollte, so gäbe es nichts als falsche
Priester und leichtfertige Frauen. Seine
Heldin aus „Lys Rouge" betrügt ihren Mann,
und man weiß nicht einmal warum. Die
Frauen, und besonders die Pariserin, haben
viel zu viel Maß, Zurückhaltung und vor allem
wahre Lebensklugheit. Vielleicht hat sich seit-
her vieles geändert . . . aber ich glaube es
nicht recht. Ich entdecke bei meinen Mit-
bürgern heute dieselben Leidenschaften und
Fehler wie seinerzeit, diese verbissene Frem-
denfeindlichkeit, Abscheu vor allem Neuen,
vor allem Unerwarteten . . . Und dennoch,
nichts geht vor in der Malerei, was nicht von
Paris ausginge . . .
«Fragen Sie mich nicht nach der modernen
Malerei! Im Jahre 1872 habe ich Renoir seine
„l.ise" um 1200 Francs abgekauft. Er ver-
langte 700. Durand-Ruel, dem ich das Bild
überließ, verkaufte es um 12 000 weiter. Was,
glauben Sie, ist es heute wert? Zweihundert-
tausend . . - dreihunderttausend! Und da sind
Sachen von Daumier, für die ich nicht mehr als
fünfzig Francs gezahlt habe; das sind fünf-
zehn Jahre her. In meinem Alter kenne ich
die heutigen Maler nicht mehr (Duret ist vor
einigen Monaten im Alter von 94 Jahren ge-
storben). Man soll nicht urteilen. Ich habe
zu sehr die Werke einer Zeit geliebt, um nicht
ungerecht gegen jene zu sein, die ihr folgten.
Man muß alt werden können, ohne mehr zu
kritisieren . . . Und ... ich habe zu schöne
Erinnerungen . . .»
Ich wende die Bilder um, die mit der Mal-
fläche zur Wand stehen: Sisleys . . . Lautrecs
• . Pissarros. . . Renoirs . . . und Ufrillos . .