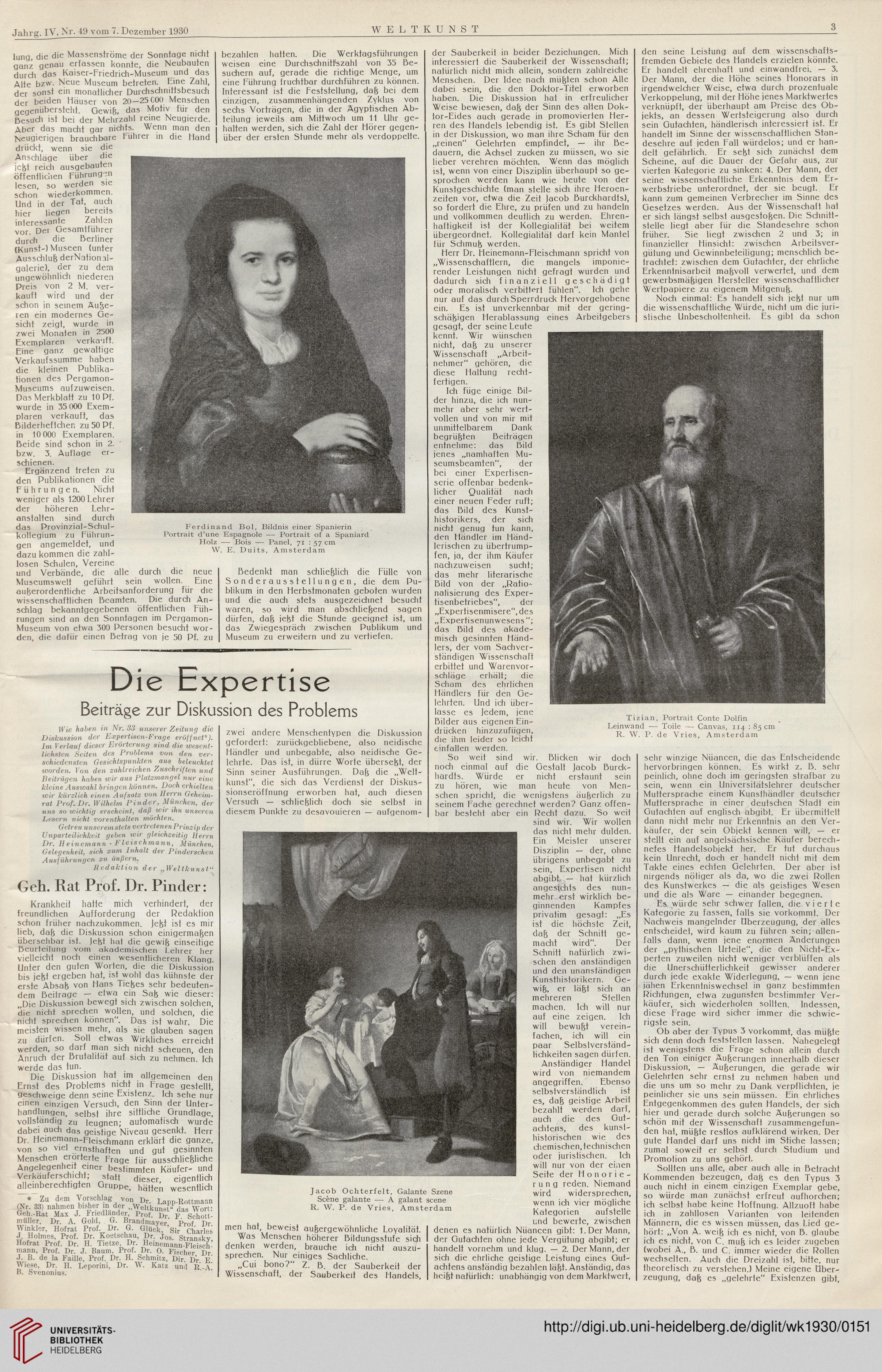Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930
WELT KUNST
3
Führer in die Hand
eines Arbeitgebers
Jacob Ochterfelt, Galante Szene
Scene galante — A galant scene
R. W. P. de Vries, Amsterdam
zur
der
Er-
Er
des
hat
P. de Vries, Amsterdam
durch die neue
sein wollen.
Bedenkt man schließlich die Fülle
Sonderausstellungen, die dem
blikum in den Herbstmonaten geboten
und die auch stets ausgezeichnet
waren, so wird man abschließend
dürfen, daß jeßt die Stunde geeignet
das Zwiegespräch zwischen Publikum und
Museum zu erweitern und zu vertiefen.
zwei andere Menschentypen die Diskussion
gefordert: zurückgebliebene, also neidische
Händler und unbegabte, also neidische Ge-
lehrte. Das ist, in dürre Worte überseßf, der
Sinn seiner Ausführungen. Daß die „Welt-
kunst“, die sich das Verdienst der Diskus-
sionseröffnung erworben hat, auch diesen
Versuch — schließlich doch sie selbst in
diesem Punkte zu desavouieren — aufgenom-
Blicken wir doch
bezahlen hatten. Die Werktagsführungen
weisen eine Durchschnitfezahl von 35 Be-
suchern auf, gerade die richtige Menge, um
eine Führung fruchtbar durchführen zu können.
Interessant ist die Feststellung, daß bei dem
einzigen, zusammenhängenden Zyklus von
sechs Vorträgen, die in der Ägyptischen Ab-
teilung jeweils am Mittwoch um 11 Uhr ge-
halten werden, sich die Zahl der Hörer gegen-
über der ersten Stunde mehr als verdoppelte.
Dank
Beiträgen
das Bild
den seine Leistung auf dem wissenschafts-
fremden Gebiete des Handels erzielen könnte.
Er handelt ehrenhaft und einwandfrei. — 3.
Der Mann, der die Höhe seines Honorars in
irgendwelcher Weise, etwa durch prozentuale
Verkoppelung, mit der Höhe jenes Marktwertes
verknüpft, der überhaupt am Preise des Ob-
jekts, an dessen Wertsteigerung also durch
sein Gutachten, händlerisch interessiert ist. Er
handelt im Sinne der wissenschaftlichen Stan-
desehre auf jeden Fall würdelos; und er han-
delt gefährlich. Er seßt sich zunächst dem
Scheine, auf die Dauer der Gefahr aus,
vierten Kategorie zu sinken: 4. Der Mann,
seine wissenschaftliche Erkenntnis dem
werbstriebe unterordnet, der sie beugt,
kann zum gemeinen Verbrecher im Sinne
Gesetzes werden. Aus der Wissenschaft
er sich längst selbst ausgestoßen. Die Schnitt-
stelle liegt aber für die Standesehre schon
früher. Sie liegt zwischen 2 und 3; in
finanzieller Hinsicht: zwischen Arbeitsver-
gütung und Gewinnbeteiligung; menschlich be-
trachtet: zwischen dem Gutachter, der ehrliche
Erkennfnisarbeit maßvoll verwertet, und dem
gewerbsmäßigen Hersteller wissenschaftlicher
Wertpapiere zu eigenem Mitgenuß.
Noch einmal: Es handelt sich jeßt nur um
die wissenschaftliche Würde, nicht um die juri-
stische Unbescholtenheit. Es gibt da schon
sehr winzige Nüancen, die das Entscheidende
hervorbringen können. Es wirkt z. B. sehr
peinlich, ohne doch im geringsten strafbar zu
sein, wenn ein Universitätslehrer deutscher
Muttersprache einem Kunsthändler deutscher
Muttersprache in einer deutschen Stadt ein
Gutachten auf englisch abgibt. Er übermittelt
dann nicht mehr nur Erkenntnis an den Ver-
käufer, der sein Objekt kennen will, — er
stellt ein auf angelsächsische Käufer berech-
netes Handelsobjekt her. Er tut durchaus
kein Unrecht, doch er handelt nicht mit dem
Takte eines echten Gelehrten. Der aber ist
nirgends nötiger als da, wo die zwei Rollen
des Kunstwerkes — die als geistiges Wesen
und die als Ware — einander begegnen.
Es würde sehr schwer fallen, die vierte
Kategorie zu fassen, falls sie vorkommt. Der
Nachweis mangelnder Überzeugung, der alles
entscheidet, wird kaum zu führen sein; allen-
falls dann, wenn jene enormen Änderungen
der „pythischen Urteile“, die den Nicht-Ex-
perten zuweilen nicht weniger verblüffen als
die Unerschütterlichkeit gewisser anderer
durch jede exakte Widerlegung, — wenn jene
jähen Erkenntniswechsel in ganz bestimmten
Richtungen, etwa zugunsten bestimmter Ver-
käufer, sich wiederholen sollten. Indessen,
diese Frage wird sicher immer die schwie-
rigste sein.
Ob aber der Typus 3 vorkommf, das müßte
sich denn doch feststellen lassen. Nahegelegi
ist wenigstens die Frage schon allein durch
den Ton einiger Äußerungen innerhalb dieser
Diskussion, — Äußerungen, die gerade wir
Gelehrten sehr ernst zu nehmen haben und
die uns um so mehr zu Dank verpflichten, je
peinlicher sie uns sein müssen. Ein ehrliches
Entgegenkommen des guten Handels, der sich
hier und gerade durch solche Äußerungen so
schön mit der Wissenschaft zusammengefun-
den hat, müßte restlos aufklärend wirken. Der
gute Handel darf uns nicht im Stiche lassen;
zumal soweit er selbst durch Studium und
Promotion zu uns gehört.
Sollten uns alle, aber auch alle in Betracht
Kommenden bezeugen, daß es den Typus 3
auch nicht in einem einzigen Exemplar gebe,
so würde man zunächst erfreut aufhorchen;
ich selbst habe keine Hoffnung. Allzuoft habe
ich in zahllosen Varianten von leitenden
Männern, die es wissen müssen, das Lied ge-
hört: „Von A. weiß ich es nicht, von B. glaube
ich es nicht, von C. muß ich es leider zugeben
(wobei A., B. und C. immer wieder die Rollen
wechselten. Auch die Dreizahl ist, bitte, nur
theoretisch zu verstehen.) Meine eigene Über-
zeugung, daß es „gelehrte“ Existenzen gibt.
wir.
die Gestalt Jacob Burck-
er nicht erstaunt sein
man heute von Men-
Tizian, Portrait Conte Dolfin
Leinwand -— Toile — Canvas, 114 : 85 cm
R. W. ~ ' - •
von
Pu-
wurden
besucht
sagen
ist, um
hat kürzlich
des nun-
wirkhch be-
Kampfes
„Es
Zeit,
ge-
Der
zwi-
rnen hat beweist außergewöhnliche Loyalität.
Was Menschen höherer Bildungsstufe sich
denken werden, brauche ich nicht auszu-
sprechen. Nur einiges Sachliche.
„Cui bono?“ Z. B. der Sauberkeit der
Wissenschaft, der Sauberkeit des Handels,
Recht dazu. So weit
sind wir. Wir wollen
das nicht mehr dulden.
Ein Meister unserer
Disziplin — der, ohne
übrigens unbegabt zu
sein, Expertisen nicht
abgibt —
angesichts
mehr erst
ginnenden
privatim gesagt:
ist die höchste
daß der Schnitt
macht wird“.
Schnitt natürlich
sehen den anständigen
und den unanständigen
Kunsthistorikern. Ge-
wiß, er läßt sich an
mehreren Stellen
machen. Ich will nur
auf eine zeigen. Ich
will bewußt verein-
fachen, ich will ein
paar Selbstverständ-
lichkeiten sagen dürfen.
Anständiger Handel
wird von niemandem
angegriffen. Ebenso
selbstverständlich ist
es, daß geistige Arbeit
bezahlt werden darf,
auch die des Gut-
achtens, des kunst-
historischen wie des
chemischen, technischen
oder juristischen. Ich
will nur von der einen
Seife der Honorie-
rung reden. Niemand
wird widersprechen,
wenn ich vier mögliche
Kategorien aufstelle
und bewerte, zwischen
denen es natürlich Nüancen gibt: 1. Der Mann,
der Gutachten ohne jede Vergütung abgibt; er
handelt vornehm und klug. — 2. Der Mann, der
sich die ehrliche geistige Leistung eines Gut-
achtens anständig bezahlen läßt. Anständig, das
heißt natürlich: unabhängig von dem Marktwert,
der Sauberkeit in beider Beziehungen. Mich
interessiert die Sauberkeit der Wissenschaft;
natürlich nicht mich allein, sondern zahlreiche
Menschen. Der Idee nach müßten schon Alle
dabei sein, die den Doktor-Titel erworben
haben. Die Diskussion hat in erfreulicher
Weise bewiesen, daß der Sinn des alten Dok-
tor-Eides auch gerade in promovierten Her-
ren des Handels lebendig ist. Es gibt Stellen
in der Diskussion, wo man ihre Scham für den
„reinen“ Gelehrten empfindet, — ihr Be-
dauern, die Achsel zucken zu müssen, wo sie
lieber verehren möchten. Wenn das möglich
ist, wenn von einer Disziplin überhaupt so ge-
sprochen werden kann wie heute von der
Kunstgeschichte (man stelle sich ihre Heroen-
zeifen vor, etwa die Zeit Jacob Burckhardts),
so fordert die Ehre, zu prüfen und zu handeln
und vollkommen deutlich zu werden. Ehren-
haftigkeit ist der Kollegialität bei weitem
übergeordnet. Kollegialität darf kein Mantel
für Schmuß werden.
Herr Dr. Heinemann-Fleischmann spricht von
„Wissenschaftlern, die mangels imponie-
render Leistungen nicht gefragt wurden und
dadurch sich finanziell geschädigt
oder moralisch verbittert fühlen“. Ich gehe
nur auf das durch Sperrdruck Hervorgehobene
ein. Es ist unverkennbar mit der gering-
schäßigen Herablassung
gesagt, der seine Leute
kennt. Wir wünschen
nicht, daß zu unserer
Wissenschaft „Arbeit-
nehmer“ gehören, die
diese Haltung recht-
fertigen.
Ich füge einige Bil-
der hinzu, die ich nun-
mehr aber sehr wert-
vollen und von mir mit
unmittelbarem
begrüßten
entnehme:
jenes „namhaften Mu-
seumsbeamten“, der
bei einer Expertisen-
serie offenbar bedenk-
licher Qualität nach
einer neuen Feder ruft;
das Bild des Kunst-
historikers, der sich
nicht genug tun kann,
den Händler im Händ-
lerischen zu übertrump-
fen, ja, der ihm Käufer
nachzuweisen sucht;
das mehr literarische
Bild von der „Ratio--
nalisierung des Exper-
tisenbetriebes“, der
„Expertisenmisere“, des
„Expertisenunwesens“;
das Bild des akade-
misch gesinnten Händ-
lers, der vom Sachver-
ständigen Wissenschaft
erbittet und Warenvor-
schläge erhält; die
Scham des ehrlichen
Händlers für den Ge-
lehrten. Und ich über-
lasse es Jedem, jene
Bilder aus eigenen Ein-
drücken hinzuzufügen,
die ihm leider so leicht
einfallen werden.
So weit sind
noch einmal auf
hardts. Würde
zu hören, wie
sehen spricht, die wenigstens äußerlich zu
seinem Fache gerechnet werden? Ganz offen-
bar besteht aber ein
lung, die die Massenströme der Sonntage nicht
ganz genau erfassen konnte, die Neubauten
durch das Kaiser-Friedrich-Museum und das
Alte bzw. Neue Museum betreten. Eine Zahl,
der sonst ein monatlicher Durchschnittsbesuch
der beiden Häuser von 20—25 C00 Menschen
gegenübersteht. Gewiß, das Motiv für den
Besuch ist bei der Mehrzahl reine Neugierde.
Aber das macht gar nichts.^ Wenn man den
Neugierigen brauchbare F '1
drückt, wenn sie die
Anschläge über die
jeßt reich ausgebauten
öffentlichen Führungen
lesen, so werden sie
schon wiederkommen.
Und in der Tat auch
hier liegen bereits
interessante Zahlen
vor. Der Gesamtführer
durch die Berliner
(Kunst-) Museen (unter
Ausschluß derNational-
galerie), der zu dem
ungewöhnlich niederen
Preis von 2 M. ver-
kauft wird und der
schon in seinem Äuße-
ren ein modernes Ge-
sicht zeigt, wurde in
zwei Monaten in 2500
Exemplaren verkauft.
Eine ganz gewaltige
Verkaufssumme haben
die kleinen Publika-
tionen des Pergamon-
Museums aufzuweisen.
Das Merkblatt zu 10 Pf.
wurde in 35 000 Exem-
plaren verkauft, das
Bilderheftchen zu 50 Pf.
in 10 000 Exemplaren.
Beide sind schon in 2.
bzw. 3. Auflage er-
schienen.
Ergänzend treten zu
den Publikationen die
Führungen. Nicht
weniger als 1200 Lehrer
der höheren Lehr-
anstalten sind durch
das Provinzial-Schul-
kollegium zu Führun-
gen angemeldet, und
dazu kommen die zahl-
losen Schulen, Vereine
und Verbände, die alle
Museumswelt geführt sein wollen. Eine
außerordentliche Arbeitsanforderung für die
wissenschaftlichen Beamten. Die durch An-
schlag bekanntgegebenen öffentlichen Füh-
rungen sind an den Sonntagen im Pergamon-
Museum von etwa 300 Personen besucht wor-
den, die dafür einen Betrag von je 50 Pf. zu
Krankheit
freundlichen Aufforderung der
schon früher nachzukommen. Jeßt ist es mir
lieb, daß die Diskussion schon einigermaßen
übersehbar ist. Jeßt hat die gewiß einseitige
Beurteilung vom akademischen Lehrer her
vielleicht noch einen wesentlicheren Klang.
Unter den guten Worten, die die Diskussion
bis jeßt ergeben hat, ist wohl das kühnste der
erste Absaß von Hans Tießes sehr bedeuten-
dem Beitrage — etwa ein Saß wie dieser:
„Die Diskussion bewegt sich zwischen solchen,
die nicht sprechen wollen, und solchen, die
nicht sprechen können“. Das ist wahr. Die
meisten wissen mehr, als sie glauben sagen
zu dürfen. Soll etwas Wirkliches erreicht
werden, so darf man sich nicht scheuen, den
Anruch der Brutalität auf sich zu nehmen. Ich
werde das tun.
Die Diskussion hat im allgemeinen den
Ernst des Problems nicht in Frage gestellt,
geschweige denn seine Existenz. Ich sehe nur
einen einzigen Versuch, den Sinn der Unter-
handlungen, selbst ihre sittliche Grundlage,
vollständig zu ]eugnen; automatisch wurde
dabei auch das geistige Niveau gesenkt. Herr
Dr. Heinemann-Fleischmann erklärt die ganze,
von so viel ernsthaften und gut gesinnten
Menschen erörterte Frage für ausschließliche
Angelegenheit einer bestimmten Käufer- und
Verkäuferschicht; statt dieser eigenHich
alleinberechtigten Gruppe, hätten wesentlich
* Zu dem Vorschlag von Dr Turm Rottmann
(Nr. 33) nahmen bisher in der „Weltkuntt“ da, Wort“
Geh.-Rat Max J. Friedländer, Prof Dr F Spott-
müller, Dr. A. Gold, G. Brandmayer' Prof Dr
Winkler, Hofrat Prof. Dr. G. Glück, ’sir Charles
J. Holmes, Prof. Dr. Koetschau, Dr. Jos Stranskv
Hofrat Prof. Dr. H. Tietze, Dr. Heinemann-Fkisch’
mann, Prof. Dr. J. Baum, Prof. Dr. 0. Fischer Dr
J. B. de la Faille, Prof. Dr. H. Schmitz, Dir. Dr; Ei
Wiese, Dr. H. Leporini, Dr. W. Katz und R-A
B. Svenonius.
Ferdinand Boi, Bildnis einer Spanierin
Portrait d’une Espagnole — Portrait of a Spaniard
Holz — Bois — Panel, 71 : 57 cm
W. " ..
Wie haben in Nr. 33 unserer Zeitung die
Diskussion der Expertisen-Frage eröffnet*).
Im Verlauf dieser Erörterung sind die wesent-
lichsten Seiten des Problems von den ver-
schiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet
worden. Von den zahlreichen Zuschriften und
Beiträgen haben wir aus Platzmangel nur eine
kleine Auswahl bringen können. Doch erhielten
wir kürzlich einen Aufsatz von Herrn Geheim-
rat Prof. Dr. Wilhelm Pinder, München, der
uns so wichtig erscheint, daß wir ihn unseren
Lesern nicht vorenthalten möchten.
Getreu unser em stets vertretenen Prinzip der
Unparteilichkeit geben wir gleichzeitig Herrn
Dr. H einemann - Fleischmann, München,
Gelegenheit, sich zum Inhalt der Pinderschen
Ausführungen zu äußern.
Redaktion der „Weltkunst“
Geh. Rat Prof. Dr. Pinder:
hatte mich verhindert, der
Redaktion
WELT KUNST
3
Führer in die Hand
eines Arbeitgebers
Jacob Ochterfelt, Galante Szene
Scene galante — A galant scene
R. W. P. de Vries, Amsterdam
zur
der
Er-
Er
des
hat
P. de Vries, Amsterdam
durch die neue
sein wollen.
Bedenkt man schließlich die Fülle
Sonderausstellungen, die dem
blikum in den Herbstmonaten geboten
und die auch stets ausgezeichnet
waren, so wird man abschließend
dürfen, daß jeßt die Stunde geeignet
das Zwiegespräch zwischen Publikum und
Museum zu erweitern und zu vertiefen.
zwei andere Menschentypen die Diskussion
gefordert: zurückgebliebene, also neidische
Händler und unbegabte, also neidische Ge-
lehrte. Das ist, in dürre Worte überseßf, der
Sinn seiner Ausführungen. Daß die „Welt-
kunst“, die sich das Verdienst der Diskus-
sionseröffnung erworben hat, auch diesen
Versuch — schließlich doch sie selbst in
diesem Punkte zu desavouieren — aufgenom-
Blicken wir doch
bezahlen hatten. Die Werktagsführungen
weisen eine Durchschnitfezahl von 35 Be-
suchern auf, gerade die richtige Menge, um
eine Führung fruchtbar durchführen zu können.
Interessant ist die Feststellung, daß bei dem
einzigen, zusammenhängenden Zyklus von
sechs Vorträgen, die in der Ägyptischen Ab-
teilung jeweils am Mittwoch um 11 Uhr ge-
halten werden, sich die Zahl der Hörer gegen-
über der ersten Stunde mehr als verdoppelte.
Dank
Beiträgen
das Bild
den seine Leistung auf dem wissenschafts-
fremden Gebiete des Handels erzielen könnte.
Er handelt ehrenhaft und einwandfrei. — 3.
Der Mann, der die Höhe seines Honorars in
irgendwelcher Weise, etwa durch prozentuale
Verkoppelung, mit der Höhe jenes Marktwertes
verknüpft, der überhaupt am Preise des Ob-
jekts, an dessen Wertsteigerung also durch
sein Gutachten, händlerisch interessiert ist. Er
handelt im Sinne der wissenschaftlichen Stan-
desehre auf jeden Fall würdelos; und er han-
delt gefährlich. Er seßt sich zunächst dem
Scheine, auf die Dauer der Gefahr aus,
vierten Kategorie zu sinken: 4. Der Mann,
seine wissenschaftliche Erkenntnis dem
werbstriebe unterordnet, der sie beugt,
kann zum gemeinen Verbrecher im Sinne
Gesetzes werden. Aus der Wissenschaft
er sich längst selbst ausgestoßen. Die Schnitt-
stelle liegt aber für die Standesehre schon
früher. Sie liegt zwischen 2 und 3; in
finanzieller Hinsicht: zwischen Arbeitsver-
gütung und Gewinnbeteiligung; menschlich be-
trachtet: zwischen dem Gutachter, der ehrliche
Erkennfnisarbeit maßvoll verwertet, und dem
gewerbsmäßigen Hersteller wissenschaftlicher
Wertpapiere zu eigenem Mitgenuß.
Noch einmal: Es handelt sich jeßt nur um
die wissenschaftliche Würde, nicht um die juri-
stische Unbescholtenheit. Es gibt da schon
sehr winzige Nüancen, die das Entscheidende
hervorbringen können. Es wirkt z. B. sehr
peinlich, ohne doch im geringsten strafbar zu
sein, wenn ein Universitätslehrer deutscher
Muttersprache einem Kunsthändler deutscher
Muttersprache in einer deutschen Stadt ein
Gutachten auf englisch abgibt. Er übermittelt
dann nicht mehr nur Erkenntnis an den Ver-
käufer, der sein Objekt kennen will, — er
stellt ein auf angelsächsische Käufer berech-
netes Handelsobjekt her. Er tut durchaus
kein Unrecht, doch er handelt nicht mit dem
Takte eines echten Gelehrten. Der aber ist
nirgends nötiger als da, wo die zwei Rollen
des Kunstwerkes — die als geistiges Wesen
und die als Ware — einander begegnen.
Es würde sehr schwer fallen, die vierte
Kategorie zu fassen, falls sie vorkommt. Der
Nachweis mangelnder Überzeugung, der alles
entscheidet, wird kaum zu führen sein; allen-
falls dann, wenn jene enormen Änderungen
der „pythischen Urteile“, die den Nicht-Ex-
perten zuweilen nicht weniger verblüffen als
die Unerschütterlichkeit gewisser anderer
durch jede exakte Widerlegung, — wenn jene
jähen Erkenntniswechsel in ganz bestimmten
Richtungen, etwa zugunsten bestimmter Ver-
käufer, sich wiederholen sollten. Indessen,
diese Frage wird sicher immer die schwie-
rigste sein.
Ob aber der Typus 3 vorkommf, das müßte
sich denn doch feststellen lassen. Nahegelegi
ist wenigstens die Frage schon allein durch
den Ton einiger Äußerungen innerhalb dieser
Diskussion, — Äußerungen, die gerade wir
Gelehrten sehr ernst zu nehmen haben und
die uns um so mehr zu Dank verpflichten, je
peinlicher sie uns sein müssen. Ein ehrliches
Entgegenkommen des guten Handels, der sich
hier und gerade durch solche Äußerungen so
schön mit der Wissenschaft zusammengefun-
den hat, müßte restlos aufklärend wirken. Der
gute Handel darf uns nicht im Stiche lassen;
zumal soweit er selbst durch Studium und
Promotion zu uns gehört.
Sollten uns alle, aber auch alle in Betracht
Kommenden bezeugen, daß es den Typus 3
auch nicht in einem einzigen Exemplar gebe,
so würde man zunächst erfreut aufhorchen;
ich selbst habe keine Hoffnung. Allzuoft habe
ich in zahllosen Varianten von leitenden
Männern, die es wissen müssen, das Lied ge-
hört: „Von A. weiß ich es nicht, von B. glaube
ich es nicht, von C. muß ich es leider zugeben
(wobei A., B. und C. immer wieder die Rollen
wechselten. Auch die Dreizahl ist, bitte, nur
theoretisch zu verstehen.) Meine eigene Über-
zeugung, daß es „gelehrte“ Existenzen gibt.
wir.
die Gestalt Jacob Burck-
er nicht erstaunt sein
man heute von Men-
Tizian, Portrait Conte Dolfin
Leinwand -— Toile — Canvas, 114 : 85 cm
R. W. ~ ' - •
von
Pu-
wurden
besucht
sagen
ist, um
hat kürzlich
des nun-
wirkhch be-
Kampfes
„Es
Zeit,
ge-
Der
zwi-
rnen hat beweist außergewöhnliche Loyalität.
Was Menschen höherer Bildungsstufe sich
denken werden, brauche ich nicht auszu-
sprechen. Nur einiges Sachliche.
„Cui bono?“ Z. B. der Sauberkeit der
Wissenschaft, der Sauberkeit des Handels,
Recht dazu. So weit
sind wir. Wir wollen
das nicht mehr dulden.
Ein Meister unserer
Disziplin — der, ohne
übrigens unbegabt zu
sein, Expertisen nicht
abgibt —
angesichts
mehr erst
ginnenden
privatim gesagt:
ist die höchste
daß der Schnitt
macht wird“.
Schnitt natürlich
sehen den anständigen
und den unanständigen
Kunsthistorikern. Ge-
wiß, er läßt sich an
mehreren Stellen
machen. Ich will nur
auf eine zeigen. Ich
will bewußt verein-
fachen, ich will ein
paar Selbstverständ-
lichkeiten sagen dürfen.
Anständiger Handel
wird von niemandem
angegriffen. Ebenso
selbstverständlich ist
es, daß geistige Arbeit
bezahlt werden darf,
auch die des Gut-
achtens, des kunst-
historischen wie des
chemischen, technischen
oder juristischen. Ich
will nur von der einen
Seife der Honorie-
rung reden. Niemand
wird widersprechen,
wenn ich vier mögliche
Kategorien aufstelle
und bewerte, zwischen
denen es natürlich Nüancen gibt: 1. Der Mann,
der Gutachten ohne jede Vergütung abgibt; er
handelt vornehm und klug. — 2. Der Mann, der
sich die ehrliche geistige Leistung eines Gut-
achtens anständig bezahlen läßt. Anständig, das
heißt natürlich: unabhängig von dem Marktwert,
der Sauberkeit in beider Beziehungen. Mich
interessiert die Sauberkeit der Wissenschaft;
natürlich nicht mich allein, sondern zahlreiche
Menschen. Der Idee nach müßten schon Alle
dabei sein, die den Doktor-Titel erworben
haben. Die Diskussion hat in erfreulicher
Weise bewiesen, daß der Sinn des alten Dok-
tor-Eides auch gerade in promovierten Her-
ren des Handels lebendig ist. Es gibt Stellen
in der Diskussion, wo man ihre Scham für den
„reinen“ Gelehrten empfindet, — ihr Be-
dauern, die Achsel zucken zu müssen, wo sie
lieber verehren möchten. Wenn das möglich
ist, wenn von einer Disziplin überhaupt so ge-
sprochen werden kann wie heute von der
Kunstgeschichte (man stelle sich ihre Heroen-
zeifen vor, etwa die Zeit Jacob Burckhardts),
so fordert die Ehre, zu prüfen und zu handeln
und vollkommen deutlich zu werden. Ehren-
haftigkeit ist der Kollegialität bei weitem
übergeordnet. Kollegialität darf kein Mantel
für Schmuß werden.
Herr Dr. Heinemann-Fleischmann spricht von
„Wissenschaftlern, die mangels imponie-
render Leistungen nicht gefragt wurden und
dadurch sich finanziell geschädigt
oder moralisch verbittert fühlen“. Ich gehe
nur auf das durch Sperrdruck Hervorgehobene
ein. Es ist unverkennbar mit der gering-
schäßigen Herablassung
gesagt, der seine Leute
kennt. Wir wünschen
nicht, daß zu unserer
Wissenschaft „Arbeit-
nehmer“ gehören, die
diese Haltung recht-
fertigen.
Ich füge einige Bil-
der hinzu, die ich nun-
mehr aber sehr wert-
vollen und von mir mit
unmittelbarem
begrüßten
entnehme:
jenes „namhaften Mu-
seumsbeamten“, der
bei einer Expertisen-
serie offenbar bedenk-
licher Qualität nach
einer neuen Feder ruft;
das Bild des Kunst-
historikers, der sich
nicht genug tun kann,
den Händler im Händ-
lerischen zu übertrump-
fen, ja, der ihm Käufer
nachzuweisen sucht;
das mehr literarische
Bild von der „Ratio--
nalisierung des Exper-
tisenbetriebes“, der
„Expertisenmisere“, des
„Expertisenunwesens“;
das Bild des akade-
misch gesinnten Händ-
lers, der vom Sachver-
ständigen Wissenschaft
erbittet und Warenvor-
schläge erhält; die
Scham des ehrlichen
Händlers für den Ge-
lehrten. Und ich über-
lasse es Jedem, jene
Bilder aus eigenen Ein-
drücken hinzuzufügen,
die ihm leider so leicht
einfallen werden.
So weit sind
noch einmal auf
hardts. Würde
zu hören, wie
sehen spricht, die wenigstens äußerlich zu
seinem Fache gerechnet werden? Ganz offen-
bar besteht aber ein
lung, die die Massenströme der Sonntage nicht
ganz genau erfassen konnte, die Neubauten
durch das Kaiser-Friedrich-Museum und das
Alte bzw. Neue Museum betreten. Eine Zahl,
der sonst ein monatlicher Durchschnittsbesuch
der beiden Häuser von 20—25 C00 Menschen
gegenübersteht. Gewiß, das Motiv für den
Besuch ist bei der Mehrzahl reine Neugierde.
Aber das macht gar nichts.^ Wenn man den
Neugierigen brauchbare F '1
drückt, wenn sie die
Anschläge über die
jeßt reich ausgebauten
öffentlichen Führungen
lesen, so werden sie
schon wiederkommen.
Und in der Tat auch
hier liegen bereits
interessante Zahlen
vor. Der Gesamtführer
durch die Berliner
(Kunst-) Museen (unter
Ausschluß derNational-
galerie), der zu dem
ungewöhnlich niederen
Preis von 2 M. ver-
kauft wird und der
schon in seinem Äuße-
ren ein modernes Ge-
sicht zeigt, wurde in
zwei Monaten in 2500
Exemplaren verkauft.
Eine ganz gewaltige
Verkaufssumme haben
die kleinen Publika-
tionen des Pergamon-
Museums aufzuweisen.
Das Merkblatt zu 10 Pf.
wurde in 35 000 Exem-
plaren verkauft, das
Bilderheftchen zu 50 Pf.
in 10 000 Exemplaren.
Beide sind schon in 2.
bzw. 3. Auflage er-
schienen.
Ergänzend treten zu
den Publikationen die
Führungen. Nicht
weniger als 1200 Lehrer
der höheren Lehr-
anstalten sind durch
das Provinzial-Schul-
kollegium zu Führun-
gen angemeldet, und
dazu kommen die zahl-
losen Schulen, Vereine
und Verbände, die alle
Museumswelt geführt sein wollen. Eine
außerordentliche Arbeitsanforderung für die
wissenschaftlichen Beamten. Die durch An-
schlag bekanntgegebenen öffentlichen Füh-
rungen sind an den Sonntagen im Pergamon-
Museum von etwa 300 Personen besucht wor-
den, die dafür einen Betrag von je 50 Pf. zu
Krankheit
freundlichen Aufforderung der
schon früher nachzukommen. Jeßt ist es mir
lieb, daß die Diskussion schon einigermaßen
übersehbar ist. Jeßt hat die gewiß einseitige
Beurteilung vom akademischen Lehrer her
vielleicht noch einen wesentlicheren Klang.
Unter den guten Worten, die die Diskussion
bis jeßt ergeben hat, ist wohl das kühnste der
erste Absaß von Hans Tießes sehr bedeuten-
dem Beitrage — etwa ein Saß wie dieser:
„Die Diskussion bewegt sich zwischen solchen,
die nicht sprechen wollen, und solchen, die
nicht sprechen können“. Das ist wahr. Die
meisten wissen mehr, als sie glauben sagen
zu dürfen. Soll etwas Wirkliches erreicht
werden, so darf man sich nicht scheuen, den
Anruch der Brutalität auf sich zu nehmen. Ich
werde das tun.
Die Diskussion hat im allgemeinen den
Ernst des Problems nicht in Frage gestellt,
geschweige denn seine Existenz. Ich sehe nur
einen einzigen Versuch, den Sinn der Unter-
handlungen, selbst ihre sittliche Grundlage,
vollständig zu ]eugnen; automatisch wurde
dabei auch das geistige Niveau gesenkt. Herr
Dr. Heinemann-Fleischmann erklärt die ganze,
von so viel ernsthaften und gut gesinnten
Menschen erörterte Frage für ausschließliche
Angelegenheit einer bestimmten Käufer- und
Verkäuferschicht; statt dieser eigenHich
alleinberechtigten Gruppe, hätten wesentlich
* Zu dem Vorschlag von Dr Turm Rottmann
(Nr. 33) nahmen bisher in der „Weltkuntt“ da, Wort“
Geh.-Rat Max J. Friedländer, Prof Dr F Spott-
müller, Dr. A. Gold, G. Brandmayer' Prof Dr
Winkler, Hofrat Prof. Dr. G. Glück, ’sir Charles
J. Holmes, Prof. Dr. Koetschau, Dr. Jos Stranskv
Hofrat Prof. Dr. H. Tietze, Dr. Heinemann-Fkisch’
mann, Prof. Dr. J. Baum, Prof. Dr. 0. Fischer Dr
J. B. de la Faille, Prof. Dr. H. Schmitz, Dir. Dr; Ei
Wiese, Dr. H. Leporini, Dr. W. Katz und R-A
B. Svenonius.
Ferdinand Boi, Bildnis einer Spanierin
Portrait d’une Espagnole — Portrait of a Spaniard
Holz — Bois — Panel, 71 : 57 cm
W. " ..
Wie haben in Nr. 33 unserer Zeitung die
Diskussion der Expertisen-Frage eröffnet*).
Im Verlauf dieser Erörterung sind die wesent-
lichsten Seiten des Problems von den ver-
schiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet
worden. Von den zahlreichen Zuschriften und
Beiträgen haben wir aus Platzmangel nur eine
kleine Auswahl bringen können. Doch erhielten
wir kürzlich einen Aufsatz von Herrn Geheim-
rat Prof. Dr. Wilhelm Pinder, München, der
uns so wichtig erscheint, daß wir ihn unseren
Lesern nicht vorenthalten möchten.
Getreu unser em stets vertretenen Prinzip der
Unparteilichkeit geben wir gleichzeitig Herrn
Dr. H einemann - Fleischmann, München,
Gelegenheit, sich zum Inhalt der Pinderschen
Ausführungen zu äußern.
Redaktion der „Weltkunst“
Geh. Rat Prof. Dr. Pinder:
hatte mich verhindert, der
Redaktion