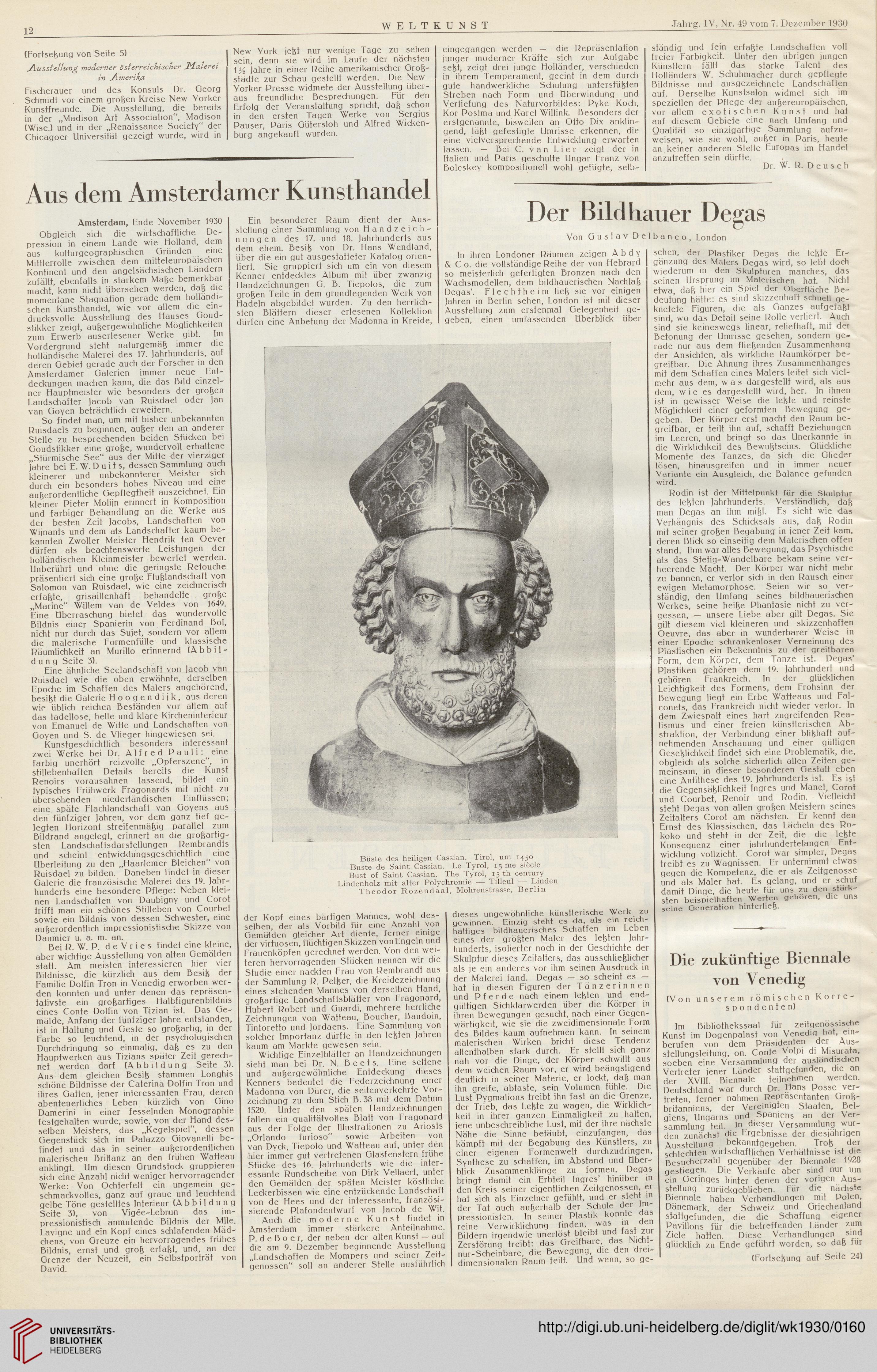12
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930
(Fortseßung von Seite 5)
.Ausstellung moderner österreichischer Malerei
in .Amerika
Fischerauer und des Konsuls Dr. Georg
Schmidt vor einem großen Kreise New Yorker
Kunstfreunde. Die Ausstellung, die bereits
in der „Madison Art Association“, Madison
(Wisc.) und in der „Renaissance Society" der
Chicagoer Universität gezeigt wurde, wird in
New York jeßt nur wenige Tage zu sehen
sein, denn sie wird im Laufe der nächsten
1% Jahre in einer Reihe amerikanischer Groß-
städte zur Schau gestellt werden. Die New
Yorker Presse widmete der Ausstellung über-
aus freundliche Besprechungen. Für den
Erfolg der Veranstaltung spricht, daß schon
in den ersten Tagen Werke von Sergius
Pauser, Paris Gütersloh und Alfred Wicken-
burg angekauft wurden.
eingegangen werden — die Repräsentation
junger moderner Kräfte sich zur Aufgabe
seßt, zeigt drei junge Holländer, verschieden
in ihrem Temperament, geeint in dem durch
gute handwerkliche Schulung untersiüßten
Streben nach Form und Überwindung und
Vertiefung des Naturvorbildes: Pyke Koch,
Kor Postma und Karel Willink. Besonders der
erstgenannte, bisweilen an Otto Dix anklin-
gend, läßt gefestigte Umrisse erkennen, die
eine vielversprechende Entwicklung erwarten
lassen. — Bei C. van Lier zeigt der in
Italien und Paris geschulte Ungar Franz von
Bolcskey kompositionell wohl gefügte, selb-
ständig und fein erfaßte Landschaften voll
freier Farbigkeit. Unter den übrigen jungen
Künstlern fällt das starke Talent des
Holländers W. Schuhmacher durch gepflegte
Bildnisse und ausgezeichnete Landschaften
auf. Derselbe Kunstsalon widmet sich im
speziellen der Pflege der außereuropäischen,
vor allem exotischen Kunst und hat
auf diesem Gebiete eine nach Umfang und
Qualität so einzigartige Sammlung aufzu-
weisen, wie sie wohl, außer in Paris, heute
an keiner anderen Stelle Europas im Handel
anzutreffen sein dürfte.
Dr. W. R. D e u s c h
Aus dem Amsterdamer Kunsthandel
Der Bildhauer Degas
Von Gustav Delbanco, London
Amsterdam, Ende November 1930
Obgleich sich die wirtschaftliche De-
pression in einem Lande wie Holland, dem
aus kulturgeographischen Gründen eine
Mittlerrolle zwischen dem mitteleuropäischen
Kontinent und den angelsächsischen Ländern
zufällt, ebenfalls in starkem Maße bemerkbar
macht, kann nicht übersehen werden, daß die
momentane Stagnation gerade dem holländi-
schen Kunsthandel, wie vor allem die ein-
drucksvolle Ausstellung des Hauses Goud-
stikker zeigt, außergewöhnliche Möglichkeiten
zum Erwerb auserlesener Werke gibt. Im
Vordergrund sieht naturgemäß immer die
holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, auf
deren Gebiet gerade auch der Forscher in den
Amsterdamer Galerien immer neue Ent-
deckungen machen kann, die das Bild einzel-
ner Hauptmeister wie besonders der großen
Landschafter Jacob van Ruisdael oder Jan
van Goyen beträchtlich erweitern.
So findet man, um mit bisher unbekannten
Ruisdaels zu beginnen, außer den an anderer
Stelle zu besprechenden beiden Stücken bei
Goudstikker eine große, wundervoll erhaltene
„Stürmische See“ aus der Mitte der vierziger
Jahre bei E. W. D u i t s, dessen Sammlung auch
kleinerer und unbekannterer Meister sich
durch ein besonders hohes Niveau und eine
außerordentliche Gepflegtheit auszeichnet. Ein
kleiner Pieter Molijn erinnert in Komposition
und farbiger Behandlung an die Werke aus
der besten Zeit Jacobs, Landschaften von
Wijnants und dem als Landschafter kaum be-
kannten Zwoller Meister Hendrik ten Oever
dürfen als beachtenswerte Leistungen der
holländischen Kleinmeister bewertet werden.
Unberührt und ohne die geringste Retouche
präsentiert sich eine große Flußlandschaft von
Salomon van Ruisdael, wie eine zeichnerisch
erfaßte, grisaillenhaft behandelte große
„Marine" Willem van de Veldes von 1649.
Eine Überraschung bietet das wundervolle
Bildnis einer Spanierin von Ferdinand Boi,
nicht nur durch das Sujet, sondern vor allem
die malerische Formenfülle und klassische
Räumlichkeit an Murillo erinnernd (Abbil-
dung Seite 3).
Eine ähnliche Seelandschafl von Jacob van
Ruisdael wie die oben erwähnte, derselben
Epoche im Schaffen des Malers angehörend,
besißt die Galerie Hoogendijk, aus deren
wie üblich reichen Beständen vor allem auf
das tadellose, helle und klare Kircheninterieur
von Emanuel de Witte und Landschaften von
Goyen und S. de Vlieger hingewiesen sei.
Kunstgeschichilich besonders interessant
zwei Werke bei Dr. Alfred Pauli: eine
farbig unerhört reizvolle „Opferszene", in
stillebenhaften Details bereits die Kunst
Renoirs vorausahnen lassend, bildet ein
typisches Frühwerk Fragonards mit nicht zu
übersehenden niederländischen Einflüssen;
eine späte Flachlandschaff van Goyens aus
den fünfziger Jahren, vor dem ganz tief ge-
legten Horizont streifenmäßig parallel zum
Bildrand angelegt, erinnert an die großartig-
sten Landschafisdarstellungen Rembrandts
und scheint entwicklungsgeschichtlich eine
Oberleitung zu den „Haarlemer Bleichen" von
Ruisdael zu bilden. Daneben findet in dieser
Galerie die französische Malerei des 19. Jahr-
hunderts eine besondere Pflege: Neben klei-
nen Landschaften von Daubigny und Corot
trifft man ein schönes Stilleben von Courbei
sowie ein Bildnis von dessen Schwester, eine
außerordentlich impressionistische Skizze von
Daumier u. a. m. an.
Bei R. W. P. d e V r i e s findet eine kleine,
aber wichtige Ausstellung von alten Gemälden
statt. Am meisten interessieren hier vier
Bildnisse, die kürzlich aus dem Besiß der
Familie Dolfin Tron in Venedig erworben wer-
den konnten und unter denen das repräsen-
tativste ein großartiges Halbfigurenbildnis
eines Conte Dolfin von Tizian ist. Das Ge-
mälde, Anfang der fünfziger Jahre entstanden,
ist in Haltung und Geste so großartig, in der
Farbe so leuchtend, in der psychologischen
Durchdringung so einmalig, daß es zu den
Hauptwerken aus Tizians später Zeit gerech-
net werden darf (Abbildung Seite 3).
Aus dem gleichen Besiß stammen Longhis
schöne Bildnisse der Caterina Dolfin Tron und
ihres Gatten, jener interessanten Frau, deren
abenteuerliches Leben kürzlich von Gino
Damerini in einer fesselnden Monographie
festgehalten wurde, sowie, von der Hand des-
selben Meisters, das „Kegelspiel“, dessen
Gegenstück sich im Palazzo Giovanelli be-
findet und das in seiner außerordentlichen
malerischen Brillanz an den frühen Watteau
anklingt. Um diesen Grundstock gruppieren
sich eine Anzahl nicht weniger hervorragender
Werke: Von Ochterfelt ein ungemein ge-
schmackvolles, ganz auf graue und leuchtend
gelbe Töne gestelltes Interieur (Abbildung
Seite 3), von Vigee-Lebrun das im-
pressionistisch anmutende Bildnis der Mlle.
Lavigne und ein Kopf eines schlafenden Mäd-
chens, von Greuze ein hervorragendes frühes
Bildnis, ernst und groß erfaßt, und, an der
Grenze der Neuzeit, ein Selbstporträt von
David.
Ein besonderer Raum dient der Aus-
stellung einer Sammlung von Handzeich-
nungen des 17. und 18. Jahrhunderts aus
dem ehern. Besiß von Dr. Hans Wendland,
über die ein gut ausgestatteter Katalog orien-
tiert. Sie gruppiert sich um ein von diesem
Kenner entdecktes Album mit über zwanzig
Handzeichnungen G. B. Tiepotos, die zum
großen Teile in dem grundlegenden Werk von
Hadeln abgebildet wurden. Zu den herrlich-
sten Blättern dieser erlesenen Kollektion
dürfen eine Anbetung der Madonna in Kreide,
der Kopf eines bärtigen Mannes, wohl des-
selben, der als Vorbild für eine Anzahl von
Gemälden gleicher Art diente, ferner einige
der virtuosen, flüchtigen Skizzen vonEngeln und
Frauenköpfen gerechnet werden. Von den wei-
teren hervorragenden Stücken nennen wir die
Studie einer nackten Frau von Rembrandt aus
der Sammlung R. Pelßer, die Kreidezeichnung
eines stehenden Mannes von derselben Hand,
großartige Landschaftsblätter von Fragonard,
Hubert Robert und Guardi, mehrere herrliche
Zeichnungen von Watteau, Boucher, Baudoin,
Tinioretto und Jordaens. Eine Sammlung von
solcher Importanz dürfte in den leßten Jahren
kaum am Markte gewesen sein.
Wichtige Einzelblätter an Handzeichnungen
sieht man bei Dr. N. Beets. Eine seltene
und außergewöhnliche Entdeckung dieses
Kenners bedeutet die Federzeichnung einer
Madonna von Dürer, die seitenverkehrte Vor-
zeichnung zu dem Stich B. 38 mit dem Datum
1520. Unter den späten Handzeichnungen
fallen ein qualitätvolles Blatt von Fragonard
aus der Folge der Illustrationen zu Ariosis
„Orlando furioso“ sowie Arbeiten von
van Dyck, Tiepolo und Watteau auf, unter den
hier immer gut vertretenen Glasfenstern frühe
Stücke des 16. Jahrhunderts wie die inter-
essante Rundscheibe von Dirk Vellaert, unter
den Gemälden der späten Meister köstliche
Leckerbissen wie eine entzückende Landschaft
von de Hees und der interessante, französi-
sierende Plafondentwurf von Jacob de Wit.
Auch die moderne Kunst findet in
Amsterdam immer stärkere Anteilnahme.
P. d e B o e r, der neben der alten Kunst — auf
die am 9. Dezember beginnende Ausstellung
„Landschaften de Mompers und seiner Zeit-
genossen“ soll an anderer Stelle ausführlich
In ihren Londoner Räumen zeigen A b d y
& C o. die vollständige Reihe der von Hebrard
so meisterlich gefertigten Bronzen nach den
Wachsmodellen, dem bildhauerischen Nachlaß
Degas’. Flechtheim ließ sie vor einigen
Jahren in Berlin sehen, London ist mit dieser
Ausstellung zum erstenmal Gelegenheit ge-
geben, einen umfassenden Überblick über
dieses ungewöhnliche künstlerische Werk zu
gewinnen. Einzig steht es da, als ein reich-
haltiges bildhauerisches Schaffen im Leben
eines der größten Maler des leßten Jahr-
hunderts, isolierter noch in der Geschichte der
Skulptur dieses Zeitalters, das ausschließlicher
als je ein anderes vor ihm seinen Ausdruck in
der Malerei fand. Degas — so scheint es —
hat in diesen Figuren der Tänzerinnen
und Pferde nach einem leßten und end-
gültigen Sichklarwerden über die Körper in
ihren Bewegungen gesucht, nach einer Gegen-
wärtigkeit, wie sie die zweidimensionale Form
des Bildes kaum aufnehmen kann. In seinem
malerischen Wirken bricht diese Tendenz
allenthalben stark durch. Er stellt sich ganz
nah vor die Dinge, der Körper schwillt aus
dem weichen Raum vor, er wird beängstigend
deutlich in seiner Materie, er lockt, daß man
ihn greife, abtaste, sein Volumen fühle. Die
Lust Pygmalions treibt ihn fast an die Grenze,
der Trieb, das Leßte zu wagen, die Wirklich-
keit in ihrer ganzen Einmaligkeit zu halten,
jene unbeschreibliche Lust, mit der ihre nächste
Nähe die Sinne betäubt, einzufangen, das
kämpft mit der Begabung des Künstlers, zu
einer eigenen Formenwelt durchzudringen,
Synthese zu schaffen, im Abstand und Über-
blick Zusammenklänge zu formen. Degas
bringt damit ein Erbteil Ingres’ hinüber in
den Kreis seiner eigentlichen Zeitgenossen, er
hat sich als Einzelner gefühlt, und er steht in
der Tat auch außerhalb der Schule der Im-
pressionisten. In seiner Plastik konnte das
reine Verwirklichung finden, was in den
Bildern irgendwie unerlöst bleibt und fast zur
Zerstörung treibt: das Greifbare, das Nicht-
nur-Scheinbare, die Bewegung, die den drei-
dimensionalen Raum teilt. Und wenn, so ge-
sehen, der Plastiker Degas die leßte Er-
gänzung des Malers Degas wird, so lebt doch
wiederum in den Skulpturen manches, das
seinen Ursprung im Malerischen hat. Nicht
etwa, daß hier ein Spiel der Oberfläche Be-
deutung hätte: es sind skizzenhaft schnell ge-
knetete Figuren, die als Ganzes aufgefaßt
sind, wo das Detail seine Rolle verliert. Auch
sind sie keineswegs linear, reliefhaft, mit der
Betonung der Umrisse gesehen, sondern ge-
rade nur aus dem fließenden Zusammenhang
der Ansichten, als wirkliche Raumkörper be-
greifbar. Die Ahnung ihres Zusammenhanges
mit dem Schaffen eines Malers leitet sich viel-
mehr aus dem, was dargestellt wird, als aus
dem, w i e es dargestellt wird, her. In ihnen
ist in gewisser Weise die leßte und reinste
Möglichkeit einer geformten Bewegung ge-
geben. Der Körper erst macht den Raum be-
greifbar, er teilt ihn auf, schafft Beziehungen
im Leeren, und bringt so das Unerkannte in
die Wirklichkeit des Bewußtseins. Glückliche
Momente des Tanzes, da sich die Glieder
lösen, hinausgreifen und in immer neuer
Variante ein Ausgleich, die Balance gefunden
wird.
Rodin ist der Mittelpunkt für die Skulptur
des leßten Jahrhunderts. Verständlich, daß
man Degas an ihm mißt. Es sieht wie das
Verhängnis des Schicksals aus, daß Rodin
mit seiner großen Begabung in jener Zeit kam,
deren Blick so einseitig dem Malerischen offen
stand. Ihm war alles Bewegung, das Psychische
als das Stetig-Wandelbare bekam seine ver-
heerende Macht. Der Körper war nicht mehr
zu bannen, er verlor sich in den Rausch einer
ewigen Metamorphose. Seien wir so ver-
ständig, den Umfang seines bildhauerischen
Werkes, seine heiße Phantasie nicht zu ver-
gessen, — unsere Liebe aber gilt Degas. Sie
gilt diesem viel kleineren und skizzenhaften
Oeuvre, das aber in wunderbarer Weise in
einer Epoche schrankenloser Verneinung des
Plastischen ein Bekenntnis zu der greifbaren
Form, dem Körper, dem Tanze ist. Degas’
Plastiken gehören dem 19. Jahrhundert und
gehören Frankreich. In der glücklichen
Leichtigkeit des Formens, dem Frohsinn der
Bewegung liegt ein Erbe Watteaus und Fal-
conets, das Frankreich nicht wieder verlor. In
dem Zwiespalt eines hart zugreifenden Rea-
lismus und einer freien künstlerischen Ab-
straktion, der Verbindung einer blißhaft auf-
nehmenden Anschauung und einer gültigen
Geseßlichkeif findet sich eine Problematik, die,
obgleich als solche sicherlich allen Zeiten ge-
meinsam, in dieser besonderen Gestalt eben
eine Antithese des 19. Jahrhunderts ist. Es ist
die Gegensäßlichkeit Ingres und Manet, Corot
und Courbet, Renoir und Rodin. Vielleicht
steht Degas von allen großen Meistern seines
Zeitalters Corot am nächsten. Er kennt den
Ernst des Klassischen, das Lächeln des Ro-
koko und steht in der Zeit, die die leßte
Konsequenz einer jahrhundertelangen Ent-
wicklung vollzieht. Corot war simpler, Degas
treibt es zu Wagnissen. Er unternimmt etwas
gegen die Kompetenz, die er als Zeitgenosse
und als Maler hat. Es gelang, und er schuf
damit Dinge, die heute für uns zu den stärk-
sten beispielhaften Werten gehören, die uns
seine Generation hinterließ.
Die zukünftige Biennale
von Venedig
(Von unserem römischen Korre-
spondenten)
Im Bibliothekssaal für zeitgenössische
Kunst im Dogenpalast von Venedig hat, ein-
berufen von dem Präsidenten der Aus-
sfellungsleitung, on. Conte Volpi di Misurata,
soeben eine Versammlung der ausländischen
Vertreter jener Länder stattgefunden, die an
der XVIII. Biennale teilnehmen werden.
Deutschland war durch Dr. Hans Posse ver-
treten, ferner nahmen Repräsentanten Groß-
britanniens, der Vereinigten Staaten, Bel-
giens, Ungarns und Spaniens an der Ver-
sammlung teil. In dieser Versammlung wur-
den zunächst die Ergebnisse der diesjährigen
Ausstellung bekanntgegeben. Troß der
schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ist die
Besucherzahl gegenüber der Biennale 1928
gestiegen. Die Verkäufe aber sind nur um
ein Geringes hinter denen der vorigen Aus-
stellung zurückgeblieben. Für die nächste
Biennale haben Verhandlungen mit Polen,
Dänemark, der Schweiz und Griechenland
stattgefunden, die die Schaffung eigener
Pavillons für die betreffenden Länder zum
Ziele hatten. Diese Verhandlungen sind
glücklich zu Ende geführt worden, so daß für
(Forfseßung auf Seite 24)
Büste des heiligen Cassian. Tirol, um 1450
Büste de Saint Cassian. Le Tyrol, 15 me siecle
Bust of Saint Cassian. The Tyrol, 15 th Century
Lindenholz mit alter Polychromie — Tilleul — Linden
Theodor Rozendaal, Mohrenstrasse, Berlin
WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 49 vom 7. Dezember 1930
(Fortseßung von Seite 5)
.Ausstellung moderner österreichischer Malerei
in .Amerika
Fischerauer und des Konsuls Dr. Georg
Schmidt vor einem großen Kreise New Yorker
Kunstfreunde. Die Ausstellung, die bereits
in der „Madison Art Association“, Madison
(Wisc.) und in der „Renaissance Society" der
Chicagoer Universität gezeigt wurde, wird in
New York jeßt nur wenige Tage zu sehen
sein, denn sie wird im Laufe der nächsten
1% Jahre in einer Reihe amerikanischer Groß-
städte zur Schau gestellt werden. Die New
Yorker Presse widmete der Ausstellung über-
aus freundliche Besprechungen. Für den
Erfolg der Veranstaltung spricht, daß schon
in den ersten Tagen Werke von Sergius
Pauser, Paris Gütersloh und Alfred Wicken-
burg angekauft wurden.
eingegangen werden — die Repräsentation
junger moderner Kräfte sich zur Aufgabe
seßt, zeigt drei junge Holländer, verschieden
in ihrem Temperament, geeint in dem durch
gute handwerkliche Schulung untersiüßten
Streben nach Form und Überwindung und
Vertiefung des Naturvorbildes: Pyke Koch,
Kor Postma und Karel Willink. Besonders der
erstgenannte, bisweilen an Otto Dix anklin-
gend, läßt gefestigte Umrisse erkennen, die
eine vielversprechende Entwicklung erwarten
lassen. — Bei C. van Lier zeigt der in
Italien und Paris geschulte Ungar Franz von
Bolcskey kompositionell wohl gefügte, selb-
ständig und fein erfaßte Landschaften voll
freier Farbigkeit. Unter den übrigen jungen
Künstlern fällt das starke Talent des
Holländers W. Schuhmacher durch gepflegte
Bildnisse und ausgezeichnete Landschaften
auf. Derselbe Kunstsalon widmet sich im
speziellen der Pflege der außereuropäischen,
vor allem exotischen Kunst und hat
auf diesem Gebiete eine nach Umfang und
Qualität so einzigartige Sammlung aufzu-
weisen, wie sie wohl, außer in Paris, heute
an keiner anderen Stelle Europas im Handel
anzutreffen sein dürfte.
Dr. W. R. D e u s c h
Aus dem Amsterdamer Kunsthandel
Der Bildhauer Degas
Von Gustav Delbanco, London
Amsterdam, Ende November 1930
Obgleich sich die wirtschaftliche De-
pression in einem Lande wie Holland, dem
aus kulturgeographischen Gründen eine
Mittlerrolle zwischen dem mitteleuropäischen
Kontinent und den angelsächsischen Ländern
zufällt, ebenfalls in starkem Maße bemerkbar
macht, kann nicht übersehen werden, daß die
momentane Stagnation gerade dem holländi-
schen Kunsthandel, wie vor allem die ein-
drucksvolle Ausstellung des Hauses Goud-
stikker zeigt, außergewöhnliche Möglichkeiten
zum Erwerb auserlesener Werke gibt. Im
Vordergrund sieht naturgemäß immer die
holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, auf
deren Gebiet gerade auch der Forscher in den
Amsterdamer Galerien immer neue Ent-
deckungen machen kann, die das Bild einzel-
ner Hauptmeister wie besonders der großen
Landschafter Jacob van Ruisdael oder Jan
van Goyen beträchtlich erweitern.
So findet man, um mit bisher unbekannten
Ruisdaels zu beginnen, außer den an anderer
Stelle zu besprechenden beiden Stücken bei
Goudstikker eine große, wundervoll erhaltene
„Stürmische See“ aus der Mitte der vierziger
Jahre bei E. W. D u i t s, dessen Sammlung auch
kleinerer und unbekannterer Meister sich
durch ein besonders hohes Niveau und eine
außerordentliche Gepflegtheit auszeichnet. Ein
kleiner Pieter Molijn erinnert in Komposition
und farbiger Behandlung an die Werke aus
der besten Zeit Jacobs, Landschaften von
Wijnants und dem als Landschafter kaum be-
kannten Zwoller Meister Hendrik ten Oever
dürfen als beachtenswerte Leistungen der
holländischen Kleinmeister bewertet werden.
Unberührt und ohne die geringste Retouche
präsentiert sich eine große Flußlandschaft von
Salomon van Ruisdael, wie eine zeichnerisch
erfaßte, grisaillenhaft behandelte große
„Marine" Willem van de Veldes von 1649.
Eine Überraschung bietet das wundervolle
Bildnis einer Spanierin von Ferdinand Boi,
nicht nur durch das Sujet, sondern vor allem
die malerische Formenfülle und klassische
Räumlichkeit an Murillo erinnernd (Abbil-
dung Seite 3).
Eine ähnliche Seelandschafl von Jacob van
Ruisdael wie die oben erwähnte, derselben
Epoche im Schaffen des Malers angehörend,
besißt die Galerie Hoogendijk, aus deren
wie üblich reichen Beständen vor allem auf
das tadellose, helle und klare Kircheninterieur
von Emanuel de Witte und Landschaften von
Goyen und S. de Vlieger hingewiesen sei.
Kunstgeschichilich besonders interessant
zwei Werke bei Dr. Alfred Pauli: eine
farbig unerhört reizvolle „Opferszene", in
stillebenhaften Details bereits die Kunst
Renoirs vorausahnen lassend, bildet ein
typisches Frühwerk Fragonards mit nicht zu
übersehenden niederländischen Einflüssen;
eine späte Flachlandschaff van Goyens aus
den fünfziger Jahren, vor dem ganz tief ge-
legten Horizont streifenmäßig parallel zum
Bildrand angelegt, erinnert an die großartig-
sten Landschafisdarstellungen Rembrandts
und scheint entwicklungsgeschichtlich eine
Oberleitung zu den „Haarlemer Bleichen" von
Ruisdael zu bilden. Daneben findet in dieser
Galerie die französische Malerei des 19. Jahr-
hunderts eine besondere Pflege: Neben klei-
nen Landschaften von Daubigny und Corot
trifft man ein schönes Stilleben von Courbei
sowie ein Bildnis von dessen Schwester, eine
außerordentlich impressionistische Skizze von
Daumier u. a. m. an.
Bei R. W. P. d e V r i e s findet eine kleine,
aber wichtige Ausstellung von alten Gemälden
statt. Am meisten interessieren hier vier
Bildnisse, die kürzlich aus dem Besiß der
Familie Dolfin Tron in Venedig erworben wer-
den konnten und unter denen das repräsen-
tativste ein großartiges Halbfigurenbildnis
eines Conte Dolfin von Tizian ist. Das Ge-
mälde, Anfang der fünfziger Jahre entstanden,
ist in Haltung und Geste so großartig, in der
Farbe so leuchtend, in der psychologischen
Durchdringung so einmalig, daß es zu den
Hauptwerken aus Tizians später Zeit gerech-
net werden darf (Abbildung Seite 3).
Aus dem gleichen Besiß stammen Longhis
schöne Bildnisse der Caterina Dolfin Tron und
ihres Gatten, jener interessanten Frau, deren
abenteuerliches Leben kürzlich von Gino
Damerini in einer fesselnden Monographie
festgehalten wurde, sowie, von der Hand des-
selben Meisters, das „Kegelspiel“, dessen
Gegenstück sich im Palazzo Giovanelli be-
findet und das in seiner außerordentlichen
malerischen Brillanz an den frühen Watteau
anklingt. Um diesen Grundstock gruppieren
sich eine Anzahl nicht weniger hervorragender
Werke: Von Ochterfelt ein ungemein ge-
schmackvolles, ganz auf graue und leuchtend
gelbe Töne gestelltes Interieur (Abbildung
Seite 3), von Vigee-Lebrun das im-
pressionistisch anmutende Bildnis der Mlle.
Lavigne und ein Kopf eines schlafenden Mäd-
chens, von Greuze ein hervorragendes frühes
Bildnis, ernst und groß erfaßt, und, an der
Grenze der Neuzeit, ein Selbstporträt von
David.
Ein besonderer Raum dient der Aus-
stellung einer Sammlung von Handzeich-
nungen des 17. und 18. Jahrhunderts aus
dem ehern. Besiß von Dr. Hans Wendland,
über die ein gut ausgestatteter Katalog orien-
tiert. Sie gruppiert sich um ein von diesem
Kenner entdecktes Album mit über zwanzig
Handzeichnungen G. B. Tiepotos, die zum
großen Teile in dem grundlegenden Werk von
Hadeln abgebildet wurden. Zu den herrlich-
sten Blättern dieser erlesenen Kollektion
dürfen eine Anbetung der Madonna in Kreide,
der Kopf eines bärtigen Mannes, wohl des-
selben, der als Vorbild für eine Anzahl von
Gemälden gleicher Art diente, ferner einige
der virtuosen, flüchtigen Skizzen vonEngeln und
Frauenköpfen gerechnet werden. Von den wei-
teren hervorragenden Stücken nennen wir die
Studie einer nackten Frau von Rembrandt aus
der Sammlung R. Pelßer, die Kreidezeichnung
eines stehenden Mannes von derselben Hand,
großartige Landschaftsblätter von Fragonard,
Hubert Robert und Guardi, mehrere herrliche
Zeichnungen von Watteau, Boucher, Baudoin,
Tinioretto und Jordaens. Eine Sammlung von
solcher Importanz dürfte in den leßten Jahren
kaum am Markte gewesen sein.
Wichtige Einzelblätter an Handzeichnungen
sieht man bei Dr. N. Beets. Eine seltene
und außergewöhnliche Entdeckung dieses
Kenners bedeutet die Federzeichnung einer
Madonna von Dürer, die seitenverkehrte Vor-
zeichnung zu dem Stich B. 38 mit dem Datum
1520. Unter den späten Handzeichnungen
fallen ein qualitätvolles Blatt von Fragonard
aus der Folge der Illustrationen zu Ariosis
„Orlando furioso“ sowie Arbeiten von
van Dyck, Tiepolo und Watteau auf, unter den
hier immer gut vertretenen Glasfenstern frühe
Stücke des 16. Jahrhunderts wie die inter-
essante Rundscheibe von Dirk Vellaert, unter
den Gemälden der späten Meister köstliche
Leckerbissen wie eine entzückende Landschaft
von de Hees und der interessante, französi-
sierende Plafondentwurf von Jacob de Wit.
Auch die moderne Kunst findet in
Amsterdam immer stärkere Anteilnahme.
P. d e B o e r, der neben der alten Kunst — auf
die am 9. Dezember beginnende Ausstellung
„Landschaften de Mompers und seiner Zeit-
genossen“ soll an anderer Stelle ausführlich
In ihren Londoner Räumen zeigen A b d y
& C o. die vollständige Reihe der von Hebrard
so meisterlich gefertigten Bronzen nach den
Wachsmodellen, dem bildhauerischen Nachlaß
Degas’. Flechtheim ließ sie vor einigen
Jahren in Berlin sehen, London ist mit dieser
Ausstellung zum erstenmal Gelegenheit ge-
geben, einen umfassenden Überblick über
dieses ungewöhnliche künstlerische Werk zu
gewinnen. Einzig steht es da, als ein reich-
haltiges bildhauerisches Schaffen im Leben
eines der größten Maler des leßten Jahr-
hunderts, isolierter noch in der Geschichte der
Skulptur dieses Zeitalters, das ausschließlicher
als je ein anderes vor ihm seinen Ausdruck in
der Malerei fand. Degas — so scheint es —
hat in diesen Figuren der Tänzerinnen
und Pferde nach einem leßten und end-
gültigen Sichklarwerden über die Körper in
ihren Bewegungen gesucht, nach einer Gegen-
wärtigkeit, wie sie die zweidimensionale Form
des Bildes kaum aufnehmen kann. In seinem
malerischen Wirken bricht diese Tendenz
allenthalben stark durch. Er stellt sich ganz
nah vor die Dinge, der Körper schwillt aus
dem weichen Raum vor, er wird beängstigend
deutlich in seiner Materie, er lockt, daß man
ihn greife, abtaste, sein Volumen fühle. Die
Lust Pygmalions treibt ihn fast an die Grenze,
der Trieb, das Leßte zu wagen, die Wirklich-
keit in ihrer ganzen Einmaligkeit zu halten,
jene unbeschreibliche Lust, mit der ihre nächste
Nähe die Sinne betäubt, einzufangen, das
kämpft mit der Begabung des Künstlers, zu
einer eigenen Formenwelt durchzudringen,
Synthese zu schaffen, im Abstand und Über-
blick Zusammenklänge zu formen. Degas
bringt damit ein Erbteil Ingres’ hinüber in
den Kreis seiner eigentlichen Zeitgenossen, er
hat sich als Einzelner gefühlt, und er steht in
der Tat auch außerhalb der Schule der Im-
pressionisten. In seiner Plastik konnte das
reine Verwirklichung finden, was in den
Bildern irgendwie unerlöst bleibt und fast zur
Zerstörung treibt: das Greifbare, das Nicht-
nur-Scheinbare, die Bewegung, die den drei-
dimensionalen Raum teilt. Und wenn, so ge-
sehen, der Plastiker Degas die leßte Er-
gänzung des Malers Degas wird, so lebt doch
wiederum in den Skulpturen manches, das
seinen Ursprung im Malerischen hat. Nicht
etwa, daß hier ein Spiel der Oberfläche Be-
deutung hätte: es sind skizzenhaft schnell ge-
knetete Figuren, die als Ganzes aufgefaßt
sind, wo das Detail seine Rolle verliert. Auch
sind sie keineswegs linear, reliefhaft, mit der
Betonung der Umrisse gesehen, sondern ge-
rade nur aus dem fließenden Zusammenhang
der Ansichten, als wirkliche Raumkörper be-
greifbar. Die Ahnung ihres Zusammenhanges
mit dem Schaffen eines Malers leitet sich viel-
mehr aus dem, was dargestellt wird, als aus
dem, w i e es dargestellt wird, her. In ihnen
ist in gewisser Weise die leßte und reinste
Möglichkeit einer geformten Bewegung ge-
geben. Der Körper erst macht den Raum be-
greifbar, er teilt ihn auf, schafft Beziehungen
im Leeren, und bringt so das Unerkannte in
die Wirklichkeit des Bewußtseins. Glückliche
Momente des Tanzes, da sich die Glieder
lösen, hinausgreifen und in immer neuer
Variante ein Ausgleich, die Balance gefunden
wird.
Rodin ist der Mittelpunkt für die Skulptur
des leßten Jahrhunderts. Verständlich, daß
man Degas an ihm mißt. Es sieht wie das
Verhängnis des Schicksals aus, daß Rodin
mit seiner großen Begabung in jener Zeit kam,
deren Blick so einseitig dem Malerischen offen
stand. Ihm war alles Bewegung, das Psychische
als das Stetig-Wandelbare bekam seine ver-
heerende Macht. Der Körper war nicht mehr
zu bannen, er verlor sich in den Rausch einer
ewigen Metamorphose. Seien wir so ver-
ständig, den Umfang seines bildhauerischen
Werkes, seine heiße Phantasie nicht zu ver-
gessen, — unsere Liebe aber gilt Degas. Sie
gilt diesem viel kleineren und skizzenhaften
Oeuvre, das aber in wunderbarer Weise in
einer Epoche schrankenloser Verneinung des
Plastischen ein Bekenntnis zu der greifbaren
Form, dem Körper, dem Tanze ist. Degas’
Plastiken gehören dem 19. Jahrhundert und
gehören Frankreich. In der glücklichen
Leichtigkeit des Formens, dem Frohsinn der
Bewegung liegt ein Erbe Watteaus und Fal-
conets, das Frankreich nicht wieder verlor. In
dem Zwiespalt eines hart zugreifenden Rea-
lismus und einer freien künstlerischen Ab-
straktion, der Verbindung einer blißhaft auf-
nehmenden Anschauung und einer gültigen
Geseßlichkeif findet sich eine Problematik, die,
obgleich als solche sicherlich allen Zeiten ge-
meinsam, in dieser besonderen Gestalt eben
eine Antithese des 19. Jahrhunderts ist. Es ist
die Gegensäßlichkeit Ingres und Manet, Corot
und Courbet, Renoir und Rodin. Vielleicht
steht Degas von allen großen Meistern seines
Zeitalters Corot am nächsten. Er kennt den
Ernst des Klassischen, das Lächeln des Ro-
koko und steht in der Zeit, die die leßte
Konsequenz einer jahrhundertelangen Ent-
wicklung vollzieht. Corot war simpler, Degas
treibt es zu Wagnissen. Er unternimmt etwas
gegen die Kompetenz, die er als Zeitgenosse
und als Maler hat. Es gelang, und er schuf
damit Dinge, die heute für uns zu den stärk-
sten beispielhaften Werten gehören, die uns
seine Generation hinterließ.
Die zukünftige Biennale
von Venedig
(Von unserem römischen Korre-
spondenten)
Im Bibliothekssaal für zeitgenössische
Kunst im Dogenpalast von Venedig hat, ein-
berufen von dem Präsidenten der Aus-
sfellungsleitung, on. Conte Volpi di Misurata,
soeben eine Versammlung der ausländischen
Vertreter jener Länder stattgefunden, die an
der XVIII. Biennale teilnehmen werden.
Deutschland war durch Dr. Hans Posse ver-
treten, ferner nahmen Repräsentanten Groß-
britanniens, der Vereinigten Staaten, Bel-
giens, Ungarns und Spaniens an der Ver-
sammlung teil. In dieser Versammlung wur-
den zunächst die Ergebnisse der diesjährigen
Ausstellung bekanntgegeben. Troß der
schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse ist die
Besucherzahl gegenüber der Biennale 1928
gestiegen. Die Verkäufe aber sind nur um
ein Geringes hinter denen der vorigen Aus-
stellung zurückgeblieben. Für die nächste
Biennale haben Verhandlungen mit Polen,
Dänemark, der Schweiz und Griechenland
stattgefunden, die die Schaffung eigener
Pavillons für die betreffenden Länder zum
Ziele hatten. Diese Verhandlungen sind
glücklich zu Ende geführt worden, so daß für
(Forfseßung auf Seite 24)
Büste des heiligen Cassian. Tirol, um 1450
Büste de Saint Cassian. Le Tyrol, 15 me siecle
Bust of Saint Cassian. The Tyrol, 15 th Century
Lindenholz mit alter Polychromie — Tilleul — Linden
Theodor Rozendaal, Mohrenstrasse, Berlin