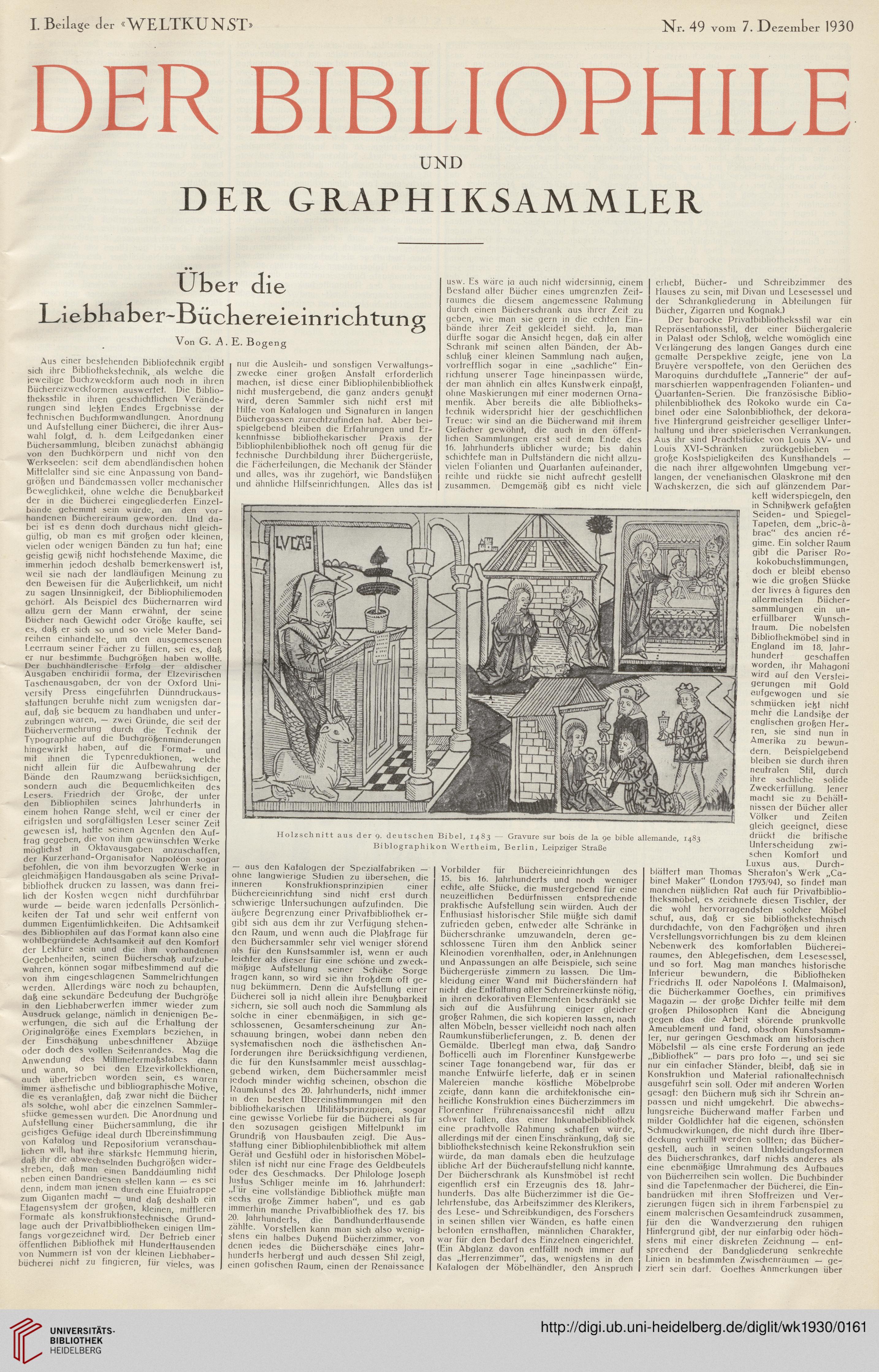I. Beilage der «WELTKUNST*
Nr. 49 vom 7. Dezember 1930
DER BIBLIOPHILE
UND
DER GRAPHIKSAMMLER
Uber die
Liebbaber-Büchereieinrichtung
Von G. A . E. Bogeng
Aus einer bestehenden Bibliotechnik ergibt
sich ihre Bibliothekstechnik, als welche die
jeweilige Buchzweckform auch noch in ihren
Biichereizweckformen auswertet. Die Biblio-
theksstile in ihren geschichtlichen Verände-
rungen sind leisten Endes Ergebnisse der
technischen Buchformwandlungen. Anordnung
und Aufstellung einer Bücherei, die ihrer Aus-
wahl folgt, d. h. dem Leitgedanken einer
Büchersammlung, bleiben zunächst abhängig
von den Buchkörpern und nicht von den
Werkseelen: seit dem abendländischen hohen
Mittelalter sind sie eine Anpassung von Band-
größen und Bändemassen voller mechanischer
Beweglichkeit, ohne welche die Benußbarkeit
der in die Bücherei eingegliederten Einzel-
bände gehemmt sein würde, an den vor-
handenen Büchereiraum geworden. Und da-
bei ist es denn doch durchaus nicht gleich-
gültig, ob man es mit großen oder kleinen,
vielen oder wenigen Bänden zu tun hat; eine
geistig gewiß nicht hochstehende Maxime, die
immerhin jedoch deshalb bemerkenswert ist,
weil sie nach der landläufigen Meinung zu
den Beweisen für die Äußerlichkeit, um nicht
zu sagen Unsinnigkeit, der Bibliophiliemoden
gehört. Als Beispiel des Büchernarren wird
allzu gern der Mann erwähnt, der seine
Bücher nach Gewicht oder Größe kaufte, sei
es, daß er sich so und so viele Meter Band-
reihen einhandelte, um den ausgemessenen
I.eerraum seiner Fächer zu füllen, sei es, daß
er nur bestimmte Buchgrößen haben wollte.
Der buchhändlerische Erfolg der aldischer
Ausgaben enchiridii forma, der Elzevirischen
Taschenausgaben, der von der Oxford Uni-
versity Press eingeführten Dünndruckaus-
stattungen beruhte nicht zum wenigsten dar-
auf, daß sie bequem zu handhaben und unter-
zub’ringen waren, — zwei Gründe, die seit der
Büchervermehrung durch die Technik der
Typographie auf die Buchgrößenminderungen
hingewirkf haben, auf die Format- und
mit ihnen die Typenredukfionen, welche
nicht allein für die Aufbewahrung der
Bände den Raumzwang berücksichtigen,
sondern auch die Bequemlichkeiten des
Lesers. Friedrich der Große, der unter
den Bibliophilen seines Jahrhunderts in
einem hohen Range steht, weil er einer der
eifrigsten und sorgfältigsten Leser seiner Zeit
gewesen ist, hafte seinen Agenten den Auf-
trag gegeben, die von ihm gewünschten Werke
möglichst in Oktavausgaben anzuschaffen,
der Kurzerhand-Organisator Napoleon sogar
befohlen, die von ihm bevorzugten Werke in
gleichmäßigen Handausgaben als seine Privat-
bibliothek drucken zu lassen, was dann frei-
lich der Kosten wegen nicht durchführbar
wurde — beide waren jedenfalls Persönlich-
keiten der Tat und sehr weit entfernt von
dummen Eigentümlichkeiten. Die Achtsamkeit
des Bibliophilen auf das Format kann also eine
wohlbegründete Achtsamkeit auf den Komfort
der Lektüre sein und die ihm vorhandenen
Gegebenheiten, seinen Bücherschaß aufzube-
wahren, können sogar mitbestimmend auf die
von ihm eingeschlagenen Sammelrichtungen
werden. Allerdings wäre noch zu behaupten,
daß eine sekundäre Bedeutung der Buchgröße
in den Liebhaberwerten immer wieder zum
Ausdruck gelange, nämlich in denjenigen Be-
wertungen, die sich auf die Erhaltung der
Originalgröße eines Exemplars beziehen, in
der Einschäßung unbeschnittener Abzüge
oder doch des vollen Seitenrandes. Mag die
Anwendung des Millimefermaßstabes dann
und wann, so bei den Elzevirkollektionen,
auch übertrieben worden sein, es waren
immer ästhetische und bibliographische Motive,
die es veranlaßten, daß zwar nicht die Bücher
als solche, wohl aber die einzelnen Sammler-
stücke gemessen wurden. Die Anordnung und
Aufstellung einer Büchersammlung, die ihr
geistiges Gefüge ideal durch Libereinstimmung
von Katalog und Reposjforium veranschau-
lichen will, hat ihre stärkste Hemmung hierin,
daß ihr die abwechselnden Buchgrößen wider-
streben, daß man einen Banddäumling nicht
neben einen Bandriesen stellen kann — es sei
denn, indem man jenen durch eine Etuiatrappe
zum Giganten macht - und dag deshalb ein
Etagensystem der großen, kleinen, mittleren
Formate als konstruktionstechnische Grund-
lage auch der Privatbibliotheken einigen Um-
fangs vorgezeichnet wird. Der Betrieb einer
öffentlichen Bibliothek mit Hunderttausenden
von Nummern ist von der kleinen Liebhaber-
bücherei nicht zu fingieren, für vieles, was
nur die Ausleih- und sonstigen Verwaltungs-
zwecke einer großen Anstalt erforderlich
machen, ist diese einer Bibliophilenbibliothek
nicht mustergebend, die ganz anders genußt
wird, deren Sammler sich nicht erst mit
Hilfe von Katalogen und Signaturen in langen
Büchergassen zurechtzufinden hat. Aber bei-
spielgebend bleiben die Erfahrungen und Er-
kenntnisse bibliothekarischer Praxis der
Bibliophilenbibliothek noch oft genug für die
technische Durchbildung ihrer Büchergerüste,
die Fächerteilungen, die Mechanik der Ständer
und alles, was ihr zugehört, wie Bandstüßen
und ähnliche Hilfseinrichtungen. Alles das ist
— aus den Katalogen der Spezialfabriken —
ohne langwierige Studien zu übersehen, die
inneren Konstruktionsprinzipien einer
Büchereieinrichtung sind nicht erst durch
schwierige Untersuchungen aufzufinden. Die
äußere Begrenzung einer Privatbibliothek er-
gibt sich aus dem ihr zur Verfügung stehen-
den Raum, und wenn auch die Plaßfrage für
den Büchersammler sehr viel weniger störend
als für den Kunstsammler ist, wenn er auch
leichter als dieser für eine schöne und zweck-
mäßige Aufstellung seiner Schaße Sorge
tragen kann, so wird sie ihn troßdem oft ge-
nug bekümmern. Denn die Aufstellung einer
Bücherei soll ja nicht allein ihre Benußbarkeit
sichern, sie soll auch noch die Sammlung als
solche in einer ebenmäßigen, in sich ge-
schlossenen, Gesamterscheinung zur An-
schauung bringen, wobei dann neben den
systematischen noch die ästhetischen An-
forderungen ihre Berücksichtigung verdienen,
die für den Kunstsammler meist ausschlag-
gebend wirken, dem Büchersammler meist
jedoch minder wichtig scheinen, obschon die
Raumkunst des 20. Jahrhunderts, nicht immer
in den besten Übereinstimmungen mit den
bibliothekarischen Ufilitätsprinzipien, sogar
eine gewisse Vorliebe für die Bücherei als für
den sozusagen geistigen Mittelpunkt im
Grundriß von Hausbauten zeigt. Die Aus-
stattung einer Bibliophilenbibliothek mit altem
Gerät und Gestühl oder in historischen Möbel-
stilen ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels
oder des Geschmacks. Der Philologe Joseph
Justus Schliger meinte im 16. Jahrhundert:
»f ür eine vollständige Bibliothek müßte man
sechs große Zimmer haben“, und es gab
immerhin manche Privatbibliothek des 17. bis
20. Jahrhunderts, die Bandhunderttausende
zählte. Vorstellen kann man sich also wenig-
stens ein halbes Dußend Bücherzimmer, von
denen jedes die Bücherschäße eines Jahr-
hunderts herbergt und auch dessen Stil zeigt,
einen gotischen Raum, einen der Renaissance
usw. Es wäre ja auch nicht widersinnig, einem
Bestand alter Bücher eines umgrenzten Zeit-
raumes die diesem angemessene Rahmung
durch einen Bücherschrank aus ihrer Zeit zu
geben, wie man sie gern in die echten Ein-
bände ihrer Zeit gekleidet sieht. Ja, man
dürfte sogar die Ansicht hegen, daß ein alter
Schrank mit seinen alten Bänden, der Ab-
schluß einer kleinen Sammlung nach außen,
vortrefflich sogar in eine „sachliche“ Ein-
richtung unserer Tage hineinpassen würde,
der man ähnlich ein altes Kunstwerk einpaßt,
ohne Maskierungen mit einer modernen Orna-
mentik. Aber bereits die alte Bibliotheks-
technik widerspricht hier der geschichtlichen
Treue: wir sind an die Bücherwand mit ihrem
Gefächer gewöhnt, die auch in den öffent-
lichen Sammlungen erst seit dem Ende des
16. Jahrhunderts üblicher wurde; bis dahin
schichtete man in Pultständern die nicht allzu-
vielen Folianten und Quartanten aufeinander,
reihte und rückte sie nicht aufrecht gestellt
zusammen. Demgemäß gibt es nicht viele
Vorbilder für Büchereieinrichtungen des
15. bis 16. Jahrhunderts und noch weniger
echte, alte Stücke, die mustergebend für eine
neuzeitlichen Bedürfnissen entsprechende
praktische Aufstellung sein würden. Auch der
Enthusiast historischer Stile müßte sich damit
zufrieden geben, entweder alte Schränke in
Bücherschränke umzuwandeln, deren ge-
schlossene Türen ihm den Anblick seiner
Kleinodien vorenthalten, oder, in Anlehnungen
und Anpassungen an alte Beispiele, sich seine
Büchergerüste zimmern zu lassen. Die Um-
kleidung einer Wand mit Bücherständern hat
nicht die Entfaltung aller Schreinerkünste nötig,
in ihren dekorativen Elementen beschränkt sie
sich auf die Ausführung einiger gleicher
großer Rahmen, die sich kopieren lassen, nach
alten Möbeln, besser vielleicht noch nach alten
Raumkunstüberlieferungen, z. B. denen der
Gemälde, überlegt man etwa, daß Sandro
Botticelli auch im Florentiner Kunstgewerbe
seiner Tage tonangebend war, für das er
manche Entwürfe lieferte, daß er in seinen
Malereien manche köstliche Möbelprobe
zeigte, dann kann die architektonische ein-
heitliche Konstruktion eines Bücherzimmers im
Florentiner Frührenaissancestil nicht allzu
schwer fallen, das einer Inkunabelbibliothek
eine prachtvolle Rahmung schaffen würde,
allerdings mit der einen Einschränkung, daß sie
bibliothekstechnisch keine Rekonstruktion sein
würde, da man damals eben die heutzutage
übliche Art der Bücheraufstellung nicht kannte.
Der Bücherschrank als Kunstmöbel ist recht
eigentlich erst ein Erzeugnis des 18. Jahr-
hunderts. Das alte Bücherzimmer ist die Ge-
lehrtenstube, das Arbeitszimmer des Klerikers,
des Lese- und Schreibkundigen, des Forschers
in seinen stillen vier Wänden, es hatte einen
betonten ernsthaften, männlichen Charakter,
war für den Bedarf des Einzelnen eingerichtet.
(Ein Abglanz davon entfällt noch immer auf
das „Herrenzimmer“, das, wenigstens in den
Katalogen der Möbelhändler, den Anspruch I
erhebt, Bücher- und Schreibzimmer des
Flauses zu sein, mit Divan und Lesesessel und
der Schrankgliederung in Abteilungen für
Bücher, Zigarren und Kognak.)
Der barocke Privatbibliotheksstil war ein
Repräsentationsstil, der einer Büchergalerie
in Palast oder Schloß, welche womöglich eine
Veilängerung des langen Ganges durch eine
gemalte Perspektive zeigte, jene von La
Bruyere verspottete, von den Gerüchen des
Maroquins durchduffete „Tannerie“ der auf-
marschierten wappentragenden Folianten- und
Quartanten-Serien. Die französische Biblio-
philenbibliothek des Rokoko wurde ein Ca-
binet oder eine Salonbibliothek, der dekora-
tive Hintergrund geistreicher geselliger Unter-
haltung und ihrer spielerischen Verrankungen.
Aus ihr sind Prachtstücke von Louis XV- und
Louis XVI-Schränken zurückgeblieben —
große Kostspieligkeiten des Kunsthandels —
die nach ihrer altgewohnten Umgebung ver-
langen, der venetianischen Glaskrone mit den
Wachskerzen, die sich auf glänzendem Par-
kett widerspiegeln, den
in Schnißwerk gefaßten
Seiden- und Spiegel-
Tapeten, dem „bric-ä-
brac“ des ancien re-
gime. Ein solcher Raum
gibt die Pariser Ro-
kokobuchstimmungen,
doch er bleibt ebenso
wie die großen Stücke
der livres ä figures den
allermeisten Bücher-
sammlungen ein un-
erfüllbarer Wunsch-
traum. Die nobelsten
Bibliolhekmöbel sind in
England im 18. Jahr-
hundert geschaffen
worden, ihr Mahagoni
wird auf den Verstei-
gerungen mit Gold
aufgewogen und sie
schmücken jeßt nicht
mehr die Landsiße der
englischen großen Her-
ren, sie sind nun in
Amerika zu bewun-
dern. Beispielgebend
bleiben sie durch ihren
neutralen Stil, durch
ihre sachliche solide
Zweckerfüllung. Jener
macht sie zu Behält-
nissen der Bücher aller
Völker und Zeiten
gleich geeignet, diese
drückt die britische
Unterscheidung zwi-
schen Komfort und
Luxus aus. Durch-
blättert man Thomas Sheraton’s Werk „Ca-
binet Maker“ (London 1793/94), so findet man
manchen nüßlichen Rat auch für Privatbiblio-
theksmöbel, es zeichnete diesen Tischler, der
die wohl hervorragendsten solcher Möbel
schuf, aus, daß er sie bibliothekstechnisch
durchdachte, von den Fachgrößen und ihren
Verstellungsvorrichfungen bis zu dem kleinen
Nebenwerk des komfortablen Bücherei-
raumes, den Ablegetischen, dem Lesesesse],
und so fort. Mag man manches historische
Interieur bewundern, die Bibliotheken
Friedrichs II. oder Napoleons I. (Malmaison),
die Bücherkammer Goethes, ein primitives
Magazin — der große Dichter teilte mit dem
großen Philosophen Kant die Abneigung
gegen das die Arbeit störende prunkvolle
Ameublement und fand, obschon Kunstsamm-
ler, nur geringen Geschmack am historischen
Möbelstil — als eine erste Forderung an jede
„Bibliothek" — pars pro toto —, und sei sie
nur ein einfacher Ständer, bleibt, daß sie in
Konstruktion und Material rationaltechnisch
ausgeführt sein soll. Oder mit anderen Worten
gesagt: den Büchern muß sich ihr Schrein an-
passen und nicht umgekehrt. Die abwechs-
lungsreiche Bücherwand matter Farben und
milder Goldlichter hat die eigenen, schönsten
Schmuckwirkungen, die nicht durch ihre Über-
deckung verhüllt werden sollten; das Bücher-
gestell, auch in seinen Umkleidungsformen
des Bücherschrankes, darf nichts anderes als
eine ebenmäßige Umrahmung des Aufbaues
von Bücherreihen sein wollen. Die Buchbinder
sind die Tapefenmacher der Bücherei, die Ein-
bandrücken mit ihren Stoffreizen und Ver-
zierungen fügen sich in ihrem Farbenspiel zu
einem malerischen Gesamteindruck zusammen,
für den die Wandverzierung den ruhigen
Hintergrund gibt, der nur einfarbig oder höch-
stens mit einer diskreten Zeichnung — ent-
sprechend der Bandgliederung senkrechte
Linien in bestimmten Zwischenräumen — ge-
ziert sein darf. Goethes Anmerkungen über
Holzschnitt aus der 9. deutschen Bibel, 1483 — Gravüre sur bois de la ge bible allemande, 1483
Bibiographikon Wertheim, Berlin, Leipziger Straße
Nr. 49 vom 7. Dezember 1930
DER BIBLIOPHILE
UND
DER GRAPHIKSAMMLER
Uber die
Liebbaber-Büchereieinrichtung
Von G. A . E. Bogeng
Aus einer bestehenden Bibliotechnik ergibt
sich ihre Bibliothekstechnik, als welche die
jeweilige Buchzweckform auch noch in ihren
Biichereizweckformen auswertet. Die Biblio-
theksstile in ihren geschichtlichen Verände-
rungen sind leisten Endes Ergebnisse der
technischen Buchformwandlungen. Anordnung
und Aufstellung einer Bücherei, die ihrer Aus-
wahl folgt, d. h. dem Leitgedanken einer
Büchersammlung, bleiben zunächst abhängig
von den Buchkörpern und nicht von den
Werkseelen: seit dem abendländischen hohen
Mittelalter sind sie eine Anpassung von Band-
größen und Bändemassen voller mechanischer
Beweglichkeit, ohne welche die Benußbarkeit
der in die Bücherei eingegliederten Einzel-
bände gehemmt sein würde, an den vor-
handenen Büchereiraum geworden. Und da-
bei ist es denn doch durchaus nicht gleich-
gültig, ob man es mit großen oder kleinen,
vielen oder wenigen Bänden zu tun hat; eine
geistig gewiß nicht hochstehende Maxime, die
immerhin jedoch deshalb bemerkenswert ist,
weil sie nach der landläufigen Meinung zu
den Beweisen für die Äußerlichkeit, um nicht
zu sagen Unsinnigkeit, der Bibliophiliemoden
gehört. Als Beispiel des Büchernarren wird
allzu gern der Mann erwähnt, der seine
Bücher nach Gewicht oder Größe kaufte, sei
es, daß er sich so und so viele Meter Band-
reihen einhandelte, um den ausgemessenen
I.eerraum seiner Fächer zu füllen, sei es, daß
er nur bestimmte Buchgrößen haben wollte.
Der buchhändlerische Erfolg der aldischer
Ausgaben enchiridii forma, der Elzevirischen
Taschenausgaben, der von der Oxford Uni-
versity Press eingeführten Dünndruckaus-
stattungen beruhte nicht zum wenigsten dar-
auf, daß sie bequem zu handhaben und unter-
zub’ringen waren, — zwei Gründe, die seit der
Büchervermehrung durch die Technik der
Typographie auf die Buchgrößenminderungen
hingewirkf haben, auf die Format- und
mit ihnen die Typenredukfionen, welche
nicht allein für die Aufbewahrung der
Bände den Raumzwang berücksichtigen,
sondern auch die Bequemlichkeiten des
Lesers. Friedrich der Große, der unter
den Bibliophilen seines Jahrhunderts in
einem hohen Range steht, weil er einer der
eifrigsten und sorgfältigsten Leser seiner Zeit
gewesen ist, hafte seinen Agenten den Auf-
trag gegeben, die von ihm gewünschten Werke
möglichst in Oktavausgaben anzuschaffen,
der Kurzerhand-Organisator Napoleon sogar
befohlen, die von ihm bevorzugten Werke in
gleichmäßigen Handausgaben als seine Privat-
bibliothek drucken zu lassen, was dann frei-
lich der Kosten wegen nicht durchführbar
wurde — beide waren jedenfalls Persönlich-
keiten der Tat und sehr weit entfernt von
dummen Eigentümlichkeiten. Die Achtsamkeit
des Bibliophilen auf das Format kann also eine
wohlbegründete Achtsamkeit auf den Komfort
der Lektüre sein und die ihm vorhandenen
Gegebenheiten, seinen Bücherschaß aufzube-
wahren, können sogar mitbestimmend auf die
von ihm eingeschlagenen Sammelrichtungen
werden. Allerdings wäre noch zu behaupten,
daß eine sekundäre Bedeutung der Buchgröße
in den Liebhaberwerten immer wieder zum
Ausdruck gelange, nämlich in denjenigen Be-
wertungen, die sich auf die Erhaltung der
Originalgröße eines Exemplars beziehen, in
der Einschäßung unbeschnittener Abzüge
oder doch des vollen Seitenrandes. Mag die
Anwendung des Millimefermaßstabes dann
und wann, so bei den Elzevirkollektionen,
auch übertrieben worden sein, es waren
immer ästhetische und bibliographische Motive,
die es veranlaßten, daß zwar nicht die Bücher
als solche, wohl aber die einzelnen Sammler-
stücke gemessen wurden. Die Anordnung und
Aufstellung einer Büchersammlung, die ihr
geistiges Gefüge ideal durch Libereinstimmung
von Katalog und Reposjforium veranschau-
lichen will, hat ihre stärkste Hemmung hierin,
daß ihr die abwechselnden Buchgrößen wider-
streben, daß man einen Banddäumling nicht
neben einen Bandriesen stellen kann — es sei
denn, indem man jenen durch eine Etuiatrappe
zum Giganten macht - und dag deshalb ein
Etagensystem der großen, kleinen, mittleren
Formate als konstruktionstechnische Grund-
lage auch der Privatbibliotheken einigen Um-
fangs vorgezeichnet wird. Der Betrieb einer
öffentlichen Bibliothek mit Hunderttausenden
von Nummern ist von der kleinen Liebhaber-
bücherei nicht zu fingieren, für vieles, was
nur die Ausleih- und sonstigen Verwaltungs-
zwecke einer großen Anstalt erforderlich
machen, ist diese einer Bibliophilenbibliothek
nicht mustergebend, die ganz anders genußt
wird, deren Sammler sich nicht erst mit
Hilfe von Katalogen und Signaturen in langen
Büchergassen zurechtzufinden hat. Aber bei-
spielgebend bleiben die Erfahrungen und Er-
kenntnisse bibliothekarischer Praxis der
Bibliophilenbibliothek noch oft genug für die
technische Durchbildung ihrer Büchergerüste,
die Fächerteilungen, die Mechanik der Ständer
und alles, was ihr zugehört, wie Bandstüßen
und ähnliche Hilfseinrichtungen. Alles das ist
— aus den Katalogen der Spezialfabriken —
ohne langwierige Studien zu übersehen, die
inneren Konstruktionsprinzipien einer
Büchereieinrichtung sind nicht erst durch
schwierige Untersuchungen aufzufinden. Die
äußere Begrenzung einer Privatbibliothek er-
gibt sich aus dem ihr zur Verfügung stehen-
den Raum, und wenn auch die Plaßfrage für
den Büchersammler sehr viel weniger störend
als für den Kunstsammler ist, wenn er auch
leichter als dieser für eine schöne und zweck-
mäßige Aufstellung seiner Schaße Sorge
tragen kann, so wird sie ihn troßdem oft ge-
nug bekümmern. Denn die Aufstellung einer
Bücherei soll ja nicht allein ihre Benußbarkeit
sichern, sie soll auch noch die Sammlung als
solche in einer ebenmäßigen, in sich ge-
schlossenen, Gesamterscheinung zur An-
schauung bringen, wobei dann neben den
systematischen noch die ästhetischen An-
forderungen ihre Berücksichtigung verdienen,
die für den Kunstsammler meist ausschlag-
gebend wirken, dem Büchersammler meist
jedoch minder wichtig scheinen, obschon die
Raumkunst des 20. Jahrhunderts, nicht immer
in den besten Übereinstimmungen mit den
bibliothekarischen Ufilitätsprinzipien, sogar
eine gewisse Vorliebe für die Bücherei als für
den sozusagen geistigen Mittelpunkt im
Grundriß von Hausbauten zeigt. Die Aus-
stattung einer Bibliophilenbibliothek mit altem
Gerät und Gestühl oder in historischen Möbel-
stilen ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels
oder des Geschmacks. Der Philologe Joseph
Justus Schliger meinte im 16. Jahrhundert:
»f ür eine vollständige Bibliothek müßte man
sechs große Zimmer haben“, und es gab
immerhin manche Privatbibliothek des 17. bis
20. Jahrhunderts, die Bandhunderttausende
zählte. Vorstellen kann man sich also wenig-
stens ein halbes Dußend Bücherzimmer, von
denen jedes die Bücherschäße eines Jahr-
hunderts herbergt und auch dessen Stil zeigt,
einen gotischen Raum, einen der Renaissance
usw. Es wäre ja auch nicht widersinnig, einem
Bestand alter Bücher eines umgrenzten Zeit-
raumes die diesem angemessene Rahmung
durch einen Bücherschrank aus ihrer Zeit zu
geben, wie man sie gern in die echten Ein-
bände ihrer Zeit gekleidet sieht. Ja, man
dürfte sogar die Ansicht hegen, daß ein alter
Schrank mit seinen alten Bänden, der Ab-
schluß einer kleinen Sammlung nach außen,
vortrefflich sogar in eine „sachliche“ Ein-
richtung unserer Tage hineinpassen würde,
der man ähnlich ein altes Kunstwerk einpaßt,
ohne Maskierungen mit einer modernen Orna-
mentik. Aber bereits die alte Bibliotheks-
technik widerspricht hier der geschichtlichen
Treue: wir sind an die Bücherwand mit ihrem
Gefächer gewöhnt, die auch in den öffent-
lichen Sammlungen erst seit dem Ende des
16. Jahrhunderts üblicher wurde; bis dahin
schichtete man in Pultständern die nicht allzu-
vielen Folianten und Quartanten aufeinander,
reihte und rückte sie nicht aufrecht gestellt
zusammen. Demgemäß gibt es nicht viele
Vorbilder für Büchereieinrichtungen des
15. bis 16. Jahrhunderts und noch weniger
echte, alte Stücke, die mustergebend für eine
neuzeitlichen Bedürfnissen entsprechende
praktische Aufstellung sein würden. Auch der
Enthusiast historischer Stile müßte sich damit
zufrieden geben, entweder alte Schränke in
Bücherschränke umzuwandeln, deren ge-
schlossene Türen ihm den Anblick seiner
Kleinodien vorenthalten, oder, in Anlehnungen
und Anpassungen an alte Beispiele, sich seine
Büchergerüste zimmern zu lassen. Die Um-
kleidung einer Wand mit Bücherständern hat
nicht die Entfaltung aller Schreinerkünste nötig,
in ihren dekorativen Elementen beschränkt sie
sich auf die Ausführung einiger gleicher
großer Rahmen, die sich kopieren lassen, nach
alten Möbeln, besser vielleicht noch nach alten
Raumkunstüberlieferungen, z. B. denen der
Gemälde, überlegt man etwa, daß Sandro
Botticelli auch im Florentiner Kunstgewerbe
seiner Tage tonangebend war, für das er
manche Entwürfe lieferte, daß er in seinen
Malereien manche köstliche Möbelprobe
zeigte, dann kann die architektonische ein-
heitliche Konstruktion eines Bücherzimmers im
Florentiner Frührenaissancestil nicht allzu
schwer fallen, das einer Inkunabelbibliothek
eine prachtvolle Rahmung schaffen würde,
allerdings mit der einen Einschränkung, daß sie
bibliothekstechnisch keine Rekonstruktion sein
würde, da man damals eben die heutzutage
übliche Art der Bücheraufstellung nicht kannte.
Der Bücherschrank als Kunstmöbel ist recht
eigentlich erst ein Erzeugnis des 18. Jahr-
hunderts. Das alte Bücherzimmer ist die Ge-
lehrtenstube, das Arbeitszimmer des Klerikers,
des Lese- und Schreibkundigen, des Forschers
in seinen stillen vier Wänden, es hatte einen
betonten ernsthaften, männlichen Charakter,
war für den Bedarf des Einzelnen eingerichtet.
(Ein Abglanz davon entfällt noch immer auf
das „Herrenzimmer“, das, wenigstens in den
Katalogen der Möbelhändler, den Anspruch I
erhebt, Bücher- und Schreibzimmer des
Flauses zu sein, mit Divan und Lesesessel und
der Schrankgliederung in Abteilungen für
Bücher, Zigarren und Kognak.)
Der barocke Privatbibliotheksstil war ein
Repräsentationsstil, der einer Büchergalerie
in Palast oder Schloß, welche womöglich eine
Veilängerung des langen Ganges durch eine
gemalte Perspektive zeigte, jene von La
Bruyere verspottete, von den Gerüchen des
Maroquins durchduffete „Tannerie“ der auf-
marschierten wappentragenden Folianten- und
Quartanten-Serien. Die französische Biblio-
philenbibliothek des Rokoko wurde ein Ca-
binet oder eine Salonbibliothek, der dekora-
tive Hintergrund geistreicher geselliger Unter-
haltung und ihrer spielerischen Verrankungen.
Aus ihr sind Prachtstücke von Louis XV- und
Louis XVI-Schränken zurückgeblieben —
große Kostspieligkeiten des Kunsthandels —
die nach ihrer altgewohnten Umgebung ver-
langen, der venetianischen Glaskrone mit den
Wachskerzen, die sich auf glänzendem Par-
kett widerspiegeln, den
in Schnißwerk gefaßten
Seiden- und Spiegel-
Tapeten, dem „bric-ä-
brac“ des ancien re-
gime. Ein solcher Raum
gibt die Pariser Ro-
kokobuchstimmungen,
doch er bleibt ebenso
wie die großen Stücke
der livres ä figures den
allermeisten Bücher-
sammlungen ein un-
erfüllbarer Wunsch-
traum. Die nobelsten
Bibliolhekmöbel sind in
England im 18. Jahr-
hundert geschaffen
worden, ihr Mahagoni
wird auf den Verstei-
gerungen mit Gold
aufgewogen und sie
schmücken jeßt nicht
mehr die Landsiße der
englischen großen Her-
ren, sie sind nun in
Amerika zu bewun-
dern. Beispielgebend
bleiben sie durch ihren
neutralen Stil, durch
ihre sachliche solide
Zweckerfüllung. Jener
macht sie zu Behält-
nissen der Bücher aller
Völker und Zeiten
gleich geeignet, diese
drückt die britische
Unterscheidung zwi-
schen Komfort und
Luxus aus. Durch-
blättert man Thomas Sheraton’s Werk „Ca-
binet Maker“ (London 1793/94), so findet man
manchen nüßlichen Rat auch für Privatbiblio-
theksmöbel, es zeichnete diesen Tischler, der
die wohl hervorragendsten solcher Möbel
schuf, aus, daß er sie bibliothekstechnisch
durchdachte, von den Fachgrößen und ihren
Verstellungsvorrichfungen bis zu dem kleinen
Nebenwerk des komfortablen Bücherei-
raumes, den Ablegetischen, dem Lesesesse],
und so fort. Mag man manches historische
Interieur bewundern, die Bibliotheken
Friedrichs II. oder Napoleons I. (Malmaison),
die Bücherkammer Goethes, ein primitives
Magazin — der große Dichter teilte mit dem
großen Philosophen Kant die Abneigung
gegen das die Arbeit störende prunkvolle
Ameublement und fand, obschon Kunstsamm-
ler, nur geringen Geschmack am historischen
Möbelstil — als eine erste Forderung an jede
„Bibliothek" — pars pro toto —, und sei sie
nur ein einfacher Ständer, bleibt, daß sie in
Konstruktion und Material rationaltechnisch
ausgeführt sein soll. Oder mit anderen Worten
gesagt: den Büchern muß sich ihr Schrein an-
passen und nicht umgekehrt. Die abwechs-
lungsreiche Bücherwand matter Farben und
milder Goldlichter hat die eigenen, schönsten
Schmuckwirkungen, die nicht durch ihre Über-
deckung verhüllt werden sollten; das Bücher-
gestell, auch in seinen Umkleidungsformen
des Bücherschrankes, darf nichts anderes als
eine ebenmäßige Umrahmung des Aufbaues
von Bücherreihen sein wollen. Die Buchbinder
sind die Tapefenmacher der Bücherei, die Ein-
bandrücken mit ihren Stoffreizen und Ver-
zierungen fügen sich in ihrem Farbenspiel zu
einem malerischen Gesamteindruck zusammen,
für den die Wandverzierung den ruhigen
Hintergrund gibt, der nur einfarbig oder höch-
stens mit einer diskreten Zeichnung — ent-
sprechend der Bandgliederung senkrechte
Linien in bestimmten Zwischenräumen — ge-
ziert sein darf. Goethes Anmerkungen über
Holzschnitt aus der 9. deutschen Bibel, 1483 — Gravüre sur bois de la ge bible allemande, 1483
Bibiographikon Wertheim, Berlin, Leipziger Straße