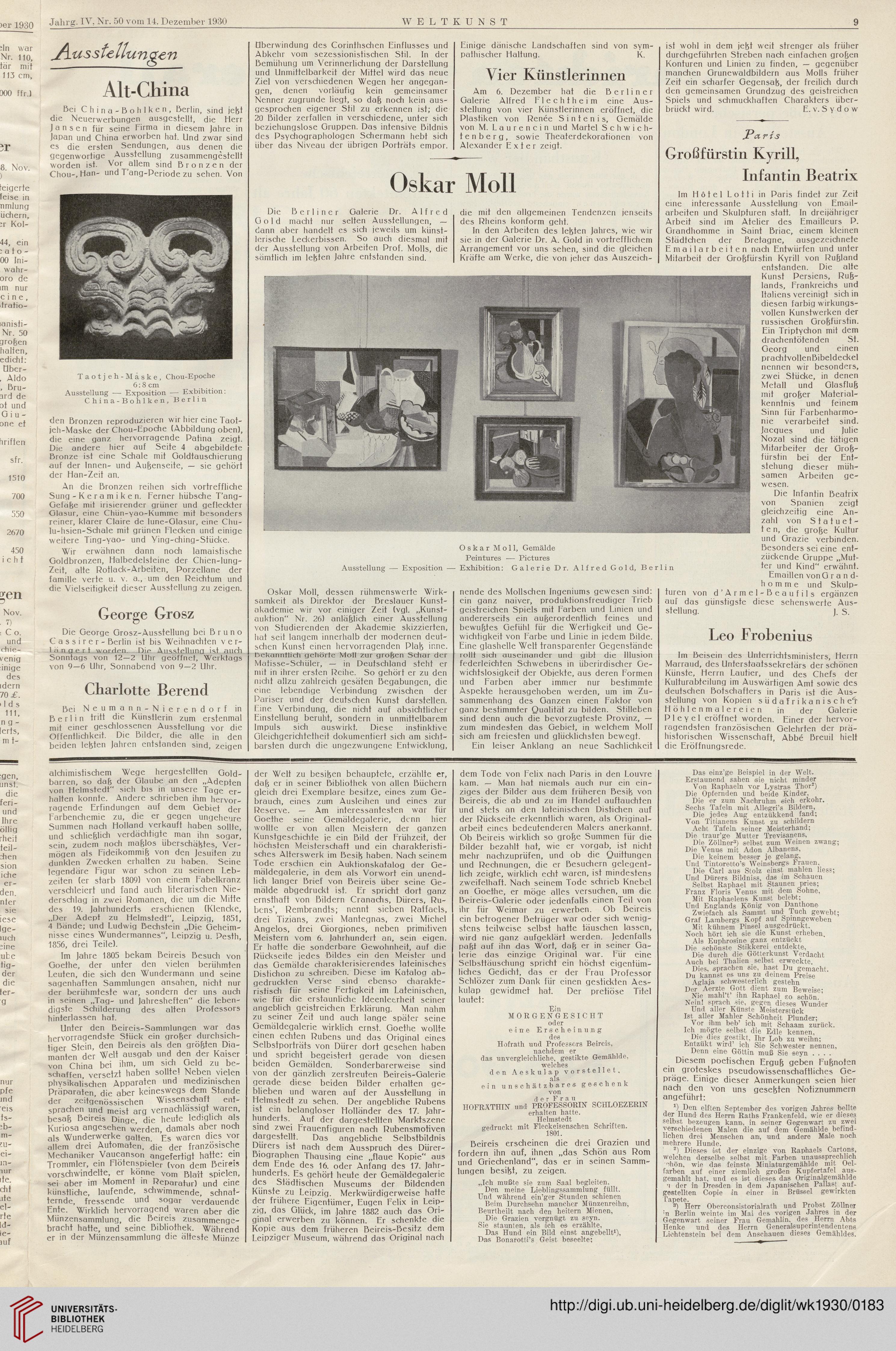Jahrg. IV, Nr. 50 vom 14, Dezember 1930
WELT KUNST
9
Ausstellungen
Alt-China
Bei China-Bohlken, Berlin, sind jeßt
die Neuerwerbungen ausgestellt, die Herr
Jansen für seine Firma in diesem Jahre in
Japan und China erworben hat. Und zwar sind
es die ersten Sendungen, aus denen die
gegenwortige Ausstellung zusammengestellt
worden ist. Vor allem sind Bronzen der
Chou-, Han- und T’ang-Periode zu sehen. Von
Taotjeh-Maske, Chou-Epoche
6:8 cm
Ausstellung •— Exposition — Exhibition:
China-Bohlken, Berlin
den Bronzen reproduzieren wir hier eine Taot-
jeh-Maske der Chou-Epoche (Abbildung oben),
die eine ganz hervorragende Patina zeigt.
Die andere hier auf Seite 4 abgebildefe
Bronze ist eine Schale mit Goldtauschierung
auf der Innen- und Außenseite, — sie gehört
der Han-Zeit an.
An die Bronzen reihen sich vortreffliche
Sung -Keramiken. Ferner hübsche T’ang-
Gefäße mit irisierender grüner und gefleckter
Glasur, eine Chün-yao-Kumme mit besonders
reiner, klarer Claire de lune-Glasur, eine Chu-
lu-hsien-Schale mit grünen Flecken und einige
weitere Ting-yao- und Ving-chin.g-Stücke.
Wir erwähnen dann noch lamaistische
Goldbronzen, Halbedelsteine der Chien-lung-
Zeit, alte Rotlack-Arbeiten, Porzellane der
famille verte u. v. a., um den Reichtum und
die Vielseitigkeit dieser Ausstellung zu zeigen.
George Grosz
Die George Grosz-Ausstellung bei Bruno
Cassirer - Berlin ist bis Weihnachten v e r-
längerl worden. Die Ausstellung ist auch
Sonntags von 12—2 Uhr geöffnet, Werktags
von 9—6 Uhr, Sonnabend von 9—2 Uhr.
Charlotte Berend
Bei Neumann-Nierendorf in
Berlin tritt die Künstlerin zum erstenmal
mit einer geschlossenen Ausstellung vor die
Öffentlichkeit. Die Bilder, die alle in den
beiden lebten Jahren entstanden sind, zeigen
Überwindung des Corinfhschen Einflusses und
Abkehr vom sezessionistischen Stil. In der
Bemühung um Verinnerlichung der Darstellung
und Unmittelbarkeit der Mittel wird das neue
Ziel von verschiedenen Wegen her angegan-
gen, denen vorläufig kein gemeinsamer
Nenner zugrunde liegt, so daß noch kein aus-
gesprochen eigener Stil zu erkennen ist; die
20 Bilder zerfallen in verschiedene, unter sich
beziehungslose Gruppen. Das intensive Bildnis
des Psychographologen Schermann hebt sich
über das Niveau der übrigen Porträts empor.
Oskar Moll
Die Berliner Galerie Dr. Alfred
Gold macht nur selten Ausstellungen, —
dann aber handelt es sich jeweils um künst-
lerische Leckerbissen. So auch diesmal mit
der Ausstellung von Arbeiten Prof. Molls, die
sämtlich im lebten Jahre entstanden sind.
Oskar Moll, Gemälde
Peintures -— Pictures
Ausstellung — Exposition —• Exhibition: Galerie Dr. Alfred Gold, Berlin
Einige dänische Landschaften sind von sym-
pathischer Haltung. K.
Vier Künstlerinnen
Am 6. Dezember hat die Berliner
Galerie Alfred Fl echt heim eine Aus-
stellung von vier Künstlerinnen eröffnet, die
Plastiken von Renee S i n t e n i s, Gemälde
von M. Laurencin und Märtel Schw ich-
t en berg, sowie Theaterdekorationen von
Alexander Exter zeigt.
die mit den allgemeinen Tendenzen jenseits
des Rheins konform geht.
In den Arbeiten des lebten Jahres, wie wir
sie in der Galerie Dr. A. Gold in vortrefflichem
Arrangement vor uns sehen, sind die gleichen
Kräfte am Werke, die von jeher das Auszeich-
Oskar Moll, dessen rühmenswerte Wirk-
samkeit als Direktor der Breslauer Kunst-
akademie wir vor einiger Zeit (vgl. „Kunst-
auktion“ Nr. 26) anläßlich einer Ausstellung
von Studierenden der Akademie skizzierten,
hat seit langem innerhalb der modernen deut-
schen Kunst einen hervorragenden Plab inne.
Bekanntlich gehörte Moll zur großen Schar der
Matisse-Schüler, — in Deutschland steht er
mit in ihrer ersten Reihe. So gehört er zu den
nicht allzu zahlreich gesäten Begabungen, die
eine lebendige Verbindung zwischen der
Pariser und der deutschen Kunst darstellen.
Eine Verbindung, die nicht auf absichtlicher
Einstellung beruht, sondern in unmittelbarem
Impuls sich auswirkt. Diese instinktive
Gleichgerichtetheit dokumentiert sich am sicht-
barsten durch die ungezwungene Entwicklung,
nende des Mollschen Ingeniums gewesen sind:
ein ganz naiver, produktionsfreudiger Trieb
geistreichen Spiels mit Farben und Linien und
andererseits ein außerordentlich feines und
bewußtes Gefühl für die Wertigkeit und Ge-
wichtigkeit von Farbe und Linie in jedem Bilde.
Eine glashelle Welt transparenter Gegenstände
rollt sich auseinander und gibt die Illusion
federleichten Schwebens in überirdischer Ge-
wichtslosigkeit der Objekte, aus deren Formen
und Farben aber immer nur bestimmte
Aspekte herausgehoben werden, um im Zu-
sammenhang des Ganzen einen Faktor von
ganz bestimmter Qualität zu bilden. Stilleben
sind denn auch die bevorzugteste Provinz, —
zum mindesten das Gebiet, in welchem Moll
sich am freiesten und glücklichsten bewegt.
Ein leiser Anklang an neue Sachlichkeit
ist wohl in dem jeßt weit strenger als früher
durchgeführten Streben nach einfachen großen
Konturen und Linien zu finden, — gegenüber
manchen Grunewaldbildern aus Molls früher
Zeit ein scharfer Gegensaß, der freilich durch
den gemeinsamen Grundzug des geistreichen
Spiels und schmuckhaften Charakters über-
brückt wird. E. v. Sydow
Paris
Großfürstin Kyrill,
Infantin Beatrix
Im Hotel Lotti in Paris findet zur Zeit
eine interessante Ausstellung von Email-
arbeiten und Skulpturen statt. In dreijähriger
Arbeit sind im Atelier des Emailleurs P.
Grandhomme in Saint Briac, einem kleinen
Städtchen der Bretagne, ausgezeichnete
F. mailarbeiten nach Entwürfen und unter
Mitarbeit der Großfürstin Kyrill von Rußland
entstanden. Die alte
Kunst Persiens, Ruß-
lands, Frankreichs und
Italiens vereinigt sich in
diesen farbig wirkungs-
vollen Kunstwerken der
russischen Großfürstin.
Ein Triptychon mit dem
drachentötenden St.
Georg und einen
prachtvollenßibeldeckel
nennen wir besonders,
zwei Stücke, in denen
Metall und Glasfluß
mit großer Material-
kenntnis und feinem
Sinn für Farbenharmo-
nie verarbeitet sind.
Jacques und Julie
Nozal sind die tätigen
Mitarbeiter der Groß-
fürstin bei der Ent-
stehung dieser müh-
samen Arbeiten ge-
wesen.
Die Infantin Beatrix
von Spanien zeigt
gleichzeitig eine An-
zahl von S t a t u e t -
t e n, die große Kultur
und Grazie verbinden.
Besonders sei eine ent-
zückende Gruppe „Mut-
ter und Kind“ erwähnt.
Emaillen von Grand-
homme und Skulp-
turen von d’Armel-Beaufils ergänzen
auf das günstigste diese sehenswerte Aus-
stellung. J. S.
Leo Frobenius
Im Beisein des Unferrichtsminisfers, Herrn
Marraud, des Unterstaatssekretärs der schönen
Künste, Herrn Lautier, und des Chefs der
Kulturabteilung im Auswärtigen Amt sowie des
deutschen Botschafters in Paris ist die Aus-
stellung von Kopien südafrikanisch eT
Höhlenmalereien in der Galerie
Pleyel eröffnet worden. Einer der hervor-
ragendsten französischen Gelehrten der prä-
historischen Wissenschaft, Abbe Breuil hielt
die Eröffnungsrede.
alchimistischem Wege hergestellten Gold-
barren, so daß der Glaube an den „Adepten
von Helmstedt" sich bis in unsere Tage er-
halten konnte. Andere schrieben ihm hervor-
ragende Erfindungen auf dem Gebiet der
Farbenchemie zu, die er gegen ungeheure
Summen nach Holland verkauft haben sollte,
und schließlich verdächtigte man ihn sogar,
sein, zudem noch maßlos überschäßfes, Ver-
mögen als Fideikommiß von den Jesuiten zu
dunklen Zwecken erhalten zu haben. Seine
legendäre Figur war schon zu seinen Leb-
zeiten (er starb 1809) von einem Fabelkranz
verschleiert und fand auch literarischen Nie-
derschlag in zwei Romanen, die um die Mitte
des 19. Jahrhunderts erschienen (Klencke,
„Der Adept zu Helmstedt“, Leipzig, 1851,
4 Bände; und Ludwig Bechstein „Die Geheim-
nisse eines Wundermannes“, Leipzig u. Pesth,
1856, drei Teile).
Im Jahre 1805 bekam Beireis Besuch von
Goethe, der unter den vielen berühmten
Leuten, die sich den Wundermann und seine
sagenhaften Sammlungen ansahen, nicht nur
der berühmteste war, sondern der uns auch
in seinen „Tag- und Jahresheften" die leben-
digste Schilderung des alten Professors
hinterlassen hat.
Unter den Beireis-Sammlungen war das
hervorragendste Stück ein großer durchsich-
tiger Stein, den Beireis als den größten Dia-
manten der Welt ausgab und den der Kaiser
von China bei ihm um sich Geld zu be-
schaffen versetzt haben sollte! Neben vielen
physikalischen Apparaten und medizinischen
Präparaten, die aber keineswegs dem Stande
der zeitgenössischen Wissenschaft ent-
sprachen und meist arg vernachlässigt waren,
besaß Beireis Dinge, die heute lediglich als
Kuriosa angesehen werden, damals aber noch
als Wunderwerke galten. Es waren dies vor
allem drei Automaten, die der französische
Mechaniker Vaucanson angefertigt hatte: ein
Trommler, ein Flötenspieler (von dem Beireis
vorschwindelte, er könne vom Blatt spielen,
sei aber im Moment in Reparatur) und eine
künstliche, laufende, schwimmende, schnat-
ternde, fressende und sogar verdauende
Ente. Wirklich hervorragend waren aber die
Münzensammlung, die Beireis zusammenge-
bracht hatte, und seine Bibliothek. Während
er in der Münzensammlung die älteste Münze
der Welt zu besißen behauptete, erzählte er,
daß er in seiner Bibliothek von allen Büchern
gleich drei Exemplare besitze, eines zum Ge-
brauch, eines zum Ausleihen und eines zur
Reserve. — Am interessantesten war für
Goethe seine Gemäldegalerie, denn hier
wollte er von allen Meistern der ganzen
Kunstgeschichte je ein Bild der Frühzeit, der
höchsten Meisterschaft und ein charakteristi-
sches Alterswerk im Besiß haben. Nach seinem
Tode erschien ein Auktionskatalog der Ge-
mäldegalerie, in dem als Vorwort ein unend-
lich langer Brief von Beireis über seine Ge-
mälde abgedruckt ist. Er spricht dort ganz
ernsthaft von Bildern Cranachs, Dürers, Ru-
bens’, Rembrandts; nennt sieben Raffaels,
drei Tizians, zwei Mantegnas, zwei Michel
Angelos, drei Giorgiones, neben primitiven
Meistern vom 6. Jahrhundert an, sein eigen.
Er hatte die sonderbare Gewohnheit, auf die
Rückseite jedes Bildes ein den Meister und
das Gemälde charakterisierendes lateinisches
Distichon zu schreiben. Diese im Katalog ab-
gedruckten Verse sind ebenso charakte-
ristisch für seine Fertigkeit im Lateinischen,
wie für die erstaunliche Ideenleerheit seiner
angeblich geistreichen Erklärung. Man nahm
zu seiner Zeit und auch lange später seine
Gemäldegalerie wirklich ernst. Goethe wollte
einen echten Rubens und das Original eines
Selbstporträts von Dürer dort gesehen haben
und spricht begeistert gerade von diesen
beiden Gemälden. Sonderbarerweise sind
von der gänzlich zerstreuten Beireis-Galerie
gerade diese beiden Bilder erhalten ge-
blieben und waren auf der Ausstellung in
Helmstedt zu sehen. Der angebliche Rubens
ist ein belangloser Holländer des 17. Jahr-
hunderts. Auf der dargestellten Marktszene
sind zwei Frauenfiguren nach Rubensmotiven
dargestellt. Das angebliche Selbstbildnis
Dürers ist nach dem Ausspruch des Dürer-
Biographen Thausing eine „flaue Kopie“ aus
dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahr-
hunderts. Es gehört heute der Gemäldegalerie
des Städtischen Museums der Bildenden
Künste zu Leipzig. Merkwürdigerweise hatte
der frühere Eigentümer, Eugen Felix in Leip-
zig, das Glück, im Jahre 1882. auch das Ori-
ginal erwerben zu können. Er schenkte die
Kopie aus dem früheren Beireis-Besitz dem
Leipziger Museum, während das Original nach
dem Tode von Felix nach Paris in den Louvre
kam. — Man hat niemals auch nur ein ein-
ziges der Bilder aus dem früheren Besiß von
Beireis, die ab und zu im Handel auffauchten
und stets an den lateinischen Distichen auf
der Rückseite erkenntlich waren, als Original-
arbeit eines bedeutenderen Malers anerkannt.
Ob Beireis wirklich so große Summen für die
Bilder bezahlt hat, wie er vorgab, ist nicht
mehr nachzuprüfen, und ob die Quittungen
und Rechnungen, die er Besuchern gelegent-
lich zeigte, wirklich echt waren, ist mindestens
zweifelhaft. Nach seinem Tode schrieb Knebel
an Goethe, er möge alles versuchen, um die
Beireis-Galerie oder jedenfalls einen Teil von
ihr für Weimar zu erwerben. Ob Beireis
ein betrogener Betrüger war oder sich wenig-
stens teilweise selbst hatte täuschen lassen,
wird nie ganz aufgeklärt werden. Jedenfalls
paßt auf ihn das Wort, daß er in seiner Ga-
lerie das einzige Original war. Für eine
Selbsttäuschung spricht ein höchst eigentüm-
liches Gedicht, das er der Frau Professor
Schlözer zum Dank für einen gestickten Aes-
kulap gewidmet hat. Der pretiöse Titel
lautet:
Ein
MORGENGESICHT
oder
■e i n e Erseheinu ng
des
Hofrath und Professors Beireis,
nachdem er
das unvergleichliche, gestikte Gemahlde,
welches
den A e s k u 1 a p vorstellet,
ein unschätzbarem geschenk
von
der Frau
HOFRÄTHIN und PROFESSORIN SCHLOEZERIN
erhalten hatte.
Helmstedt
gedruckt mit Fleekeisenschen Schriften.
B 1801.
Beireis erscheinen die drei Grazien und
fordern ihn auf, ihnen „das Schön aus Rom
und Griechenland", das er in seinen Samm-
lungen besißt, zu zeigen.
„Ich mußte sie zum Saal begleiten,
Den meine Lieblingssammlung füllt.
Und während ein’ger Stunden schienen
Beim Durehseh.n mancher Münizenreihn,
Beurtheilt nach den heitern Mienen,
Die Grazien vergnügt zu seyn.
Sie staunten, als ich e® erzählte,
Das Hund ein Bild einst angebellt1^
Das Bonarotti’s. Geist beseelte;
Das einz’gie Beispiel in der Welt.
Erstaunend sahen ,sie nicht minder
Von Raphaeln vor Lystras Thor2)
Die Opfernden und beide Kinder,
Die er zum Nachruhm, eich erkohr.
Sechs Tafeln mit. Allegri’s Bildern,
Die jedes Aug entzükkend. fand;
Von Titianen® Kunst zu schildern
Acht Tafeln seiner Meisterhand;
Die traurige Mutter Trevisanens,
Die Zöllner3) selbst zum Weinen zwang;
Die Venus mit Adon Albanens,
Die keinem: besser je gelang,
Und Tintoretito’s Weinsbergs Frauen,
Die Carl aus Stolz einst mahlen liess;
Und Dürers Bildniss, das im Schauen
Selbst Raphael mit Staunen pries;
Franz Floris Venus mit dem Sohne,
Mit Raphaelen* Kunst belebt;
Und Englands König von Danthone
Zwiefach als Sammt und1 Tuch gewebt;
Graf Lambergs Kopf auf Spinngeweben
Mit kühnem Pinsel ausgedrückt.
Noch hört ich sie die Kunst erheben.
Als Euphros'ine ganz entzückt.
Die schönste Stikkerei entdekte,
Die durch die' Götterkunst Verdacht
Auch bei Thalien _ selbst erweckte.
Dies, sprachen sie, hast Du gemacht.
Du kannst es uns zu deinem Preise
Aglaja schwesterlich gestehn
Der Aerzte Gott dient zum Beweise;
Nie mahl’t’ ihn Raphael so schön
Nein! sprach sie, gegen dieses Wunder
Und aller Künste Meisterstück
Ist aller Mahler Schönheit Plunder;
Vor ihm beb ich mit Schaam zurück.
Ich mögt© selbst die Edle kennen,
Die dies .geetikt, Ihr Lob zu weihn;
Entzukt wird ich Sie Schwester nennen,
Denn eine Göttin muß Sie •seyn ....
Diesem poetischen Erguß geben Fußnoten
ein groteskes pseudowissenschaftliches Ge-
präge. Einige dieser Anmerkungen seien hier
nach den von uns geseßfen Notiznummern
angeführt:
*) Den elften September des vorigen Jahre® bellte
der Hund des Herrn Raths Frankenfeld, wie er dieses
selbst bezeugen kann, in .seiner Gegenwart zu zwei
yerechiedenen Malen die auf dem Gemählde befind-
lichen drei Menschen an, und andere Male noch
mehrere Hunde.
2) Diese* ist der einzige von Raphaels Gartons,
welchen derselbe selbst mit Farben unaussprechlich
cihön, wie das feinste Miniaturgemählde mit Oel-
farben auf einer ziemlich großen Kupfertafel aus-
gemah'lt hat, und es ist dieses das Originalgemählde
’i der in Dresden in dem Japanischen Pallast auf-
gestellten Copie in einer in Brüssel gewirkten
Tapete.
3) Herr Oberconsistorialrath und Probst Zöllner
'n Berlin weinte im Mai des vorigen Jahres in der
Gegenwart seiner Frau Gemahlin, des Herrn Abts
Henke und des Herrn Generalsupenntendentens
Lichtenstein bei dem Anschauen dieses Gemähldes.
WELT KUNST
9
Ausstellungen
Alt-China
Bei China-Bohlken, Berlin, sind jeßt
die Neuerwerbungen ausgestellt, die Herr
Jansen für seine Firma in diesem Jahre in
Japan und China erworben hat. Und zwar sind
es die ersten Sendungen, aus denen die
gegenwortige Ausstellung zusammengestellt
worden ist. Vor allem sind Bronzen der
Chou-, Han- und T’ang-Periode zu sehen. Von
Taotjeh-Maske, Chou-Epoche
6:8 cm
Ausstellung •— Exposition — Exhibition:
China-Bohlken, Berlin
den Bronzen reproduzieren wir hier eine Taot-
jeh-Maske der Chou-Epoche (Abbildung oben),
die eine ganz hervorragende Patina zeigt.
Die andere hier auf Seite 4 abgebildefe
Bronze ist eine Schale mit Goldtauschierung
auf der Innen- und Außenseite, — sie gehört
der Han-Zeit an.
An die Bronzen reihen sich vortreffliche
Sung -Keramiken. Ferner hübsche T’ang-
Gefäße mit irisierender grüner und gefleckter
Glasur, eine Chün-yao-Kumme mit besonders
reiner, klarer Claire de lune-Glasur, eine Chu-
lu-hsien-Schale mit grünen Flecken und einige
weitere Ting-yao- und Ving-chin.g-Stücke.
Wir erwähnen dann noch lamaistische
Goldbronzen, Halbedelsteine der Chien-lung-
Zeit, alte Rotlack-Arbeiten, Porzellane der
famille verte u. v. a., um den Reichtum und
die Vielseitigkeit dieser Ausstellung zu zeigen.
George Grosz
Die George Grosz-Ausstellung bei Bruno
Cassirer - Berlin ist bis Weihnachten v e r-
längerl worden. Die Ausstellung ist auch
Sonntags von 12—2 Uhr geöffnet, Werktags
von 9—6 Uhr, Sonnabend von 9—2 Uhr.
Charlotte Berend
Bei Neumann-Nierendorf in
Berlin tritt die Künstlerin zum erstenmal
mit einer geschlossenen Ausstellung vor die
Öffentlichkeit. Die Bilder, die alle in den
beiden lebten Jahren entstanden sind, zeigen
Überwindung des Corinfhschen Einflusses und
Abkehr vom sezessionistischen Stil. In der
Bemühung um Verinnerlichung der Darstellung
und Unmittelbarkeit der Mittel wird das neue
Ziel von verschiedenen Wegen her angegan-
gen, denen vorläufig kein gemeinsamer
Nenner zugrunde liegt, so daß noch kein aus-
gesprochen eigener Stil zu erkennen ist; die
20 Bilder zerfallen in verschiedene, unter sich
beziehungslose Gruppen. Das intensive Bildnis
des Psychographologen Schermann hebt sich
über das Niveau der übrigen Porträts empor.
Oskar Moll
Die Berliner Galerie Dr. Alfred
Gold macht nur selten Ausstellungen, —
dann aber handelt es sich jeweils um künst-
lerische Leckerbissen. So auch diesmal mit
der Ausstellung von Arbeiten Prof. Molls, die
sämtlich im lebten Jahre entstanden sind.
Oskar Moll, Gemälde
Peintures -— Pictures
Ausstellung — Exposition —• Exhibition: Galerie Dr. Alfred Gold, Berlin
Einige dänische Landschaften sind von sym-
pathischer Haltung. K.
Vier Künstlerinnen
Am 6. Dezember hat die Berliner
Galerie Alfred Fl echt heim eine Aus-
stellung von vier Künstlerinnen eröffnet, die
Plastiken von Renee S i n t e n i s, Gemälde
von M. Laurencin und Märtel Schw ich-
t en berg, sowie Theaterdekorationen von
Alexander Exter zeigt.
die mit den allgemeinen Tendenzen jenseits
des Rheins konform geht.
In den Arbeiten des lebten Jahres, wie wir
sie in der Galerie Dr. A. Gold in vortrefflichem
Arrangement vor uns sehen, sind die gleichen
Kräfte am Werke, die von jeher das Auszeich-
Oskar Moll, dessen rühmenswerte Wirk-
samkeit als Direktor der Breslauer Kunst-
akademie wir vor einiger Zeit (vgl. „Kunst-
auktion“ Nr. 26) anläßlich einer Ausstellung
von Studierenden der Akademie skizzierten,
hat seit langem innerhalb der modernen deut-
schen Kunst einen hervorragenden Plab inne.
Bekanntlich gehörte Moll zur großen Schar der
Matisse-Schüler, — in Deutschland steht er
mit in ihrer ersten Reihe. So gehört er zu den
nicht allzu zahlreich gesäten Begabungen, die
eine lebendige Verbindung zwischen der
Pariser und der deutschen Kunst darstellen.
Eine Verbindung, die nicht auf absichtlicher
Einstellung beruht, sondern in unmittelbarem
Impuls sich auswirkt. Diese instinktive
Gleichgerichtetheit dokumentiert sich am sicht-
barsten durch die ungezwungene Entwicklung,
nende des Mollschen Ingeniums gewesen sind:
ein ganz naiver, produktionsfreudiger Trieb
geistreichen Spiels mit Farben und Linien und
andererseits ein außerordentlich feines und
bewußtes Gefühl für die Wertigkeit und Ge-
wichtigkeit von Farbe und Linie in jedem Bilde.
Eine glashelle Welt transparenter Gegenstände
rollt sich auseinander und gibt die Illusion
federleichten Schwebens in überirdischer Ge-
wichtslosigkeit der Objekte, aus deren Formen
und Farben aber immer nur bestimmte
Aspekte herausgehoben werden, um im Zu-
sammenhang des Ganzen einen Faktor von
ganz bestimmter Qualität zu bilden. Stilleben
sind denn auch die bevorzugteste Provinz, —
zum mindesten das Gebiet, in welchem Moll
sich am freiesten und glücklichsten bewegt.
Ein leiser Anklang an neue Sachlichkeit
ist wohl in dem jeßt weit strenger als früher
durchgeführten Streben nach einfachen großen
Konturen und Linien zu finden, — gegenüber
manchen Grunewaldbildern aus Molls früher
Zeit ein scharfer Gegensaß, der freilich durch
den gemeinsamen Grundzug des geistreichen
Spiels und schmuckhaften Charakters über-
brückt wird. E. v. Sydow
Paris
Großfürstin Kyrill,
Infantin Beatrix
Im Hotel Lotti in Paris findet zur Zeit
eine interessante Ausstellung von Email-
arbeiten und Skulpturen statt. In dreijähriger
Arbeit sind im Atelier des Emailleurs P.
Grandhomme in Saint Briac, einem kleinen
Städtchen der Bretagne, ausgezeichnete
F. mailarbeiten nach Entwürfen und unter
Mitarbeit der Großfürstin Kyrill von Rußland
entstanden. Die alte
Kunst Persiens, Ruß-
lands, Frankreichs und
Italiens vereinigt sich in
diesen farbig wirkungs-
vollen Kunstwerken der
russischen Großfürstin.
Ein Triptychon mit dem
drachentötenden St.
Georg und einen
prachtvollenßibeldeckel
nennen wir besonders,
zwei Stücke, in denen
Metall und Glasfluß
mit großer Material-
kenntnis und feinem
Sinn für Farbenharmo-
nie verarbeitet sind.
Jacques und Julie
Nozal sind die tätigen
Mitarbeiter der Groß-
fürstin bei der Ent-
stehung dieser müh-
samen Arbeiten ge-
wesen.
Die Infantin Beatrix
von Spanien zeigt
gleichzeitig eine An-
zahl von S t a t u e t -
t e n, die große Kultur
und Grazie verbinden.
Besonders sei eine ent-
zückende Gruppe „Mut-
ter und Kind“ erwähnt.
Emaillen von Grand-
homme und Skulp-
turen von d’Armel-Beaufils ergänzen
auf das günstigste diese sehenswerte Aus-
stellung. J. S.
Leo Frobenius
Im Beisein des Unferrichtsminisfers, Herrn
Marraud, des Unterstaatssekretärs der schönen
Künste, Herrn Lautier, und des Chefs der
Kulturabteilung im Auswärtigen Amt sowie des
deutschen Botschafters in Paris ist die Aus-
stellung von Kopien südafrikanisch eT
Höhlenmalereien in der Galerie
Pleyel eröffnet worden. Einer der hervor-
ragendsten französischen Gelehrten der prä-
historischen Wissenschaft, Abbe Breuil hielt
die Eröffnungsrede.
alchimistischem Wege hergestellten Gold-
barren, so daß der Glaube an den „Adepten
von Helmstedt" sich bis in unsere Tage er-
halten konnte. Andere schrieben ihm hervor-
ragende Erfindungen auf dem Gebiet der
Farbenchemie zu, die er gegen ungeheure
Summen nach Holland verkauft haben sollte,
und schließlich verdächtigte man ihn sogar,
sein, zudem noch maßlos überschäßfes, Ver-
mögen als Fideikommiß von den Jesuiten zu
dunklen Zwecken erhalten zu haben. Seine
legendäre Figur war schon zu seinen Leb-
zeiten (er starb 1809) von einem Fabelkranz
verschleiert und fand auch literarischen Nie-
derschlag in zwei Romanen, die um die Mitte
des 19. Jahrhunderts erschienen (Klencke,
„Der Adept zu Helmstedt“, Leipzig, 1851,
4 Bände; und Ludwig Bechstein „Die Geheim-
nisse eines Wundermannes“, Leipzig u. Pesth,
1856, drei Teile).
Im Jahre 1805 bekam Beireis Besuch von
Goethe, der unter den vielen berühmten
Leuten, die sich den Wundermann und seine
sagenhaften Sammlungen ansahen, nicht nur
der berühmteste war, sondern der uns auch
in seinen „Tag- und Jahresheften" die leben-
digste Schilderung des alten Professors
hinterlassen hat.
Unter den Beireis-Sammlungen war das
hervorragendste Stück ein großer durchsich-
tiger Stein, den Beireis als den größten Dia-
manten der Welt ausgab und den der Kaiser
von China bei ihm um sich Geld zu be-
schaffen versetzt haben sollte! Neben vielen
physikalischen Apparaten und medizinischen
Präparaten, die aber keineswegs dem Stande
der zeitgenössischen Wissenschaft ent-
sprachen und meist arg vernachlässigt waren,
besaß Beireis Dinge, die heute lediglich als
Kuriosa angesehen werden, damals aber noch
als Wunderwerke galten. Es waren dies vor
allem drei Automaten, die der französische
Mechaniker Vaucanson angefertigt hatte: ein
Trommler, ein Flötenspieler (von dem Beireis
vorschwindelte, er könne vom Blatt spielen,
sei aber im Moment in Reparatur) und eine
künstliche, laufende, schwimmende, schnat-
ternde, fressende und sogar verdauende
Ente. Wirklich hervorragend waren aber die
Münzensammlung, die Beireis zusammenge-
bracht hatte, und seine Bibliothek. Während
er in der Münzensammlung die älteste Münze
der Welt zu besißen behauptete, erzählte er,
daß er in seiner Bibliothek von allen Büchern
gleich drei Exemplare besitze, eines zum Ge-
brauch, eines zum Ausleihen und eines zur
Reserve. — Am interessantesten war für
Goethe seine Gemäldegalerie, denn hier
wollte er von allen Meistern der ganzen
Kunstgeschichte je ein Bild der Frühzeit, der
höchsten Meisterschaft und ein charakteristi-
sches Alterswerk im Besiß haben. Nach seinem
Tode erschien ein Auktionskatalog der Ge-
mäldegalerie, in dem als Vorwort ein unend-
lich langer Brief von Beireis über seine Ge-
mälde abgedruckt ist. Er spricht dort ganz
ernsthaft von Bildern Cranachs, Dürers, Ru-
bens’, Rembrandts; nennt sieben Raffaels,
drei Tizians, zwei Mantegnas, zwei Michel
Angelos, drei Giorgiones, neben primitiven
Meistern vom 6. Jahrhundert an, sein eigen.
Er hatte die sonderbare Gewohnheit, auf die
Rückseite jedes Bildes ein den Meister und
das Gemälde charakterisierendes lateinisches
Distichon zu schreiben. Diese im Katalog ab-
gedruckten Verse sind ebenso charakte-
ristisch für seine Fertigkeit im Lateinischen,
wie für die erstaunliche Ideenleerheit seiner
angeblich geistreichen Erklärung. Man nahm
zu seiner Zeit und auch lange später seine
Gemäldegalerie wirklich ernst. Goethe wollte
einen echten Rubens und das Original eines
Selbstporträts von Dürer dort gesehen haben
und spricht begeistert gerade von diesen
beiden Gemälden. Sonderbarerweise sind
von der gänzlich zerstreuten Beireis-Galerie
gerade diese beiden Bilder erhalten ge-
blieben und waren auf der Ausstellung in
Helmstedt zu sehen. Der angebliche Rubens
ist ein belangloser Holländer des 17. Jahr-
hunderts. Auf der dargestellten Marktszene
sind zwei Frauenfiguren nach Rubensmotiven
dargestellt. Das angebliche Selbstbildnis
Dürers ist nach dem Ausspruch des Dürer-
Biographen Thausing eine „flaue Kopie“ aus
dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahr-
hunderts. Es gehört heute der Gemäldegalerie
des Städtischen Museums der Bildenden
Künste zu Leipzig. Merkwürdigerweise hatte
der frühere Eigentümer, Eugen Felix in Leip-
zig, das Glück, im Jahre 1882. auch das Ori-
ginal erwerben zu können. Er schenkte die
Kopie aus dem früheren Beireis-Besitz dem
Leipziger Museum, während das Original nach
dem Tode von Felix nach Paris in den Louvre
kam. — Man hat niemals auch nur ein ein-
ziges der Bilder aus dem früheren Besiß von
Beireis, die ab und zu im Handel auffauchten
und stets an den lateinischen Distichen auf
der Rückseite erkenntlich waren, als Original-
arbeit eines bedeutenderen Malers anerkannt.
Ob Beireis wirklich so große Summen für die
Bilder bezahlt hat, wie er vorgab, ist nicht
mehr nachzuprüfen, und ob die Quittungen
und Rechnungen, die er Besuchern gelegent-
lich zeigte, wirklich echt waren, ist mindestens
zweifelhaft. Nach seinem Tode schrieb Knebel
an Goethe, er möge alles versuchen, um die
Beireis-Galerie oder jedenfalls einen Teil von
ihr für Weimar zu erwerben. Ob Beireis
ein betrogener Betrüger war oder sich wenig-
stens teilweise selbst hatte täuschen lassen,
wird nie ganz aufgeklärt werden. Jedenfalls
paßt auf ihn das Wort, daß er in seiner Ga-
lerie das einzige Original war. Für eine
Selbsttäuschung spricht ein höchst eigentüm-
liches Gedicht, das er der Frau Professor
Schlözer zum Dank für einen gestickten Aes-
kulap gewidmet hat. Der pretiöse Titel
lautet:
Ein
MORGENGESICHT
oder
■e i n e Erseheinu ng
des
Hofrath und Professors Beireis,
nachdem er
das unvergleichliche, gestikte Gemahlde,
welches
den A e s k u 1 a p vorstellet,
ein unschätzbarem geschenk
von
der Frau
HOFRÄTHIN und PROFESSORIN SCHLOEZERIN
erhalten hatte.
Helmstedt
gedruckt mit Fleekeisenschen Schriften.
B 1801.
Beireis erscheinen die drei Grazien und
fordern ihn auf, ihnen „das Schön aus Rom
und Griechenland", das er in seinen Samm-
lungen besißt, zu zeigen.
„Ich mußte sie zum Saal begleiten,
Den meine Lieblingssammlung füllt.
Und während ein’ger Stunden schienen
Beim Durehseh.n mancher Münizenreihn,
Beurtheilt nach den heitern Mienen,
Die Grazien vergnügt zu seyn.
Sie staunten, als ich e® erzählte,
Das Hund ein Bild einst angebellt1^
Das Bonarotti’s. Geist beseelte;
Das einz’gie Beispiel in der Welt.
Erstaunend sahen ,sie nicht minder
Von Raphaeln vor Lystras Thor2)
Die Opfernden und beide Kinder,
Die er zum Nachruhm, eich erkohr.
Sechs Tafeln mit. Allegri’s Bildern,
Die jedes Aug entzükkend. fand;
Von Titianen® Kunst zu schildern
Acht Tafeln seiner Meisterhand;
Die traurige Mutter Trevisanens,
Die Zöllner3) selbst zum Weinen zwang;
Die Venus mit Adon Albanens,
Die keinem: besser je gelang,
Und Tintoretito’s Weinsbergs Frauen,
Die Carl aus Stolz einst mahlen liess;
Und Dürers Bildniss, das im Schauen
Selbst Raphael mit Staunen pries;
Franz Floris Venus mit dem Sohne,
Mit Raphaelen* Kunst belebt;
Und Englands König von Danthone
Zwiefach als Sammt und1 Tuch gewebt;
Graf Lambergs Kopf auf Spinngeweben
Mit kühnem Pinsel ausgedrückt.
Noch hört ich sie die Kunst erheben.
Als Euphros'ine ganz entzückt.
Die schönste Stikkerei entdekte,
Die durch die' Götterkunst Verdacht
Auch bei Thalien _ selbst erweckte.
Dies, sprachen sie, hast Du gemacht.
Du kannst es uns zu deinem Preise
Aglaja schwesterlich gestehn
Der Aerzte Gott dient zum Beweise;
Nie mahl’t’ ihn Raphael so schön
Nein! sprach sie, gegen dieses Wunder
Und aller Künste Meisterstück
Ist aller Mahler Schönheit Plunder;
Vor ihm beb ich mit Schaam zurück.
Ich mögt© selbst die Edle kennen,
Die dies .geetikt, Ihr Lob zu weihn;
Entzukt wird ich Sie Schwester nennen,
Denn eine Göttin muß Sie •seyn ....
Diesem poetischen Erguß geben Fußnoten
ein groteskes pseudowissenschaftliches Ge-
präge. Einige dieser Anmerkungen seien hier
nach den von uns geseßfen Notiznummern
angeführt:
*) Den elften September des vorigen Jahre® bellte
der Hund des Herrn Raths Frankenfeld, wie er dieses
selbst bezeugen kann, in .seiner Gegenwart zu zwei
yerechiedenen Malen die auf dem Gemählde befind-
lichen drei Menschen an, und andere Male noch
mehrere Hunde.
2) Diese* ist der einzige von Raphaels Gartons,
welchen derselbe selbst mit Farben unaussprechlich
cihön, wie das feinste Miniaturgemählde mit Oel-
farben auf einer ziemlich großen Kupfertafel aus-
gemah'lt hat, und es ist dieses das Originalgemählde
’i der in Dresden in dem Japanischen Pallast auf-
gestellten Copie in einer in Brüssel gewirkten
Tapete.
3) Herr Oberconsistorialrath und Probst Zöllner
'n Berlin weinte im Mai des vorigen Jahres in der
Gegenwart seiner Frau Gemahlin, des Herrn Abts
Henke und des Herrn Generalsupenntendentens
Lichtenstein bei dem Anschauen dieses Gemähldes.