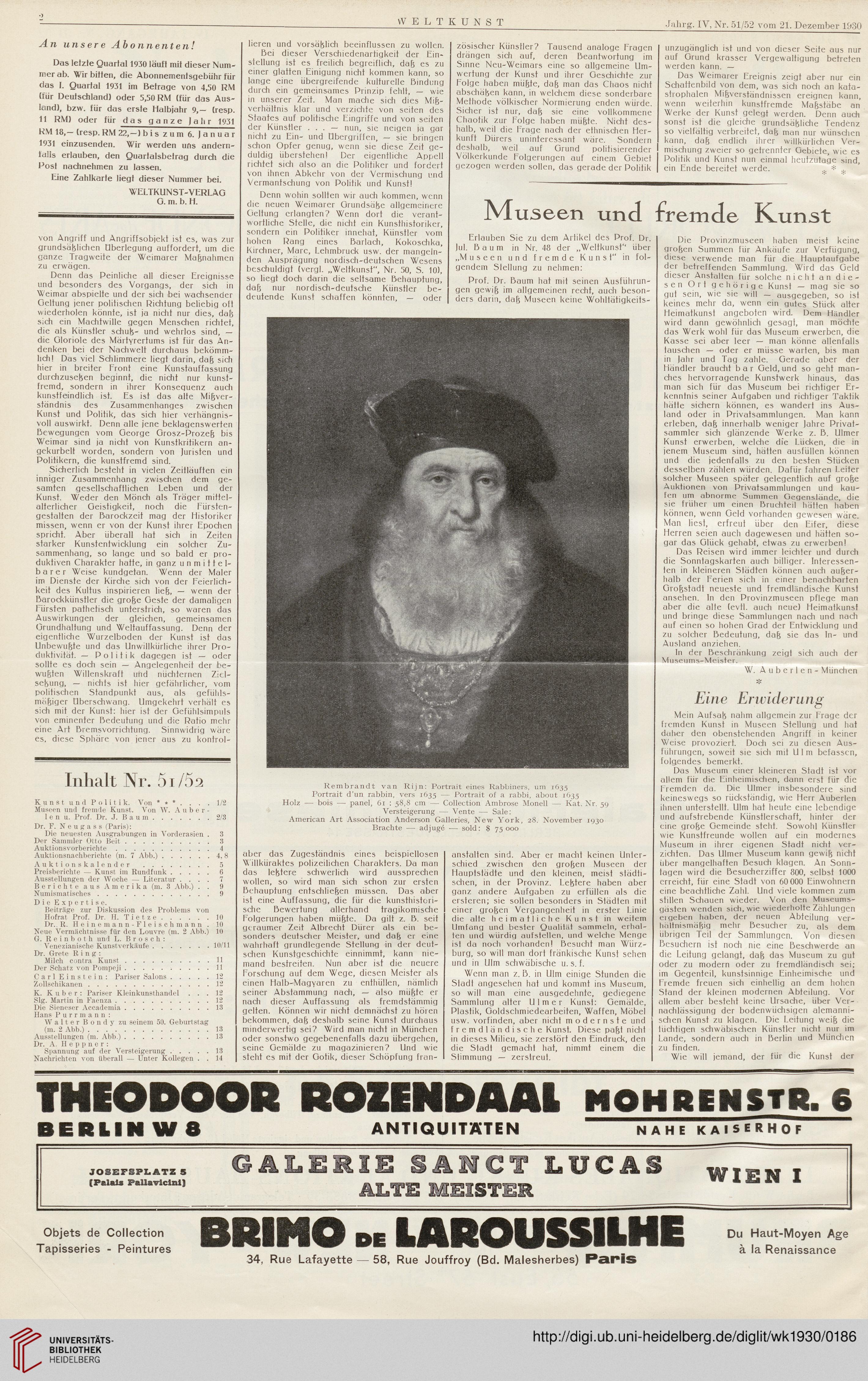__WELTKUNST
Jahrg. IV, Nr. 51/52 vom 21. Dezember 1930
An unsere Ab onn ent en!
Das letzte Quartal 1930 läuft mit dieser Num-
mer ab. Wir bitten, die Abonnementsgebiihr für
das I. Quartal 1931 im Betrage von 4,50 RM
(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-
land), bzw. für das erste Halbjahr 9,— (resp.
11 RM) oder für das ganze Jahr 1931
RM 18,— (resp. RM 22,—) bis zum 6. Januar
1931 einzusenden. Wir werden uns andern-
falls erlauben, den Quartalsbetrag durch die
Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zählkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
von Angriff und Angriffsobjekt ist es, was zur
grundsäfelichen Überlegung auffordert, um die
ganze Tragweite der Weimarer Maßnahmen
zu erwägen.
Denn das Peinliche all dieser Ereignisse
und besonders des Vorgangs, der sich in
Weimar abspielte und der sich bei wachsender
Geltung jener politischen Richtung beliebig oft
wiederholen könnte, ist ja nicht nur dies, dafe
sich ein Machtwille gegen Menschen richtet,
die als Künstler schüfe- und wehrlos sind, —
die Gloriole des Märtyrertums ist für das An-
denken bei der Nachwelt durchaus bekömm-
lich! Das viel Schlimmere liegt darin, dafe sich
hier in breiter Front eine Kunstauffassung
durchzusefeen beginnt, die nicht nur kunst-
fremd, sondern in ihrer Konsequenz auch
kunstfeindlich ist. Es ist das alte Mißver-
ständnis des Zusammenhanges zwischen
Kunst und Politik, das sich hier verhängnis-
voll auswirkt. Denn alle jene beklagenswerten
Bewegungen vom George Grosz-Prozefe bis
Weimar sind ja nicht von Kunstkritikern an-
gekurbelt worden, sondern von Juristen und
Politikern, die kunstfremd sind.
Sicherlich besteht in vielen Zeitläuften ein
inniger Zusammenhang zwischen dem ge-
samten gesellschaftlichen Leben und der
Kunst. Weder den Mönch als Träger mittel-
alterlicher Geistigkeit, noch die Fürsten-
gestalten der Barockzeit mag der Historiker
missen, wenn er von der Kunst ihrer Epochen
spricht. Aber überall hat sich in Zeiten
starker Kunstentwicklung ein solcher Zu-
sammenhang, so lange und so bald er pro-
duktiven Charakter hatte, in ganz unmittel-
barer Weise kundgetan. Wenn der Maler
im Dienste der Kirche sich von der Feierlich-
keit des Kultus inspirieren liefe, — wenn der
Barockkünstler die grofee Geste der damaligen
Fürsten pathetisch unterstrich, so waren das
Auswirkungen der gleichen, gemeinsamen
Grundhaltung und Weltauffassung. Denn der
eigentliche Wurzelboden der Kunst ist das
Unbewufete und das Unwillkürliche ihrer Pro-
duktivität. — Politik dagegen ist — oder
sollte es doch sein — Angelegenheit der be-
wußten Willenskraft und nüchternen Ziel-
sefeung, — nichts ist hier gefährlicher, vom
politischen Standpunkt aus, als gefühls-
mäfeiger Überschwang. Umgekehrt verhält es
sich mit der Kunst: hier ist der Gefühlsimpuls
von eminenter Bedeutung und die Ratio mehr
eine Art Bremsvorrichtung. Sinnwidrig wäre
es, diese Sphäre von jener aus zu kontrol-
Kunst und Politik. Von***. . . . 1/2
Museen und fremde Kunst. Von W. Auber-
1 e n u. Prof. Dr. J. B a u m.2/3
Dr. F. Neugass (Paris):
Die neuesten Ausgrabungen in Vorderasien . 3
Der Sammler Otto Beit.3
Auktionsvorberichte.4
Auktionsnaehberiehte (m. 7 Abb.).4, 8
A u k t i o n s k a 1 e n d e r .5
Preisberichte — Kunst im Rundfunk.6
Ausstellungen der Woche — Literatur .... 7
Berichte aus Amerika (m. 3 Abb.) . . 9
Numismatisches.9
Die Expertise.
Beiträge zur Diskussion des Problems von
Hofrat Prof. Dr. H. T i e t z e.10
Dr. R. Heinemann-Fleischmann . 10
Neue Vermächtnisse für den Louvre (m. 2 Abb.) 10
G. Reinboth und L. Brosch:
Venezianische Kunstverkäufe.10/11
Dr. Grete Ring:
Milch contra Kunst.11
Der Schatz von Pompeji.11
Carl Einstein: Pariser Salons.12
Zollschikanen.12
K. K u b e r : Pariser Kleinkunsthandel ... 12
Slg. Martin in Faenza ..12
Die Sieneser Accademia.13
Hans Purrmann :
Walter Bondy zu seinem 50. Geburtstag
(m. 2 Abb.).13
Ausstellungen (m. Abb.).13
Dr. A. Heppner:
Spannung auf der Versteigerung.13
Nachrichten von überall — Unter Kollegen . . 14
Heren und vorsäfelich beeinflussen zu wollen.
Bei dieser Verschiedenartigkeit der Ein-
stellung ist es freilich begreiflich, dafe es zu
einer glatten Einigung nicht kommen kann, so
lange eine übergreifende kulturelle Bindung
durch ein gemeinsames Prinzip fehlt, — wie
in unserer Zeit. Man mache sich dies Mife-
verhältnis klar und verzichte von seifen des
Staates auf politische Eingriffe und von selten
der Künstler ... — nun, sie neigen ja gar
nicht zu Ein- und Übergriffen, — sie bringen
schon Opfer genug, wenn sie diese Zeit ge-
duldig überstehen! Der eigentliche Appell
richtet sich also an die Politiker und fordert
von ihnen Abkehr von der Vermischung und
Vermantschung von Politik und Kunst!
zösischer Künstler? Tausend analoge Fragen
drängen sich auf, deren Beantwortung im
Sinne Neu-Weimars eine so allgemeine Um-
wertung der Kunst und ihrer Geschichte zur
Folge haben müfefe, dafe man das Chaos nicht
abschäfeen kann, in welchem diese sonderbare
Methode völkischer Normierung enden würde.
Sicher ist nur, dafe sie eine vollkommene
Chaotik zur Folge haben müfefe. Nicht des-
halb, weil die Frage nach der ethnischen Her-
kunft Dürers uninteressant wäre. Sondern
deshalb, weil auf Grund politisierender
Völkerkunde Folgerungen auf einem Gebiet
gezogen werden sollen, das gerade der Politik
unzugänglich ist und von dieser Seite aus nur
auf Grund krasser Vergewaltigung betreten
werden kann. —
Das Weimarer Ereignis zeigt aber nur ein
Schattenbild von dem, was sich noch an kata-
strophalen Mifeverständnissen ereignen kann,
wenn weiterhin kunstfremde Mafestäbe an
Werke der Kunst gelegt werden. Denn auch
sonst ist die gleiche grundsäfeliche Tendenz
so vielfältig verbreitet, dafe man nur wünschen
kann, dafe endlich ihrer willkürlichen Ver-
mischung zweier so getrennter Gebiete, wie es
Politik und Kunst nun einmal heutzutage sind,
ein Ende bereitet werde. u, * *
Museen und fremde Kunst
Denn wohin sollten wir auch kommen, wenn
die neuen Weimarer Grundsäfee allgemeinere
Geltung erlangten? Wenn dort die verant-
wortliche Stelle, die nicht ein Kunsthistoriker,
sondern ein Politiker innehat, Künstler vom
hohen Rang eines Barlach, Kokoschka,
Kirchner, Marc, Lehmbruck usw. der mangeln-
den Ausprägung nordisch-deutschen Wesens
beschuldigt (vergl. „Weltkunst“, Nr. 50, S. 10),
so liegt doch darin die seltsame Behauptung,
dafe nur nordisch-deutsche Künstler be-
deutende Kunst schaffen könnten, — oder
aber das Zugeständnis eines beispiellosen
Willküraktes polizeilichen Charakters. Da man
das lefetere schwerlich wird aussprechen
wollen, so wird man sich schon zur ersten
Behauptung enfschliefeen müssen. Das aber
ist eine Auffassung, die für die kunsthistori-
sche Bewertung allerhand tragikomische
Folgerungen haben müfefe. Da gilt z. B. seit
geraumer Zeit Albrecht Dürer als ein be-
sonders deutscher Meister, und dafe er eine
wahrhaft grundlegende Stellung in der deut-
schen Kunstgeschichte einnimmt, kann nie-
mand bestreiten. Nun aber ist die neuere
Forschung auf dem Wege, diesen Meister als
einen Halb-Magyaren zu enthüllen, nämlich
seiner Abstammung nach, — also müßte er
nach dieser Auffassung als fremdstämmig
gelten. Können wir nicht demnächst zu hören
bekommen, daß deshalb seine Kunst durchaus
minderwertig sei? Wird man nicht in München
oder sonstwo gegebenenfalls dazu übergehen,
seine Gemälde zu magazinieren? Und wie
steht es mit der Gotik, dieser Schöpfung fran-
Erlauben Sie zu dem Artikel des Prof. Dr.
Jul. Baum in Nr. 48 der „Weltkunst“ über
„Museen und fremde Kunst“ in fol-
gendem Stellung zu nehmen:
Prof. Dr. Baum hat mit seinen Ausführun-
gen gewiß im allgemeinen recht, auch beson-
ders darin, dafe Museen keine Wohltätigkeits-
anstalten sind. Aber er macht keinen Unter-
schied zwischen den großen Museen der
Hauptstädte und den kleinen, meist städti-
schen, in der Provinz. Lefetere haben aber
ganz andere Aufgaben zu erfüllen als die
ersteren; sie sollen besonders in Städten mit
einer großen Vergangenheit in erster Linie
die alte heimatliche Kunst in weitem
Umfang und bester Qualität sammeln, erhal-
ten und würdig aufsfellen, und welche Menge
ist da noch vorhanden! Besucht man Würz-
burg, so will man dort fränkische Kunst sehen
und in Ulm schwäbische u. s. f.
Wenn man z. B. in Ulm einige Stunden die
Stadt angesehen hat und kommt ins Museum,
so will man eine ausgedehnte, gediegene
Sammlung alter Ulmer Kunst: Gemälde,
Plastik, Goldschmiedearbeifen, Waffen, Möbel
usw. vorfinden, aber nicht modernste und
fremdländische Kunst. Diese paßt nicht
in dieses Milieu, sie zerstört den Eindruck, den
die Stadt gemacht hat, nimmt einem die
Stimmung — zerstreut.
Die Provinzmuseen haben meist keine
großen Summen für Ankäufe zur Verfügung,
diese verwende man für die Hauptaufgabe
der betreffenden Sammlung. Wird das Geld
dieser Anstalten für solche nicht an die-
sen Ort g e h ö r i g e Kunst — mag sie so
gut sein, wie sie will — ausgegeben, so ist
keines mehr da, wenn ein gutes Stück alter
Heimatkunst angebofen wird. Dem Händler
wird dann gewöhnlich gesagt, man möchte
das Werk wohl für das Museum erwerben, die
Kasse sei aber leer — man könne allenfalls
lauschen — oder er müsse warten, bis man
in Jahr und Tag zahle. Gerade aber der
Händler braucht bar Geld, und so geht man-
ches hervorragende Kunstwerk hinaus, das
man sich für das Museum bei richtiger Er-
kenntnis seiner Aufgaben und richtiger Taktik
hätte sichern können, es wandert ins Aus-
land oder in Privatsammlungen. Man kann
erleben, daß innerhalb weniger Jahre Privat-
sammler sich glänzende Werke z. B. Ulmer
Kunst erwerben, welche die Lücken, die in
jenem Museum sind, hätten ausfüllen können
und die jedenfalls zu den besten Stücken
desselben zählen würden. Dafür fahren Leiter
solcher Museen später gelegentlich auf grofee
Auktionen von Privatsammlungen und kau-
fen um abnorme Summen Gegenstände, die
sie früher um einen Bruchteil hätten haben
können, wenn Geld vorhanden gewesen wäre.
Man liest, erfreut über den Eifer, diese
Herren seien auch dagewesen und hätten so-
gar das Glück gehabt, etwas zu erwerben!
Das Reisen wird immer leichter und durch
die Sonntagskarten auch billiger. Interessen-
ten in kleineren Städten können auch außer-
halb der Ferien sich in einer benachbarten
Großstadt neueste und fremdländische Kunst
ansehen. In den Provinzmuseen pflege man
aber die alte (evtl, auch neue) Heimatkunst
und bringe diese Sammlungen nach und nach
auf einen so hohen Grad der Entwicklung und
zu solcher Bedeutung, dafe sie das In- und
Ausland anziehen.
In der Beschränkung zeigt sich auch der
Museums-Meister.
W. Auberlen - München
Eine Erwiderung
Mein Aufsafe nahm allgemein zur Frage der
fremden Kunst in Museen Stellung und hat
daher den obenstehenden Angriff in keiner
Weise provoziert. Doch sei zu diesen Aus-
führungen, soweit sie sich mit U 1 m befassen,
folgendes bemerkt.
Das Museum einer kleineren Stadt ist vor
allem für die Einheimischen, dann erst für die
Fremden da. Die Lllmer insbesondere sind
keineswegs so rückständig, wie Herr Auberlen
ihnen unterstellt. Ulm hat heute eine lebendige
und aufstrebende Künstlerschaft, hinter der
eine grofee Gemeinde steht. Sowohl Künstler
wie Kunstfreunde wollen auf ein modernes
Museum in ihrer eigenen Stadt nicht ver-
zichten. Das Ulmer Museum kann gewiß nicht
über mangelhaften Besuch klagen. An Sonn-
tagen wird die Besucherziffer 800, selbst 1000
erreicht, für eine Stadt von 60 000 Einwohnern
eine beachtliche Zahl. Und viele kommen zum
stillen Schauen wieder. Von den Museums-
gästen wenden sich, wie wiederholte Zählungen
ergeben haben, der neuen Abteilung ver-
hältnismäßig mehr Besucher zu, als dem
übrigen Teil der Sammlungen. Von diesen
Besuchern ist noch nie eine Beschwerde an
die Leitung gelangt, dafe das Museum zu gut
oder zu modern oder zu fremdländisch sei;
im Gegenteil, kunstsinnige Einheimische und
Fremde freuen sich einhellig an dem hohen
Stand der kleinen modernen Abteilung. Vor
allem aber besteht keine Ursache, über Ver-
nachlässigung der bodenwüchsigen alemanni-
schen Kunst zu klagen. Die Leitung weife die
tüchtigen schwäbischen Künstler nichf nur im
Lande, sondern auch in Berlin und München
zu finden.
Wie will jemand, der für die Kunst der
Rembrandt van Rijn: Portrait eines Rabbiners, um 1635
Portrait d’un rabbin, vers 1635 — Portrait of a rabbi, about 1635
Holz — bois — panel, 61 : 58,8 cm — Collection Ambrose Monell — Kat. Nr. 59
Versteigerung — Vente — Sale:
American Art Association Anderson Galleries, New York, 28. November 1930
Brachte — adjuge — sold: 8 75 000
NAHE KAISERHOF
WIEN I
ALTE MEISTER
JOSEFEPLATZ5
(Palais Pallaviclni)
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN
BRING » LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Panis
Jahrg. IV, Nr. 51/52 vom 21. Dezember 1930
An unsere Ab onn ent en!
Das letzte Quartal 1930 läuft mit dieser Num-
mer ab. Wir bitten, die Abonnementsgebiihr für
das I. Quartal 1931 im Betrage von 4,50 RM
(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-
land), bzw. für das erste Halbjahr 9,— (resp.
11 RM) oder für das ganze Jahr 1931
RM 18,— (resp. RM 22,—) bis zum 6. Januar
1931 einzusenden. Wir werden uns andern-
falls erlauben, den Quartalsbetrag durch die
Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zählkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
von Angriff und Angriffsobjekt ist es, was zur
grundsäfelichen Überlegung auffordert, um die
ganze Tragweite der Weimarer Maßnahmen
zu erwägen.
Denn das Peinliche all dieser Ereignisse
und besonders des Vorgangs, der sich in
Weimar abspielte und der sich bei wachsender
Geltung jener politischen Richtung beliebig oft
wiederholen könnte, ist ja nicht nur dies, dafe
sich ein Machtwille gegen Menschen richtet,
die als Künstler schüfe- und wehrlos sind, —
die Gloriole des Märtyrertums ist für das An-
denken bei der Nachwelt durchaus bekömm-
lich! Das viel Schlimmere liegt darin, dafe sich
hier in breiter Front eine Kunstauffassung
durchzusefeen beginnt, die nicht nur kunst-
fremd, sondern in ihrer Konsequenz auch
kunstfeindlich ist. Es ist das alte Mißver-
ständnis des Zusammenhanges zwischen
Kunst und Politik, das sich hier verhängnis-
voll auswirkt. Denn alle jene beklagenswerten
Bewegungen vom George Grosz-Prozefe bis
Weimar sind ja nicht von Kunstkritikern an-
gekurbelt worden, sondern von Juristen und
Politikern, die kunstfremd sind.
Sicherlich besteht in vielen Zeitläuften ein
inniger Zusammenhang zwischen dem ge-
samten gesellschaftlichen Leben und der
Kunst. Weder den Mönch als Träger mittel-
alterlicher Geistigkeit, noch die Fürsten-
gestalten der Barockzeit mag der Historiker
missen, wenn er von der Kunst ihrer Epochen
spricht. Aber überall hat sich in Zeiten
starker Kunstentwicklung ein solcher Zu-
sammenhang, so lange und so bald er pro-
duktiven Charakter hatte, in ganz unmittel-
barer Weise kundgetan. Wenn der Maler
im Dienste der Kirche sich von der Feierlich-
keit des Kultus inspirieren liefe, — wenn der
Barockkünstler die grofee Geste der damaligen
Fürsten pathetisch unterstrich, so waren das
Auswirkungen der gleichen, gemeinsamen
Grundhaltung und Weltauffassung. Denn der
eigentliche Wurzelboden der Kunst ist das
Unbewufete und das Unwillkürliche ihrer Pro-
duktivität. — Politik dagegen ist — oder
sollte es doch sein — Angelegenheit der be-
wußten Willenskraft und nüchternen Ziel-
sefeung, — nichts ist hier gefährlicher, vom
politischen Standpunkt aus, als gefühls-
mäfeiger Überschwang. Umgekehrt verhält es
sich mit der Kunst: hier ist der Gefühlsimpuls
von eminenter Bedeutung und die Ratio mehr
eine Art Bremsvorrichtung. Sinnwidrig wäre
es, diese Sphäre von jener aus zu kontrol-
Kunst und Politik. Von***. . . . 1/2
Museen und fremde Kunst. Von W. Auber-
1 e n u. Prof. Dr. J. B a u m.2/3
Dr. F. Neugass (Paris):
Die neuesten Ausgrabungen in Vorderasien . 3
Der Sammler Otto Beit.3
Auktionsvorberichte.4
Auktionsnaehberiehte (m. 7 Abb.).4, 8
A u k t i o n s k a 1 e n d e r .5
Preisberichte — Kunst im Rundfunk.6
Ausstellungen der Woche — Literatur .... 7
Berichte aus Amerika (m. 3 Abb.) . . 9
Numismatisches.9
Die Expertise.
Beiträge zur Diskussion des Problems von
Hofrat Prof. Dr. H. T i e t z e.10
Dr. R. Heinemann-Fleischmann . 10
Neue Vermächtnisse für den Louvre (m. 2 Abb.) 10
G. Reinboth und L. Brosch:
Venezianische Kunstverkäufe.10/11
Dr. Grete Ring:
Milch contra Kunst.11
Der Schatz von Pompeji.11
Carl Einstein: Pariser Salons.12
Zollschikanen.12
K. K u b e r : Pariser Kleinkunsthandel ... 12
Slg. Martin in Faenza ..12
Die Sieneser Accademia.13
Hans Purrmann :
Walter Bondy zu seinem 50. Geburtstag
(m. 2 Abb.).13
Ausstellungen (m. Abb.).13
Dr. A. Heppner:
Spannung auf der Versteigerung.13
Nachrichten von überall — Unter Kollegen . . 14
Heren und vorsäfelich beeinflussen zu wollen.
Bei dieser Verschiedenartigkeit der Ein-
stellung ist es freilich begreiflich, dafe es zu
einer glatten Einigung nicht kommen kann, so
lange eine übergreifende kulturelle Bindung
durch ein gemeinsames Prinzip fehlt, — wie
in unserer Zeit. Man mache sich dies Mife-
verhältnis klar und verzichte von seifen des
Staates auf politische Eingriffe und von selten
der Künstler ... — nun, sie neigen ja gar
nicht zu Ein- und Übergriffen, — sie bringen
schon Opfer genug, wenn sie diese Zeit ge-
duldig überstehen! Der eigentliche Appell
richtet sich also an die Politiker und fordert
von ihnen Abkehr von der Vermischung und
Vermantschung von Politik und Kunst!
zösischer Künstler? Tausend analoge Fragen
drängen sich auf, deren Beantwortung im
Sinne Neu-Weimars eine so allgemeine Um-
wertung der Kunst und ihrer Geschichte zur
Folge haben müfefe, dafe man das Chaos nicht
abschäfeen kann, in welchem diese sonderbare
Methode völkischer Normierung enden würde.
Sicher ist nur, dafe sie eine vollkommene
Chaotik zur Folge haben müfefe. Nicht des-
halb, weil die Frage nach der ethnischen Her-
kunft Dürers uninteressant wäre. Sondern
deshalb, weil auf Grund politisierender
Völkerkunde Folgerungen auf einem Gebiet
gezogen werden sollen, das gerade der Politik
unzugänglich ist und von dieser Seite aus nur
auf Grund krasser Vergewaltigung betreten
werden kann. —
Das Weimarer Ereignis zeigt aber nur ein
Schattenbild von dem, was sich noch an kata-
strophalen Mifeverständnissen ereignen kann,
wenn weiterhin kunstfremde Mafestäbe an
Werke der Kunst gelegt werden. Denn auch
sonst ist die gleiche grundsäfeliche Tendenz
so vielfältig verbreitet, dafe man nur wünschen
kann, dafe endlich ihrer willkürlichen Ver-
mischung zweier so getrennter Gebiete, wie es
Politik und Kunst nun einmal heutzutage sind,
ein Ende bereitet werde. u, * *
Museen und fremde Kunst
Denn wohin sollten wir auch kommen, wenn
die neuen Weimarer Grundsäfee allgemeinere
Geltung erlangten? Wenn dort die verant-
wortliche Stelle, die nicht ein Kunsthistoriker,
sondern ein Politiker innehat, Künstler vom
hohen Rang eines Barlach, Kokoschka,
Kirchner, Marc, Lehmbruck usw. der mangeln-
den Ausprägung nordisch-deutschen Wesens
beschuldigt (vergl. „Weltkunst“, Nr. 50, S. 10),
so liegt doch darin die seltsame Behauptung,
dafe nur nordisch-deutsche Künstler be-
deutende Kunst schaffen könnten, — oder
aber das Zugeständnis eines beispiellosen
Willküraktes polizeilichen Charakters. Da man
das lefetere schwerlich wird aussprechen
wollen, so wird man sich schon zur ersten
Behauptung enfschliefeen müssen. Das aber
ist eine Auffassung, die für die kunsthistori-
sche Bewertung allerhand tragikomische
Folgerungen haben müfefe. Da gilt z. B. seit
geraumer Zeit Albrecht Dürer als ein be-
sonders deutscher Meister, und dafe er eine
wahrhaft grundlegende Stellung in der deut-
schen Kunstgeschichte einnimmt, kann nie-
mand bestreiten. Nun aber ist die neuere
Forschung auf dem Wege, diesen Meister als
einen Halb-Magyaren zu enthüllen, nämlich
seiner Abstammung nach, — also müßte er
nach dieser Auffassung als fremdstämmig
gelten. Können wir nicht demnächst zu hören
bekommen, daß deshalb seine Kunst durchaus
minderwertig sei? Wird man nicht in München
oder sonstwo gegebenenfalls dazu übergehen,
seine Gemälde zu magazinieren? Und wie
steht es mit der Gotik, dieser Schöpfung fran-
Erlauben Sie zu dem Artikel des Prof. Dr.
Jul. Baum in Nr. 48 der „Weltkunst“ über
„Museen und fremde Kunst“ in fol-
gendem Stellung zu nehmen:
Prof. Dr. Baum hat mit seinen Ausführun-
gen gewiß im allgemeinen recht, auch beson-
ders darin, dafe Museen keine Wohltätigkeits-
anstalten sind. Aber er macht keinen Unter-
schied zwischen den großen Museen der
Hauptstädte und den kleinen, meist städti-
schen, in der Provinz. Lefetere haben aber
ganz andere Aufgaben zu erfüllen als die
ersteren; sie sollen besonders in Städten mit
einer großen Vergangenheit in erster Linie
die alte heimatliche Kunst in weitem
Umfang und bester Qualität sammeln, erhal-
ten und würdig aufsfellen, und welche Menge
ist da noch vorhanden! Besucht man Würz-
burg, so will man dort fränkische Kunst sehen
und in Ulm schwäbische u. s. f.
Wenn man z. B. in Ulm einige Stunden die
Stadt angesehen hat und kommt ins Museum,
so will man eine ausgedehnte, gediegene
Sammlung alter Ulmer Kunst: Gemälde,
Plastik, Goldschmiedearbeifen, Waffen, Möbel
usw. vorfinden, aber nicht modernste und
fremdländische Kunst. Diese paßt nicht
in dieses Milieu, sie zerstört den Eindruck, den
die Stadt gemacht hat, nimmt einem die
Stimmung — zerstreut.
Die Provinzmuseen haben meist keine
großen Summen für Ankäufe zur Verfügung,
diese verwende man für die Hauptaufgabe
der betreffenden Sammlung. Wird das Geld
dieser Anstalten für solche nicht an die-
sen Ort g e h ö r i g e Kunst — mag sie so
gut sein, wie sie will — ausgegeben, so ist
keines mehr da, wenn ein gutes Stück alter
Heimatkunst angebofen wird. Dem Händler
wird dann gewöhnlich gesagt, man möchte
das Werk wohl für das Museum erwerben, die
Kasse sei aber leer — man könne allenfalls
lauschen — oder er müsse warten, bis man
in Jahr und Tag zahle. Gerade aber der
Händler braucht bar Geld, und so geht man-
ches hervorragende Kunstwerk hinaus, das
man sich für das Museum bei richtiger Er-
kenntnis seiner Aufgaben und richtiger Taktik
hätte sichern können, es wandert ins Aus-
land oder in Privatsammlungen. Man kann
erleben, daß innerhalb weniger Jahre Privat-
sammler sich glänzende Werke z. B. Ulmer
Kunst erwerben, welche die Lücken, die in
jenem Museum sind, hätten ausfüllen können
und die jedenfalls zu den besten Stücken
desselben zählen würden. Dafür fahren Leiter
solcher Museen später gelegentlich auf grofee
Auktionen von Privatsammlungen und kau-
fen um abnorme Summen Gegenstände, die
sie früher um einen Bruchteil hätten haben
können, wenn Geld vorhanden gewesen wäre.
Man liest, erfreut über den Eifer, diese
Herren seien auch dagewesen und hätten so-
gar das Glück gehabt, etwas zu erwerben!
Das Reisen wird immer leichter und durch
die Sonntagskarten auch billiger. Interessen-
ten in kleineren Städten können auch außer-
halb der Ferien sich in einer benachbarten
Großstadt neueste und fremdländische Kunst
ansehen. In den Provinzmuseen pflege man
aber die alte (evtl, auch neue) Heimatkunst
und bringe diese Sammlungen nach und nach
auf einen so hohen Grad der Entwicklung und
zu solcher Bedeutung, dafe sie das In- und
Ausland anziehen.
In der Beschränkung zeigt sich auch der
Museums-Meister.
W. Auberlen - München
Eine Erwiderung
Mein Aufsafe nahm allgemein zur Frage der
fremden Kunst in Museen Stellung und hat
daher den obenstehenden Angriff in keiner
Weise provoziert. Doch sei zu diesen Aus-
führungen, soweit sie sich mit U 1 m befassen,
folgendes bemerkt.
Das Museum einer kleineren Stadt ist vor
allem für die Einheimischen, dann erst für die
Fremden da. Die Lllmer insbesondere sind
keineswegs so rückständig, wie Herr Auberlen
ihnen unterstellt. Ulm hat heute eine lebendige
und aufstrebende Künstlerschaft, hinter der
eine grofee Gemeinde steht. Sowohl Künstler
wie Kunstfreunde wollen auf ein modernes
Museum in ihrer eigenen Stadt nicht ver-
zichten. Das Ulmer Museum kann gewiß nicht
über mangelhaften Besuch klagen. An Sonn-
tagen wird die Besucherziffer 800, selbst 1000
erreicht, für eine Stadt von 60 000 Einwohnern
eine beachtliche Zahl. Und viele kommen zum
stillen Schauen wieder. Von den Museums-
gästen wenden sich, wie wiederholte Zählungen
ergeben haben, der neuen Abteilung ver-
hältnismäßig mehr Besucher zu, als dem
übrigen Teil der Sammlungen. Von diesen
Besuchern ist noch nie eine Beschwerde an
die Leitung gelangt, dafe das Museum zu gut
oder zu modern oder zu fremdländisch sei;
im Gegenteil, kunstsinnige Einheimische und
Fremde freuen sich einhellig an dem hohen
Stand der kleinen modernen Abteilung. Vor
allem aber besteht keine Ursache, über Ver-
nachlässigung der bodenwüchsigen alemanni-
schen Kunst zu klagen. Die Leitung weife die
tüchtigen schwäbischen Künstler nichf nur im
Lande, sondern auch in Berlin und München
zu finden.
Wie will jemand, der für die Kunst der
Rembrandt van Rijn: Portrait eines Rabbiners, um 1635
Portrait d’un rabbin, vers 1635 — Portrait of a rabbi, about 1635
Holz — bois — panel, 61 : 58,8 cm — Collection Ambrose Monell — Kat. Nr. 59
Versteigerung — Vente — Sale:
American Art Association Anderson Galleries, New York, 28. November 1930
Brachte — adjuge — sold: 8 75 000
NAHE KAISERHOF
WIEN I
ALTE MEISTER
JOSEFEPLATZ5
(Palais Pallaviclni)
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8 ANTIQUITÄTEN
BRING » LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Panis