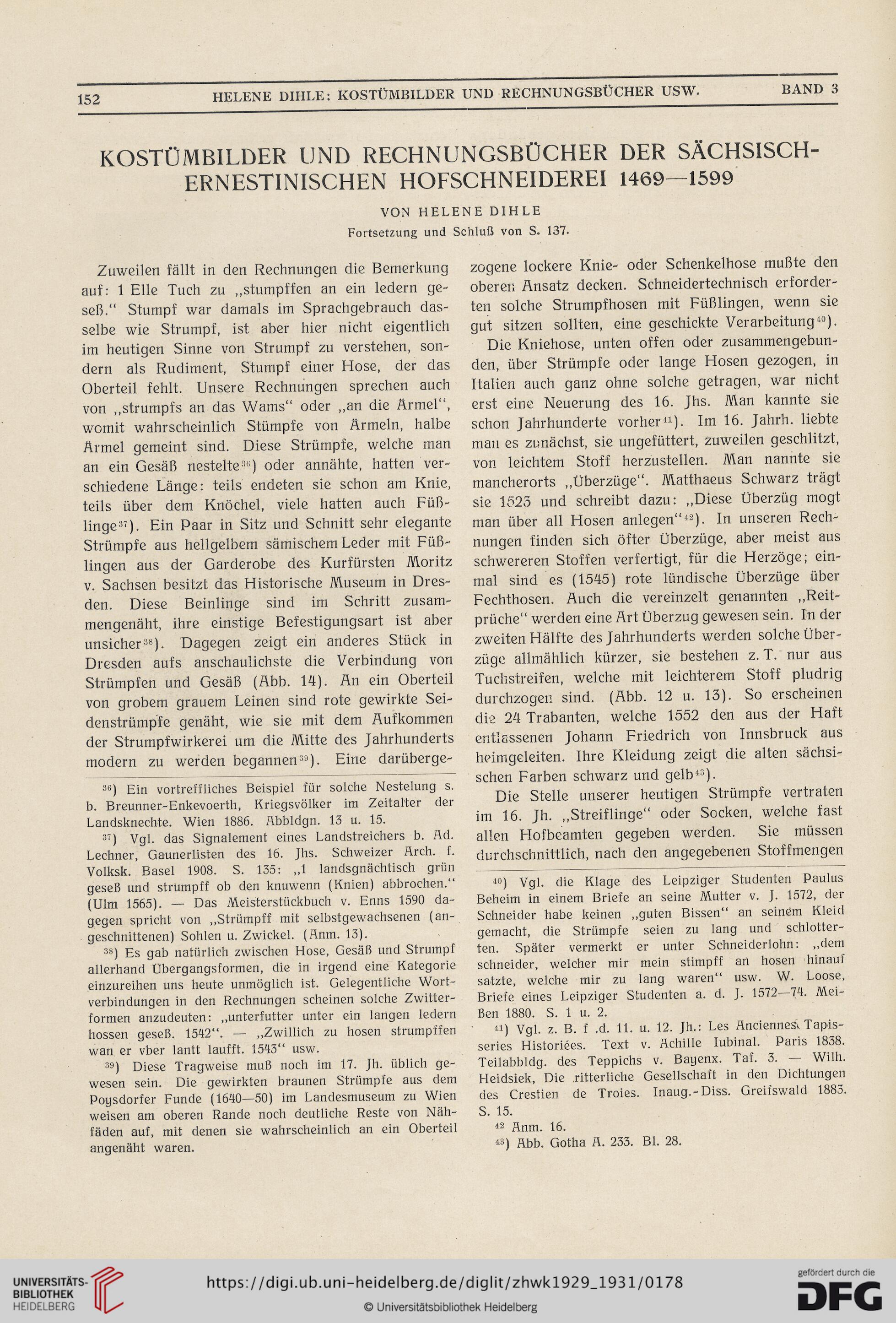152
HELENE DIHLE: KOSTÜMBILDER UND RECHNUNGSBÜCHER USW.
BAND 3
KOSTÜMBILDER UND RECHNUNGSBÜCHER DER SÄCHSISCH-
ERNESTINISCHEN HOFSCHNEIDEREI 1469—1599
VON HELENE DIHLE
Fortsetzung und Schluß von S. 137.
Zuweilen fällt in den Rechnungen die Bemerkung
auf: 1 Elle Tuch zu „stumpffen an ein ledern ge-
seß.“ Stumpf war damals im Sprachgebrauch das-
selbe wie Strumpf, ist aber hier nicht eigentlich
im heutigen Sinne von Strumpf zu verstehen, son-
dern als Rudiment, Stumpf einer Hose, der das
Oberteil fehlt. Unsere Rechnungen sprechen auch
von „Strumpfs an das Wams“ oder „an die Ärmel“,
womit wahrscheinlich Stümpfe von Ärmeln, halbe
Ärmel gemeint sind. Diese Strümpfe, welche man
an ein Gesäß nestelte16) oder annähte, hatten ver-
schiedene Länge: teils endeten sie schon am Knie,
teils über dem Knöchel, viele hatten auch Füß-
linge* * * 37). Ein Paar in Sitz und Schnitt sehr elegante
Strümpfe aus hellgelbem samischem Leder mit Füß-
lingen aus der Garderobe des Kurfürsten Moritz
v. Sachsen besitzt das Historische Museum in Dres-
den. Diese Beinlinge sind im Schritt zusam-
mengenäht, ihre einstige Befestigungsart ist aber
unsicher38). Dagegen zeigt ein anderes Stück in
Dresden aufs anschaulichste die Verbindung von
Strümpfen und Gesäß (Abb. 14). An ein Oberteil
von grobem grauem Leinen sind rote gewirkte Sei-
denstrümpfe genäht, wie sie mit dem Aufkommen
der Strumpfwirkerei um die Mitte des Jahrhunderts
modern zu werden begannen39 30). Eine darüberge-
3e) Ein vortreffliches Beispiel für solche Nestelung s.
b. Breunner-Enkevoerth, Kriegsvölker im Zeitalter der
Landsknechte. Wien 1886. Äbbldgn. 13 u. 15.
37) Vgl. das Signalement eines Landstreichers b. Ad.
Lechner, Gaunerlisten des 16. Jhs. Schweizer Arch. f.
Volksk. Basel 1908. S. 135: „1 iandsgnächtisch grün
geseß und strumpff ob den knuwenn (Knien) abbrochen.“
(Ulm 1565). — Das Meisterstückbuch v. Enns 1590 da-
gegen spricht von „Strümpff mit selbstgewachsenen (an-
geschnittenen) Sohlen u. Zwickel. (Anm. 13).
38) Es gab natürlich zwischen Hose, Gesäß und Strumpf
allerhand Übergangsformen, die in irgend eine Kategorie
einzureihen uns heute unmöglich ist. Gelegentliche Wort-
verbindungen in den Rechnungen scheinen solche Zwitter-
formen anzudeuten: „unterfutter unter ein langen ledern
hossen geseß. 1542“. — „Zwillich zu hosen strumpffen
wan er vber lantt laufft. 1543“ usw.
39) Diese Tragweise muß noch im 17. Jh. üblich ge-
wesen sein. Die gewirkten braunen Strümpfe aus dem
Poysdorfer Funde (1640—50) im Landesmuseum zu Wien
weisen am oberen Rande noch deutliche Reste von Näh-
fäden auf, mit denen sie wahrscheinlich an ein Oberteil
angenäht waren.
zogene lockere Knie- oder Schenkelhose mußte den
oberen Ansatz decken. Schneidertechnisch erforder-
ten solche Strumpfhosen mit Füßlingen, wenn sie
gut sitzen sollten, eine geschickte Verarbeitung10).
Die Kniehose, unten offen oder zusammengebun-
den, über Strümpfe oder lange Hosen gezogen, in
Italien auch ganz ohne solche getragen, war nicht
erst eine Neuerung des 16. Jhs. Man kannte sie
schon Jahrhunderte vorher31)- Im 16- Jahrh. liebte
man es zunächst, sie ungefüttert, zuweilen geschlitzt,
von leichtem Stoff herzustellen. Man nannte sie
mancherorts „Überzüge“. Matthaeus Schwarz trägt
sie 1525 und schreibt dazu: „Diese Überzüg mögt
man über all Hosen anlegen“32). In unseren Rech-
nungen finden sich öfter Überzüge, aber meist aus
schwereren Stoffen verfertigt, für die Herzöge; ein-
mal sind es (1545) rote lündische Überzüge über
Fechthosen. Auch die vereinzelt genannten „Reit-
prüche“ werden eine Art Überzug gewesen sein. In der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden solche Über-
züge allmählich kürzer, sie bestehen z. T. nur aus
Tuchstreifen, welche mit leichterem Stoff pludrig
durchzogen sind. (Abb. 12 u. 13). So erscheinen
die 24 Trabanten, welche 1552 den aus der Haft
entlassenen Johann Friedrich von Innsbruck aus
heimgeleiten. Ihre Kleidung zeigt die alten sächsi-
schen Farben schwarz und gelb33).
Die Stelle unserer heutigen Strümpfe vertraten
im 16. Jh. „Streiflinge“ oder Socken, welche fast
allen Hofbeamten gegeben werden. Sie müssen
durchschnittlich, nach den angegebenen Stoffmengen
30) Vgl. die Klage des Leipziger Studenten Paulus
Beheim in einem Briefe an seine Mutter v. J. 1572, der
Schneider habe keinen „guten Bissen“ an seinem Kleid
gemacht, die Strümpfe seien zu lang und schlotter-
ten. Später vermerkt er unter Schneiderlohn: „dem
Schneider, welcher mir mein stimpff an hosen hinauf
salzte, welche mir zu lang waren“ usw. W. Loose,
Briefe eines Leipziger Studenten a. d. J. 1572—74. Mei-
ßen 1880. S. 1 u. 2.
31) Vgl. z. B. f .d. 11. u. 12. Jh.: Les Anciennesl. Tapis-
series Historiees. Text v. Achille lubinal. Paris 1838.
Teilabbldg. des Teppichs v. Bayenx. Taf. 3. — Willi.
Heidsiek, Die ritterliche Gesellschaft in den Dichtungen
des Crestien de Troies. Inaug.-Diss. Greifswald 1883.
S. 15.
32 Anm. 16.
33) Abb. Gotha A. 233. Bl. 28.
HELENE DIHLE: KOSTÜMBILDER UND RECHNUNGSBÜCHER USW.
BAND 3
KOSTÜMBILDER UND RECHNUNGSBÜCHER DER SÄCHSISCH-
ERNESTINISCHEN HOFSCHNEIDEREI 1469—1599
VON HELENE DIHLE
Fortsetzung und Schluß von S. 137.
Zuweilen fällt in den Rechnungen die Bemerkung
auf: 1 Elle Tuch zu „stumpffen an ein ledern ge-
seß.“ Stumpf war damals im Sprachgebrauch das-
selbe wie Strumpf, ist aber hier nicht eigentlich
im heutigen Sinne von Strumpf zu verstehen, son-
dern als Rudiment, Stumpf einer Hose, der das
Oberteil fehlt. Unsere Rechnungen sprechen auch
von „Strumpfs an das Wams“ oder „an die Ärmel“,
womit wahrscheinlich Stümpfe von Ärmeln, halbe
Ärmel gemeint sind. Diese Strümpfe, welche man
an ein Gesäß nestelte16) oder annähte, hatten ver-
schiedene Länge: teils endeten sie schon am Knie,
teils über dem Knöchel, viele hatten auch Füß-
linge* * * 37). Ein Paar in Sitz und Schnitt sehr elegante
Strümpfe aus hellgelbem samischem Leder mit Füß-
lingen aus der Garderobe des Kurfürsten Moritz
v. Sachsen besitzt das Historische Museum in Dres-
den. Diese Beinlinge sind im Schritt zusam-
mengenäht, ihre einstige Befestigungsart ist aber
unsicher38). Dagegen zeigt ein anderes Stück in
Dresden aufs anschaulichste die Verbindung von
Strümpfen und Gesäß (Abb. 14). An ein Oberteil
von grobem grauem Leinen sind rote gewirkte Sei-
denstrümpfe genäht, wie sie mit dem Aufkommen
der Strumpfwirkerei um die Mitte des Jahrhunderts
modern zu werden begannen39 30). Eine darüberge-
3e) Ein vortreffliches Beispiel für solche Nestelung s.
b. Breunner-Enkevoerth, Kriegsvölker im Zeitalter der
Landsknechte. Wien 1886. Äbbldgn. 13 u. 15.
37) Vgl. das Signalement eines Landstreichers b. Ad.
Lechner, Gaunerlisten des 16. Jhs. Schweizer Arch. f.
Volksk. Basel 1908. S. 135: „1 iandsgnächtisch grün
geseß und strumpff ob den knuwenn (Knien) abbrochen.“
(Ulm 1565). — Das Meisterstückbuch v. Enns 1590 da-
gegen spricht von „Strümpff mit selbstgewachsenen (an-
geschnittenen) Sohlen u. Zwickel. (Anm. 13).
38) Es gab natürlich zwischen Hose, Gesäß und Strumpf
allerhand Übergangsformen, die in irgend eine Kategorie
einzureihen uns heute unmöglich ist. Gelegentliche Wort-
verbindungen in den Rechnungen scheinen solche Zwitter-
formen anzudeuten: „unterfutter unter ein langen ledern
hossen geseß. 1542“. — „Zwillich zu hosen strumpffen
wan er vber lantt laufft. 1543“ usw.
39) Diese Tragweise muß noch im 17. Jh. üblich ge-
wesen sein. Die gewirkten braunen Strümpfe aus dem
Poysdorfer Funde (1640—50) im Landesmuseum zu Wien
weisen am oberen Rande noch deutliche Reste von Näh-
fäden auf, mit denen sie wahrscheinlich an ein Oberteil
angenäht waren.
zogene lockere Knie- oder Schenkelhose mußte den
oberen Ansatz decken. Schneidertechnisch erforder-
ten solche Strumpfhosen mit Füßlingen, wenn sie
gut sitzen sollten, eine geschickte Verarbeitung10).
Die Kniehose, unten offen oder zusammengebun-
den, über Strümpfe oder lange Hosen gezogen, in
Italien auch ganz ohne solche getragen, war nicht
erst eine Neuerung des 16. Jhs. Man kannte sie
schon Jahrhunderte vorher31)- Im 16- Jahrh. liebte
man es zunächst, sie ungefüttert, zuweilen geschlitzt,
von leichtem Stoff herzustellen. Man nannte sie
mancherorts „Überzüge“. Matthaeus Schwarz trägt
sie 1525 und schreibt dazu: „Diese Überzüg mögt
man über all Hosen anlegen“32). In unseren Rech-
nungen finden sich öfter Überzüge, aber meist aus
schwereren Stoffen verfertigt, für die Herzöge; ein-
mal sind es (1545) rote lündische Überzüge über
Fechthosen. Auch die vereinzelt genannten „Reit-
prüche“ werden eine Art Überzug gewesen sein. In der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts werden solche Über-
züge allmählich kürzer, sie bestehen z. T. nur aus
Tuchstreifen, welche mit leichterem Stoff pludrig
durchzogen sind. (Abb. 12 u. 13). So erscheinen
die 24 Trabanten, welche 1552 den aus der Haft
entlassenen Johann Friedrich von Innsbruck aus
heimgeleiten. Ihre Kleidung zeigt die alten sächsi-
schen Farben schwarz und gelb33).
Die Stelle unserer heutigen Strümpfe vertraten
im 16. Jh. „Streiflinge“ oder Socken, welche fast
allen Hofbeamten gegeben werden. Sie müssen
durchschnittlich, nach den angegebenen Stoffmengen
30) Vgl. die Klage des Leipziger Studenten Paulus
Beheim in einem Briefe an seine Mutter v. J. 1572, der
Schneider habe keinen „guten Bissen“ an seinem Kleid
gemacht, die Strümpfe seien zu lang und schlotter-
ten. Später vermerkt er unter Schneiderlohn: „dem
Schneider, welcher mir mein stimpff an hosen hinauf
salzte, welche mir zu lang waren“ usw. W. Loose,
Briefe eines Leipziger Studenten a. d. J. 1572—74. Mei-
ßen 1880. S. 1 u. 2.
31) Vgl. z. B. f .d. 11. u. 12. Jh.: Les Anciennesl. Tapis-
series Historiees. Text v. Achille lubinal. Paris 1838.
Teilabbldg. des Teppichs v. Bayenx. Taf. 3. — Willi.
Heidsiek, Die ritterliche Gesellschaft in den Dichtungen
des Crestien de Troies. Inaug.-Diss. Greifswald 1883.
S. 15.
32 Anm. 16.
33) Abb. Gotha A. 233. Bl. 28.