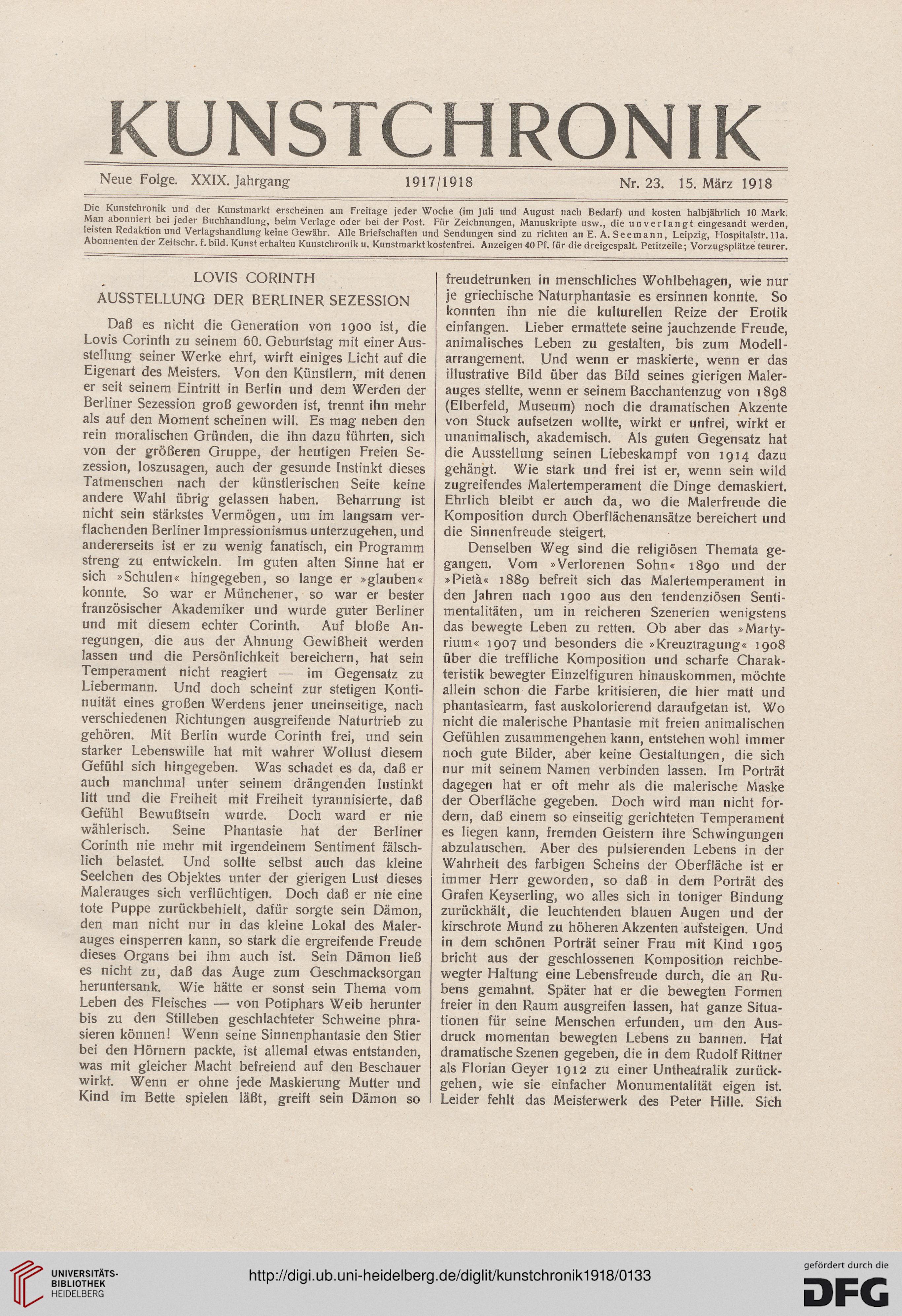KUNSTCHRONIK
Neue Folge. XXIX. Jahrgang 1917/1918 Nr. 23. 15. März 1918
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 10 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschr. f. bild. Kunst erhalten Kunstchronik u. Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 40 Pf. für die dreigespalt. Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
LOVIS CORINTH
AUSSTELLUNG DER BERLINER SEZESSION
Daß es nicht die Generation von 1900 ist, die
Lovis Corinth zu seinem 60. Geburtstag mit einer Aus-
stellung seiner Werke ehrt, wirft einiges Licht auf die
Eigenart des Meisters. Von den Künstlern, mit denen
er seit seinem Eintritt in Berlin und dem Werden der
Berliner Sezession groß geworden ist, trennt ihn mehr
als auf den Moment scheinen will. Es mag neben den
rein moralischen Gründen, die ihn dazu führten, sich
von der größeren Gruppe, der heutigen Freien Se-
zession, loszusagen, auch der gesunde Instinkt dieses
Tatmenschen nach der künstlerischen Seite keine
andere Wahl übrig gelassen haben. Beharrung ist
nicht sein stärkstes Vermögen, um im langsam ver-
flachenden Berliner Impressionismus unterzugehen, und
andererseits ist er zu wenig fanatisch, ein Programm
streng zu entwickeln. Im guten alten Sinne hat er
sich »Schulen« hingegeben, so lange er »glauben«
konnte. So war er Münchener, so war er bester
französischer Akademiker und wurde guter Berliner
und mit diesem echter Corinth. Auf bloße An-
regungen, die aus der Ahnung Gewißheit werden
lassen und die Persönlichkeit bereichern, hat sein
Temperament nicht reagiert — im Gegensatz zu
Liebermann. Und doch scheint zur stetigen Konti-
nuität eines großen Werdens jener uneinseitige, nach
verschiedenen Richtungen ausgreifende Naturtrieb zu
gehören. Mit Berlin wurde Corinth frei, und sein
starker Lebenswille hat mit wahrer Wollust diesem
Gefühl sich hingegeben. Was schadet es da, daß er
auch manchmal unter seinem drängenden Instinkt
litt und die Freiheit mit Freiheit tyrannisierte, daß
Gefühl Bewußtsein wurde. Doch ward er nie
wählerisch. Seine Phantasie hat der Berliner
Corinth nie mehr mit irgendeinem Sentiment fälsch-
lich belastet. Und sollte selbst auch das kleine
Seelchen des Objektes unter der gierigen Lust dieses
Malerauges sich verflüchtigen. Doch daß er nie eine
tote Puppe zurückbehielt, dafür sorgte sein Dämon,
den man nicht nur in das kleine Lokal des Maler-
auges einsperren kann, so stark die ergreifende Freude
dieses Organs bei ihm auch ist. Sein Dämon ließ
es nicht zu, daß das Auge zum Geschmacksorgan
heruntersank. Wie hätte er sonst sein Thema vom
Leben des Fleisches — von Potiphars Weib herunter
bis zu den Stilleben geschlachteter Schweine phra-
sieren können! Wenn seine Sinnenphantasie den Stier
bei den Hörnern packte, ist allemal etwas entstanden,
was mit gleicher Macht befreiend auf den Beschauer
wirkt. Wenn er ohne jede Maskierung Mutter und
Kind im Bette spielen läßt, greift sein Dämon so
freudetrunken in menschliches Wohlbehagen, wie nur
je griechische Naturphantasie es ersinnen konnte. So
konnten ihn nie die kulturellen Reize der Erotik
einfangen. Lieber ermattete seine jauchzende Freude,
animalisches Leben zu gestalten, bis zum Modell-
arrangement. Und wenn er maskierte, wenn er das
illustrative Bild über das Bild seines gierigen Maler-
auges stellte, wenn er seinem Bacchantenzug von 1898
(Elberfeld, Museum) noch die dramatischen Akzente
von Stuck aufsetzen wollte, wirkt er unfrei, wirkt ei
unanimalisch, akademisch. Als guten Gegensatz hat
die Ausstellung seinen Liebeskampf von 1914 dazu
gehängt. Wie stark und frei ist er, wenn sein wild
zugreifendes Malertemperament die Dinge demaskiert.
Ehrlich bleibt er auch da, wo die Malerfreude die
Komposition durch Oberflächenansätze bereichert und
die Sinnenfreude steigert.
Denselben Weg sind die religiösen Themata ge-
gangen. Vom »Verlorenen Sohn« 1890 und der
»Pietä« 1889 befreit sich das Malertemperament in
den Jahren nach 1900 aus den tendenziösen Senti-
mentalitäten, um in reicheren Szenerien wenigstens
das bewegte Leben zu retten. Ob aber das »Marty-
rium« 1907 und besonders die »Kreuztragung« 1908
über die treffliche Komposition und scharfe Charak-
teristik bewegter Einzelfiguren hinauskommen, möchte
allein schon die Farbe kritisieren, die hier matt und
phantasiearm, fast auskolorierend daraufgetan ist. Wo
nicht die malerische Phantasie mit freien animalischen
Gefühlen zusammengehen kann, entstehen wohl immer
noch gute Bilder, aber keine Gestaltungen, die sich
nur mit seinem Namen verbinden lassen. Im Porträt
dagegen hat er oft mehr als die malerische Maske
der Oberfläche gegeben. Doch wird man nicht for-
dern, daß einem so einseitig gerichteten Temperament
es liegen kann, fremden Geistern ihre Schwingungen
abzulauschen. Aber des pulsierenden Lebens in der
Wahrheit des farbigen Scheins der Oberfläche ist er
immer Herr geworden, so daß in dem Porträt des
Grafen Keyserling, wo alles sich in toniger Bindung
zurückhält, die leuchtenden blauen Augen und der
kirschrote Mund zu höheren Akzenten aufsteigen. Und
in dem schönen Porträt seiner Frau mit Kind 1905
bricht aus der geschlossenen Komposition reichbe-
wegter Haltung eine Lebensfreude durch, die an Ru-
bens gemahnt. Später hat er die bewegten Formen
freier in den Raum ausgreifen lassen, hat ganze Situa-
tionen für seine Menschen erfunden, um den Aus-
druck momentan bewegten Lebens zu bannen. Hat
dramatische Szenen gegeben, die in dem Rudolf Rittner
als Florian Geyer 1912 zu einer Untheairalik zurück-
gehen, wie sie einfacher Monumentalität eigen ist.
Leider fehlt das Meisterwerk des Peter Hille. Sich
Neue Folge. XXIX. Jahrgang 1917/1918 Nr. 23. 15. März 1918
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 10 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden,
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. IIa.
Abonnenten der Zeitschr. f. bild. Kunst erhalten Kunstchronik u. Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 40 Pf. für die dreigespalt. Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
LOVIS CORINTH
AUSSTELLUNG DER BERLINER SEZESSION
Daß es nicht die Generation von 1900 ist, die
Lovis Corinth zu seinem 60. Geburtstag mit einer Aus-
stellung seiner Werke ehrt, wirft einiges Licht auf die
Eigenart des Meisters. Von den Künstlern, mit denen
er seit seinem Eintritt in Berlin und dem Werden der
Berliner Sezession groß geworden ist, trennt ihn mehr
als auf den Moment scheinen will. Es mag neben den
rein moralischen Gründen, die ihn dazu führten, sich
von der größeren Gruppe, der heutigen Freien Se-
zession, loszusagen, auch der gesunde Instinkt dieses
Tatmenschen nach der künstlerischen Seite keine
andere Wahl übrig gelassen haben. Beharrung ist
nicht sein stärkstes Vermögen, um im langsam ver-
flachenden Berliner Impressionismus unterzugehen, und
andererseits ist er zu wenig fanatisch, ein Programm
streng zu entwickeln. Im guten alten Sinne hat er
sich »Schulen« hingegeben, so lange er »glauben«
konnte. So war er Münchener, so war er bester
französischer Akademiker und wurde guter Berliner
und mit diesem echter Corinth. Auf bloße An-
regungen, die aus der Ahnung Gewißheit werden
lassen und die Persönlichkeit bereichern, hat sein
Temperament nicht reagiert — im Gegensatz zu
Liebermann. Und doch scheint zur stetigen Konti-
nuität eines großen Werdens jener uneinseitige, nach
verschiedenen Richtungen ausgreifende Naturtrieb zu
gehören. Mit Berlin wurde Corinth frei, und sein
starker Lebenswille hat mit wahrer Wollust diesem
Gefühl sich hingegeben. Was schadet es da, daß er
auch manchmal unter seinem drängenden Instinkt
litt und die Freiheit mit Freiheit tyrannisierte, daß
Gefühl Bewußtsein wurde. Doch ward er nie
wählerisch. Seine Phantasie hat der Berliner
Corinth nie mehr mit irgendeinem Sentiment fälsch-
lich belastet. Und sollte selbst auch das kleine
Seelchen des Objektes unter der gierigen Lust dieses
Malerauges sich verflüchtigen. Doch daß er nie eine
tote Puppe zurückbehielt, dafür sorgte sein Dämon,
den man nicht nur in das kleine Lokal des Maler-
auges einsperren kann, so stark die ergreifende Freude
dieses Organs bei ihm auch ist. Sein Dämon ließ
es nicht zu, daß das Auge zum Geschmacksorgan
heruntersank. Wie hätte er sonst sein Thema vom
Leben des Fleisches — von Potiphars Weib herunter
bis zu den Stilleben geschlachteter Schweine phra-
sieren können! Wenn seine Sinnenphantasie den Stier
bei den Hörnern packte, ist allemal etwas entstanden,
was mit gleicher Macht befreiend auf den Beschauer
wirkt. Wenn er ohne jede Maskierung Mutter und
Kind im Bette spielen läßt, greift sein Dämon so
freudetrunken in menschliches Wohlbehagen, wie nur
je griechische Naturphantasie es ersinnen konnte. So
konnten ihn nie die kulturellen Reize der Erotik
einfangen. Lieber ermattete seine jauchzende Freude,
animalisches Leben zu gestalten, bis zum Modell-
arrangement. Und wenn er maskierte, wenn er das
illustrative Bild über das Bild seines gierigen Maler-
auges stellte, wenn er seinem Bacchantenzug von 1898
(Elberfeld, Museum) noch die dramatischen Akzente
von Stuck aufsetzen wollte, wirkt er unfrei, wirkt ei
unanimalisch, akademisch. Als guten Gegensatz hat
die Ausstellung seinen Liebeskampf von 1914 dazu
gehängt. Wie stark und frei ist er, wenn sein wild
zugreifendes Malertemperament die Dinge demaskiert.
Ehrlich bleibt er auch da, wo die Malerfreude die
Komposition durch Oberflächenansätze bereichert und
die Sinnenfreude steigert.
Denselben Weg sind die religiösen Themata ge-
gangen. Vom »Verlorenen Sohn« 1890 und der
»Pietä« 1889 befreit sich das Malertemperament in
den Jahren nach 1900 aus den tendenziösen Senti-
mentalitäten, um in reicheren Szenerien wenigstens
das bewegte Leben zu retten. Ob aber das »Marty-
rium« 1907 und besonders die »Kreuztragung« 1908
über die treffliche Komposition und scharfe Charak-
teristik bewegter Einzelfiguren hinauskommen, möchte
allein schon die Farbe kritisieren, die hier matt und
phantasiearm, fast auskolorierend daraufgetan ist. Wo
nicht die malerische Phantasie mit freien animalischen
Gefühlen zusammengehen kann, entstehen wohl immer
noch gute Bilder, aber keine Gestaltungen, die sich
nur mit seinem Namen verbinden lassen. Im Porträt
dagegen hat er oft mehr als die malerische Maske
der Oberfläche gegeben. Doch wird man nicht for-
dern, daß einem so einseitig gerichteten Temperament
es liegen kann, fremden Geistern ihre Schwingungen
abzulauschen. Aber des pulsierenden Lebens in der
Wahrheit des farbigen Scheins der Oberfläche ist er
immer Herr geworden, so daß in dem Porträt des
Grafen Keyserling, wo alles sich in toniger Bindung
zurückhält, die leuchtenden blauen Augen und der
kirschrote Mund zu höheren Akzenten aufsteigen. Und
in dem schönen Porträt seiner Frau mit Kind 1905
bricht aus der geschlossenen Komposition reichbe-
wegter Haltung eine Lebensfreude durch, die an Ru-
bens gemahnt. Später hat er die bewegten Formen
freier in den Raum ausgreifen lassen, hat ganze Situa-
tionen für seine Menschen erfunden, um den Aus-
druck momentan bewegten Lebens zu bannen. Hat
dramatische Szenen gegeben, die in dem Rudolf Rittner
als Florian Geyer 1912 zu einer Untheairalik zurück-
gehen, wie sie einfacher Monumentalität eigen ist.
Leider fehlt das Meisterwerk des Peter Hille. Sich