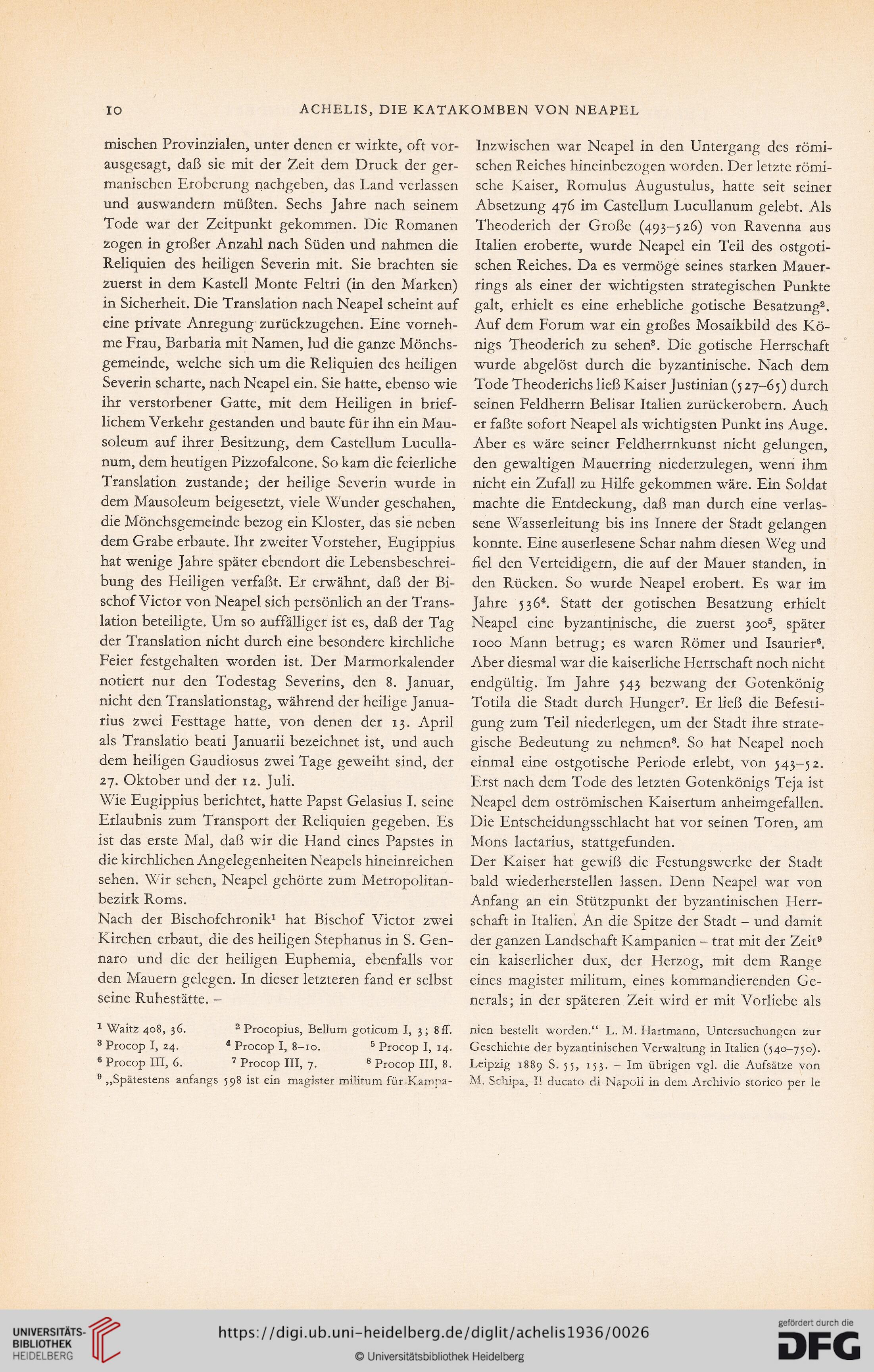10
ACHELIS, DIE KATAKOMBEN VON NEAPEL
mischen Provinzialen, unter denen er wirkte, oft vor-
ausgesagt, daß sie mit der Zeit dem Druck der ger-
manischen Eroberung nachgeben, das Land verlassen
und auswandern müßten. Sechs Jahre nach seinem
Tode war der Zeitpunkt gekommen. Die Romanen
zogen in großer Anzahl nach Süden und nahmen die
Reliquien des heiligen Severin mit. Sie brachten sie
zuerst in dem Kastell Monte Feltri (in den Marken)
in Sicherheit. Die Translation nach Neapel scheint auf
eine private Anregung zurückzugehen. Eine vorneh-
me Frau, Barbaria mit Namen, lud die ganze Mönchs-
gemeinde, welche sich um die Reliquien des heiligen
Severin scharte, nach Neapel ein. Sie hatte, ebenso wie
ihr verstorbener Gatte, mit dem Heiligen in brief-
lichem Verkehr gestanden und baute für ihn ein Mau-
soleum auf ihrer Besitzung, dem Casteilum Luculla-
num, dem heutigen Pizzofalcone. So kam die feierliche
Translation zustande; der heilige Severin wurde in
dem Mausoleum beigesetzt, viele Wunder geschahen,
die Mönchsgemeinde bezog ein Kloster, das sie neben
dem Grabe erbaute. Ihr zweiter Vorsteher, Eugippius
hat wenige Jahre später ebendort die Lebensbeschrei-
bung des Heiligen verfaßt. Er erwähnt, daß der Bi-
schof Victor von Neapel sich persönlich an der Trans-
lation beteiligte. Um so auffälliger ist es, daß der Tag
der Translation nicht durch eine besondere kirchliche
Feier festgehalten worden ist. Der Marmorkalender
notiert nur den Todestag Severins, den 8. Januar,
nicht den Translationstag, während der heilige Janua-
rius zwei Festtage hatte, von denen der 13. April
als Translatio beati Januarii bezeichnet ist, und auch
dem heiligen Gaudiosus zwei Tage geweiht sind, der
27. Oktober und der 12. Juli.
Wie Eugippius berichtet, hatte Papst Gelasius I. seine
Erlaubnis zum Transport der Reliquien gegeben. Es
ist das erste Mal, daß wir die Hand eines Papstes in
die kirchlichen Angelegenheiten Neapels hineinreichen
sehen. Wir sehen, Neapel gehörte zum Metropolitan-
bezirk Roms.
Nach der Bischofchronik1 hat Bischof Victor zwei
Kirchen erbaut, die des heiligen Stephanus in S. Gen-
naro und die der heiligen Euphemia, ebenfalls vor
den Mauern gelegen. In dieser letzteren fand er selbst
seine Ruhestätte. -
Inzwischen war Neapel in den Untergang des römi-
schen Reiches hineinbezogen worden. Der letzte römi-
sche Kaiser, Romulus Augustulus, hatte seit seiner
Absetzung 476 im Castellum Lucullanum gelebt. Als
Theoderich der Große (493-526) von Ravenna aus
Italien eroberte, wurde Neapel ein Teil des ostgoti-
schen Reiches. Da es vermöge seines starken Mauer-
rings als einer der wichtigsten strategischen Punkte
galt, erhielt es eine erhebliche gotische Besatzung2.
Auf dem Forum war ein großes Mosaikbild des Kö-
nigs Theoderich zu sehen3. Die gotische Herrschaft
wurde abgelöst durch die byzantinische. Nach dem
Tode Theoderichs ließ Kaiser Justinian (5 27-65) durch
seinen Feldherrn Beiisar Italien zurückerobern. Auch
er faßte sofort Neapel als wichtigsten Punkt ins Auge.
Aber es wäre seiner Feldherrnkunst nicht gelungen,
den gewaltigen Mauerring niederzulegen, wenn ihm
nicht ein Zufall zu Hilfe gekommen wäre. Ein Soldat
machte die Entdeckung, daß man durch eine verlas-
sene Wasserleitung bis ins Innere der Stadt gelangen
konnte. Eine auserlesene Schar nahm diesen Weg und
fiel den Verteidigern, die auf der Mauer standen, in
den Rücken. So wurde Neapel erobert. Es war im
Jahre 536*. Statt der gotischen Besatzung erhielt
Neapel eine byzantinische, die zuerst 3006, später
1000 Mann betrug; es waren Römer und Isaurier6.
Aber diesmal war die kaiserliche Herrschaft noch nicht
endgültig. Im Jahre 543 bezwang der Gotenkönig
Totila die Stadt durch Hunger7. Er ließ die Befesti-
gung zum Teil niederlegen, um der Stadt ihre strate-
gische Bedeutung zu nehmen8. So hat Neapel noch
einmal eine ostgotische Periode erlebt, von 543-52.
Erst nach dem Tode des letzten Gotenkönigs Teja ist
Neapel dem oströmischen Kaisertum anheimgefallen.
Die Entscheidungsschlacht hat vor seinen Toren, am
Mons lactarius, stattgefunden.
Der Kaiser hat gewiß die Festungswerke der Stadt
bald wiederherstellen lassen. Denn Neapel war von
Anfang an ein Stützpunkt der byzantinischen Herr-
schaft in Italien. An die Spitze der Stadt - und damit
der ganzen Landschaft Kampanien - trat mit der Zeit9
ein kaiserlicher dux, der Herzog, mit dem Range
eines magister militum, eines kommandierenden Ge-
nerals; in der späteren Zeit wird er mit Vorliebe als
1 Waitz 408, 36.
3 Procop I, 24.
6 Procop III, 6.
2 Procopius, Bellum goticum I, 3; 8 ff.
4 Procop I, 8-10. 5 Procop I, 14.
7 Procop III, 7. 8 Procop III, 8.
9 „Spätestens anfangs 598 ist ein magister militum für Kampa-
nien bestellt worden.“ L. M. Hartmann, Untersuchungen zur
Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750).
Leipzig 1889 S. 55, 153. - Im übrigen vgl. die Aufsätze von
M. Schipa, 11 ducato di Napoli in dem Archivio storico per le
ACHELIS, DIE KATAKOMBEN VON NEAPEL
mischen Provinzialen, unter denen er wirkte, oft vor-
ausgesagt, daß sie mit der Zeit dem Druck der ger-
manischen Eroberung nachgeben, das Land verlassen
und auswandern müßten. Sechs Jahre nach seinem
Tode war der Zeitpunkt gekommen. Die Romanen
zogen in großer Anzahl nach Süden und nahmen die
Reliquien des heiligen Severin mit. Sie brachten sie
zuerst in dem Kastell Monte Feltri (in den Marken)
in Sicherheit. Die Translation nach Neapel scheint auf
eine private Anregung zurückzugehen. Eine vorneh-
me Frau, Barbaria mit Namen, lud die ganze Mönchs-
gemeinde, welche sich um die Reliquien des heiligen
Severin scharte, nach Neapel ein. Sie hatte, ebenso wie
ihr verstorbener Gatte, mit dem Heiligen in brief-
lichem Verkehr gestanden und baute für ihn ein Mau-
soleum auf ihrer Besitzung, dem Casteilum Luculla-
num, dem heutigen Pizzofalcone. So kam die feierliche
Translation zustande; der heilige Severin wurde in
dem Mausoleum beigesetzt, viele Wunder geschahen,
die Mönchsgemeinde bezog ein Kloster, das sie neben
dem Grabe erbaute. Ihr zweiter Vorsteher, Eugippius
hat wenige Jahre später ebendort die Lebensbeschrei-
bung des Heiligen verfaßt. Er erwähnt, daß der Bi-
schof Victor von Neapel sich persönlich an der Trans-
lation beteiligte. Um so auffälliger ist es, daß der Tag
der Translation nicht durch eine besondere kirchliche
Feier festgehalten worden ist. Der Marmorkalender
notiert nur den Todestag Severins, den 8. Januar,
nicht den Translationstag, während der heilige Janua-
rius zwei Festtage hatte, von denen der 13. April
als Translatio beati Januarii bezeichnet ist, und auch
dem heiligen Gaudiosus zwei Tage geweiht sind, der
27. Oktober und der 12. Juli.
Wie Eugippius berichtet, hatte Papst Gelasius I. seine
Erlaubnis zum Transport der Reliquien gegeben. Es
ist das erste Mal, daß wir die Hand eines Papstes in
die kirchlichen Angelegenheiten Neapels hineinreichen
sehen. Wir sehen, Neapel gehörte zum Metropolitan-
bezirk Roms.
Nach der Bischofchronik1 hat Bischof Victor zwei
Kirchen erbaut, die des heiligen Stephanus in S. Gen-
naro und die der heiligen Euphemia, ebenfalls vor
den Mauern gelegen. In dieser letzteren fand er selbst
seine Ruhestätte. -
Inzwischen war Neapel in den Untergang des römi-
schen Reiches hineinbezogen worden. Der letzte römi-
sche Kaiser, Romulus Augustulus, hatte seit seiner
Absetzung 476 im Castellum Lucullanum gelebt. Als
Theoderich der Große (493-526) von Ravenna aus
Italien eroberte, wurde Neapel ein Teil des ostgoti-
schen Reiches. Da es vermöge seines starken Mauer-
rings als einer der wichtigsten strategischen Punkte
galt, erhielt es eine erhebliche gotische Besatzung2.
Auf dem Forum war ein großes Mosaikbild des Kö-
nigs Theoderich zu sehen3. Die gotische Herrschaft
wurde abgelöst durch die byzantinische. Nach dem
Tode Theoderichs ließ Kaiser Justinian (5 27-65) durch
seinen Feldherrn Beiisar Italien zurückerobern. Auch
er faßte sofort Neapel als wichtigsten Punkt ins Auge.
Aber es wäre seiner Feldherrnkunst nicht gelungen,
den gewaltigen Mauerring niederzulegen, wenn ihm
nicht ein Zufall zu Hilfe gekommen wäre. Ein Soldat
machte die Entdeckung, daß man durch eine verlas-
sene Wasserleitung bis ins Innere der Stadt gelangen
konnte. Eine auserlesene Schar nahm diesen Weg und
fiel den Verteidigern, die auf der Mauer standen, in
den Rücken. So wurde Neapel erobert. Es war im
Jahre 536*. Statt der gotischen Besatzung erhielt
Neapel eine byzantinische, die zuerst 3006, später
1000 Mann betrug; es waren Römer und Isaurier6.
Aber diesmal war die kaiserliche Herrschaft noch nicht
endgültig. Im Jahre 543 bezwang der Gotenkönig
Totila die Stadt durch Hunger7. Er ließ die Befesti-
gung zum Teil niederlegen, um der Stadt ihre strate-
gische Bedeutung zu nehmen8. So hat Neapel noch
einmal eine ostgotische Periode erlebt, von 543-52.
Erst nach dem Tode des letzten Gotenkönigs Teja ist
Neapel dem oströmischen Kaisertum anheimgefallen.
Die Entscheidungsschlacht hat vor seinen Toren, am
Mons lactarius, stattgefunden.
Der Kaiser hat gewiß die Festungswerke der Stadt
bald wiederherstellen lassen. Denn Neapel war von
Anfang an ein Stützpunkt der byzantinischen Herr-
schaft in Italien. An die Spitze der Stadt - und damit
der ganzen Landschaft Kampanien - trat mit der Zeit9
ein kaiserlicher dux, der Herzog, mit dem Range
eines magister militum, eines kommandierenden Ge-
nerals; in der späteren Zeit wird er mit Vorliebe als
1 Waitz 408, 36.
3 Procop I, 24.
6 Procop III, 6.
2 Procopius, Bellum goticum I, 3; 8 ff.
4 Procop I, 8-10. 5 Procop I, 14.
7 Procop III, 7. 8 Procop III, 8.
9 „Spätestens anfangs 598 ist ein magister militum für Kampa-
nien bestellt worden.“ L. M. Hartmann, Untersuchungen zur
Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750).
Leipzig 1889 S. 55, 153. - Im übrigen vgl. die Aufsätze von
M. Schipa, 11 ducato di Napoli in dem Archivio storico per le