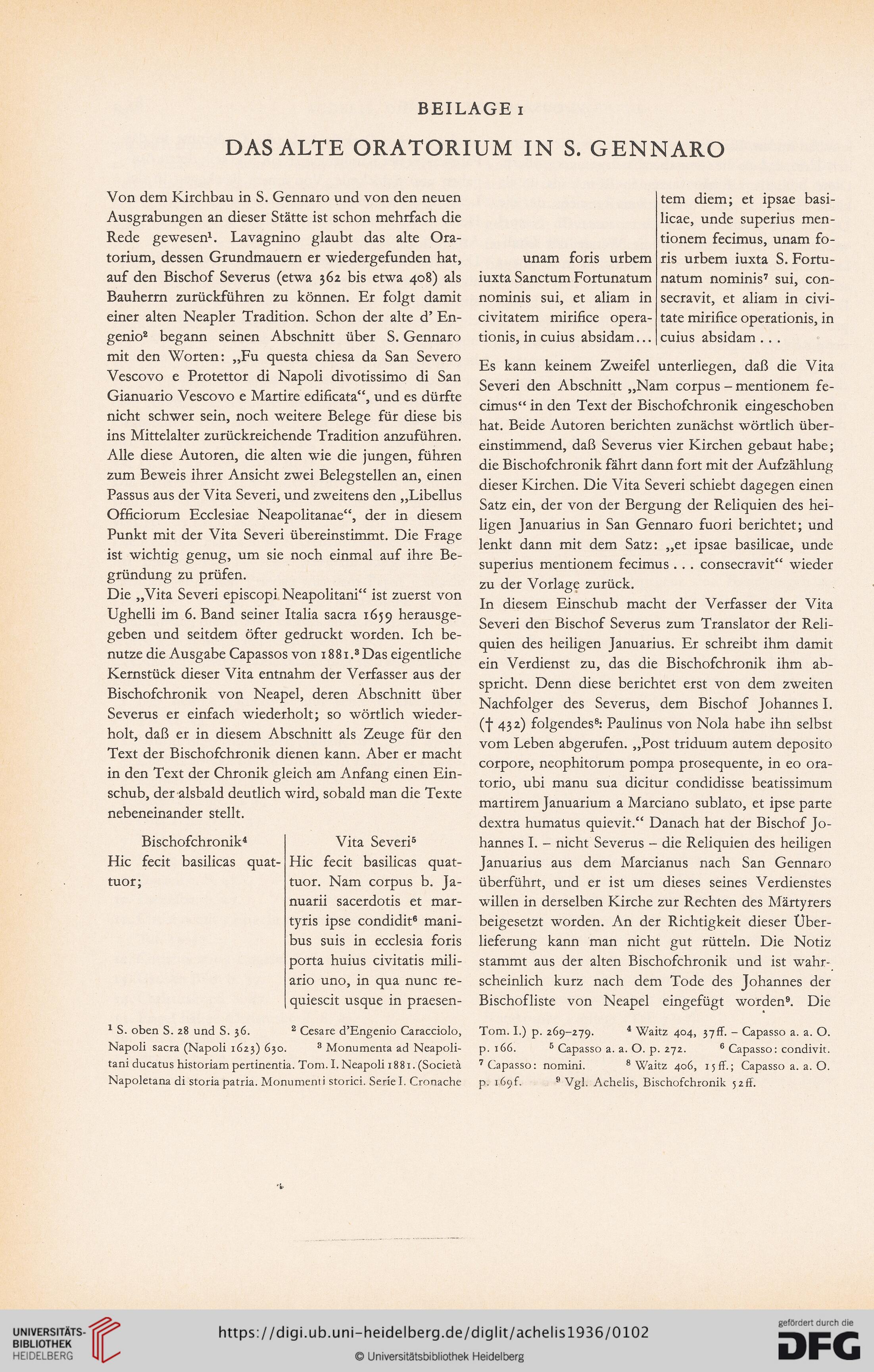BEILAGEi
DAS ALTE ORATORIUM IN S. GENNARO
Von dem Kirchbau in S. Gennaro und von den neuen
Ausgrabungen an dieser Stätte ist schon mehrfach die
Rede gewesen1. Lavagnino glaubt das alte Ora-
torium, dessen Grundmauern er wiedergefunden hat,
auf den Bischof Severus (etwa 362 bis etwa 408) als
Bauherrn zurückführen zu können. Er folgt damit
einer alten Neapler Tradition. Schon der alte d’ En-
genio2 begann seinen Abschnitt über S. Gennaro
mit den Worten: „Fu questa chiesa da San Severo
Vescovo e Protettor di Napoli divotissimo di San
Gianuario Vescovo e Martire edificata“, und es dürfte
nicht schwer sein, noch weitere Belege für diese bis
ins Mittelalter zurückreichende Tradition anzuführen.
Alle diese Autoren, die alten wie die jungen, führen
zum Beweis ihrer Ansicht zwei Belegstellen an, einen
Passus aus der Vita Severi, und zweitens den „Libellus
Officiorum Ecclesiae Neapolitanae“, der in diesem
Punkt mit der Vita Severi übereinstimmt. Die Frage
ist wichtig genug, um sie noch einmal auf ihre Be-
gründung zu prüfen.
Die „Vita Severi episcopi Neapolitani“ ist zuerst von
Ughelli im 6. Band seiner Italia sacra 1659 herausge-
geben und seitdem öfter gedruckt worden. Ich be-
nutze die Ausgabe Capassos von 18 81.3 Das eigentliche
Kernstück dieser Vita entnahm der Verfasser aus der
Bischofchronik von Neapel, deren Abschnitt über
Severus er einfach wiederholt; so wörtlich wieder-
holt, daß er in diesem Abschnitt als Zeuge für den
Text der Bischofchronik dienen kann. Aber er macht
in den Text der Chronik gleich am Anfang einen Ein-
schub, der alsbald deutlich wird, sobald man die Texte
nebeneinander stellt.
Bischofchronik4
Hic fecit basilicas quat-
tuor;
Vita Severi5
Hic fecit basilicas quat-
tuor. Nam corpus b. Ja-
nuarii sacerdotis et mar-
tyris ipse condidit® mani-
bus suis in ecclesia foris
porta huius civitatis mili-
ario uno, in qua nunc re-
quiescit usque in praesen-
1 S. oben S. 28 und S. 36. 2 Cesare d’Engenio Caracciolo,
Napoli sacra (Napoli 1623) 630. 3 Monumenta ad Neapoli-
tani ducatus historiam pertinentia. Tom. I. Neapoli 1881. (Societä
Napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie I. Cronache
unam foris urbem
iuxta Sanctum Fortunatum
nominis sui, et aliam in
civitatem mirifice opera-
tionis, in cuius absidam...
tem diem; et ipsae basi-
licae, unde superius men-
tionem fecimus, unam fo-
ris urbem iuxta S. Fortu-
natum nominis7 sui, con-
secravit, et aliam in civi-
tate mirifice operationis, in
cuius absidam .. .
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Vita
Severi den Abschnitt „Nam corpus - mentionem fe-
cimus“ in den Text der Bischofchronik eingeschoben
hat. Beide Autoren berichten zunächst wörtlich über-
einstimmend, daß Severus vier Kirchen gebaut habe;
die Bischofchronik fährt dann fort mit der Aufzählung
dieser Kirchen. Die Vita Severi schiebt dagegen einen
Satz ein, der von der Bergung der Reliquien des hei-
ligen Januarius in San Gennaro fuori berichtet; und
lenkt dann mit dem Satz: „et ipsae basilicae, unde
superius mentionem fecimus .. . consecravit“ wieder
zu der Vorlage zurück.
In diesem Einschub macht der Verfasser der Vita
Severi den Bischof Severus zum Translator der Reli-
quien des heiligen Januarius. Er schreibt ihm damit
ein Verdienst zu, das die Bischofchronik ihm ab-
spricht. Denn diese berichtet erst von dem zweiten
Nachfolger des Severus, dem Bischof Johannes I.
(f 432) folgendes8: Paulinus von Nola habe ihn selbst
vom Leben abgerufen. „Post triduum autem deposito
corpore, neophitorum pompa prosequente, in eo ora-
torio, ubi manu sua dicitur condidisse beatissimum
martirem Januarium a Marciano sublato, et ipse parte
dextra humatus quievit.“ Danach hat der Bischof Jo-
hannes I. - nicht Severus - die Reliquien des heiligen
Januarius aus dem Marcianus nach San Gennaro
überführt, und er ist um dieses seines Verdienstes
willen in derselben Kirche zur Rechten des Märtyrers
beigesetzt worden. An der Richtigkeit dieser Über-
lieferung kann man nicht gut rütteln. Die Notiz
stammt aus der alten Bischofchronik und ist wahr-
scheinlich kurz nach dem Tode des Johannes der
Bischof liste von Neapel eingefügt worden9. Die
Tom. I.) p. 269-279. 4 Waitz 404, 37fr. - Capasso a. a. O.
p. 166. 5 Capasso a. a. O. p. 272. 6 Capasso: condivit.
7 Capasso: nomini. 8 Waitz 406, 15 ff.; Capasso a. a. O.
p. i6of. 9 Vgl. Achelis, Bischofchronik jzff.
DAS ALTE ORATORIUM IN S. GENNARO
Von dem Kirchbau in S. Gennaro und von den neuen
Ausgrabungen an dieser Stätte ist schon mehrfach die
Rede gewesen1. Lavagnino glaubt das alte Ora-
torium, dessen Grundmauern er wiedergefunden hat,
auf den Bischof Severus (etwa 362 bis etwa 408) als
Bauherrn zurückführen zu können. Er folgt damit
einer alten Neapler Tradition. Schon der alte d’ En-
genio2 begann seinen Abschnitt über S. Gennaro
mit den Worten: „Fu questa chiesa da San Severo
Vescovo e Protettor di Napoli divotissimo di San
Gianuario Vescovo e Martire edificata“, und es dürfte
nicht schwer sein, noch weitere Belege für diese bis
ins Mittelalter zurückreichende Tradition anzuführen.
Alle diese Autoren, die alten wie die jungen, führen
zum Beweis ihrer Ansicht zwei Belegstellen an, einen
Passus aus der Vita Severi, und zweitens den „Libellus
Officiorum Ecclesiae Neapolitanae“, der in diesem
Punkt mit der Vita Severi übereinstimmt. Die Frage
ist wichtig genug, um sie noch einmal auf ihre Be-
gründung zu prüfen.
Die „Vita Severi episcopi Neapolitani“ ist zuerst von
Ughelli im 6. Band seiner Italia sacra 1659 herausge-
geben und seitdem öfter gedruckt worden. Ich be-
nutze die Ausgabe Capassos von 18 81.3 Das eigentliche
Kernstück dieser Vita entnahm der Verfasser aus der
Bischofchronik von Neapel, deren Abschnitt über
Severus er einfach wiederholt; so wörtlich wieder-
holt, daß er in diesem Abschnitt als Zeuge für den
Text der Bischofchronik dienen kann. Aber er macht
in den Text der Chronik gleich am Anfang einen Ein-
schub, der alsbald deutlich wird, sobald man die Texte
nebeneinander stellt.
Bischofchronik4
Hic fecit basilicas quat-
tuor;
Vita Severi5
Hic fecit basilicas quat-
tuor. Nam corpus b. Ja-
nuarii sacerdotis et mar-
tyris ipse condidit® mani-
bus suis in ecclesia foris
porta huius civitatis mili-
ario uno, in qua nunc re-
quiescit usque in praesen-
1 S. oben S. 28 und S. 36. 2 Cesare d’Engenio Caracciolo,
Napoli sacra (Napoli 1623) 630. 3 Monumenta ad Neapoli-
tani ducatus historiam pertinentia. Tom. I. Neapoli 1881. (Societä
Napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie I. Cronache
unam foris urbem
iuxta Sanctum Fortunatum
nominis sui, et aliam in
civitatem mirifice opera-
tionis, in cuius absidam...
tem diem; et ipsae basi-
licae, unde superius men-
tionem fecimus, unam fo-
ris urbem iuxta S. Fortu-
natum nominis7 sui, con-
secravit, et aliam in civi-
tate mirifice operationis, in
cuius absidam .. .
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Vita
Severi den Abschnitt „Nam corpus - mentionem fe-
cimus“ in den Text der Bischofchronik eingeschoben
hat. Beide Autoren berichten zunächst wörtlich über-
einstimmend, daß Severus vier Kirchen gebaut habe;
die Bischofchronik fährt dann fort mit der Aufzählung
dieser Kirchen. Die Vita Severi schiebt dagegen einen
Satz ein, der von der Bergung der Reliquien des hei-
ligen Januarius in San Gennaro fuori berichtet; und
lenkt dann mit dem Satz: „et ipsae basilicae, unde
superius mentionem fecimus .. . consecravit“ wieder
zu der Vorlage zurück.
In diesem Einschub macht der Verfasser der Vita
Severi den Bischof Severus zum Translator der Reli-
quien des heiligen Januarius. Er schreibt ihm damit
ein Verdienst zu, das die Bischofchronik ihm ab-
spricht. Denn diese berichtet erst von dem zweiten
Nachfolger des Severus, dem Bischof Johannes I.
(f 432) folgendes8: Paulinus von Nola habe ihn selbst
vom Leben abgerufen. „Post triduum autem deposito
corpore, neophitorum pompa prosequente, in eo ora-
torio, ubi manu sua dicitur condidisse beatissimum
martirem Januarium a Marciano sublato, et ipse parte
dextra humatus quievit.“ Danach hat der Bischof Jo-
hannes I. - nicht Severus - die Reliquien des heiligen
Januarius aus dem Marcianus nach San Gennaro
überführt, und er ist um dieses seines Verdienstes
willen in derselben Kirche zur Rechten des Märtyrers
beigesetzt worden. An der Richtigkeit dieser Über-
lieferung kann man nicht gut rütteln. Die Notiz
stammt aus der alten Bischofchronik und ist wahr-
scheinlich kurz nach dem Tode des Johannes der
Bischof liste von Neapel eingefügt worden9. Die
Tom. I.) p. 269-279. 4 Waitz 404, 37fr. - Capasso a. a. O.
p. 166. 5 Capasso a. a. O. p. 272. 6 Capasso: condivit.
7 Capasso: nomini. 8 Waitz 406, 15 ff.; Capasso a. a. O.
p. i6of. 9 Vgl. Achelis, Bischofchronik jzff.