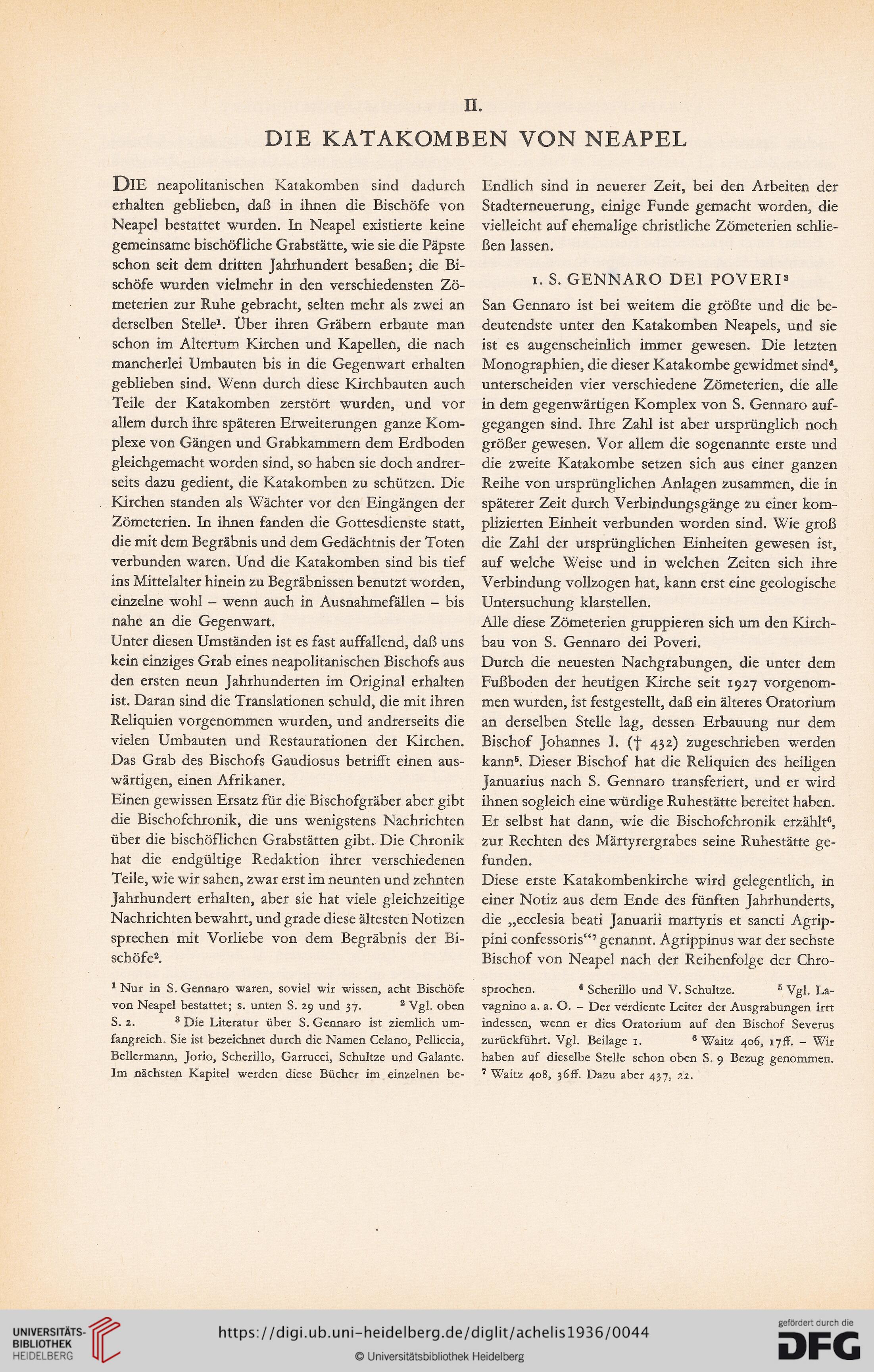II.
DIE KATAKOMBEN VON NEAPEL
Die neapolitanischen Katakomben sind dadurch
erhalten geblieben, daß in ihnen die Bischöfe von
Neapel bestattet wurden. In Neapel existierte keine
gemeinsame bischöfliche Grabstätte, wie sie die Päpste
schon seit dem dritten Jahrhundert besaßen; die Bi-
schöfe wurden vielmehr in den verschiedensten Zö-
meterien zur Ruhe gebracht, selten mehr als zwei an
derselben Stelle1. Über ihren Gräbern erbaute man
schon im Altertum Kirchen und Kapellen, die nach
mancherlei Umbauten bis in die Gegenwart erhalten
geblieben sind. Wenn durch diese Kirchbauten auch
Teile der Katakomben zerstört wurden, und vor
allem durch ihre späteren Erweiterungen ganze Kom-
plexe von Gängen und Grabkammern dem Erdboden
gleichgemacht worden sind, so haben sie doch andrer-
seits dazu gedient, die Katakomben zu schützen. Die
Kirchen standen als Wächter vor den Eingängen der
Zömeterien. In ihnen fanden die Gottesdienste statt,
die mit dem Begräbnis und dem Gedächtnis der Toten
verbunden waren. Und die Katakomben sind bis tief
ins Mittelalter hinein zu Begräbnissen benutzt worden,
einzelne wohl - wenn auch in Ausnahmefällen - bis
nahe an die Gegenwart.
Unter diesen Umständen ist es fast auffallend, daß uns
kein einziges Grab eines neapolitanischen Bischofs aus
den ersten neun Jahrhunderten im Original erhalten
ist. Daran sind die Translationen schuld, die mit ihren
Reliquien vorgenommen wurden, und andrerseits die
vielen Umbauten und Restaurationen der Kirchen.
Das Grab des Bischofs Gaudiosus betrifft einen aus-
wärtigen, einen Afrikaner.
Einen gewissen Ersatz für die Bischofgräber aber gibt
die Bischofchronik, die uns wenigstens Nachrichten
über die bischöflichen Grabstätten gibt. Die Chronik
hat die endgültige Redaktion ihrer verschiedenen
Teile, wie wir sahen, zwar erst im neunten und zehnten
Jahrhundert erhalten, aber sie hat viele gleichzeitige
Nachrichten bewahrt, und grade diese ältesten Notizen
sprechen mit Vorliebe von dem Begräbnis der Bi-
schöfe2.
1 Nur in S. Gennaro waren, soviel wir wissen, acht Bischöfe
von Neapel bestattet; s. unten S. 29 und 57. 2 Vgl. oben
S. 2. 3 Die Literatur über S. Gennaro ist ziemlich um-
fangreich. Sie ist bezeichnet durch die Namen Celano, Pelliccia,
Bellermann, Jorio, Scherillo, Garrucci, Schultze und Galante.
Im nächsten Kapitel werden diese Bücher im einzelnen be-
Endlich sind in neuerer Zeit, bei den Arbeiten der
Stadterneuerung, einige Funde gemacht worden, die
vielleicht auf ehemalige christliche Zömeterien schlie-
ßen lassen.
1. S. GENNARO DEI POVERI3
San Gennaro ist bei weitem die größte und die be-
deutendste unter den Katakomben Neapels, und sie
ist es augenscheinlich immer gewesen. Die letzten
Monographien, die dieser Katakombe gewidmet sind4,
unterscheiden vier verschiedene Zömeterien, die alle
in dem gegenwärtigen Komplex von S. Gennaro auf-
gegangen sind. Ihre Zahl ist aber ursprünglich noch
größer gewesen. Vor allem die sogenannte erste und
die zweite Katakombe setzen sich aus einer ganzen
Reihe von ursprünglichen Anlagen zusammen, die in
späterer Zeit durch Verbindungsgänge zu einer kom-
plizierten Einheit verbunden worden sind. Wie groß
die Zahl der ursprünglichen Einheiten gewesen ist,
auf welche Weise und in welchen Zeiten sich ihre
Verbindung vollzogen hat, kann erst eine geologische
Untersuchung klarstellen.
Alle diese Zömeterien gruppieren sich um den Kirch-
bau von S. Gennaro dei Poveri.
Durch die neuesten Nachgrabungen, die unter dem
Fußboden der heutigen Kirche seit 1927 vorgenom-
men wurden, ist festgestellt, daß ein älteres Oratorium
an derselben Stelle lag, dessen Erbauung nur dem
Bischof Johannes I. (f 432) zugeschrieben werden
kann6. Dieser Bischof hat die Reliquien des heiligen
Januarius nach S. Gennaro transferiert, und er wird
ihnen sogleich eine würdige Ruhestätte bereitet haben.
Er selbst hat dann, wie die Bischofchronik erzählt6,
zur Rechten des Märtyrergrabes seine Ruhestätte ge-
funden.
Diese erste Katakombenkirche wird gelegentlich, in
einer Notiz aus dem Ende des fünften Jahrhunderts,
die „ecclesia beati Januarii martyris et sancti Agrip-
pini confessoris“7 genannt. Agrippinus war der sechste
Bischof von Neapel nach der Reihenfolge der Chro-
sprochen. 4 Scherillo und V. Schultze. 6 Vgl. La-
vagnino a. a. O. - Der verdiente Leiter der Ausgrabungen irrt
indessen, wenn er dies Oratorium auf den Bischof Severus
zurückführt. Vgl. Beilage 1. 6 Waitz 406, xyff. - Wir
haben auf dieselbe Stelle schon oben S. 9 Bezug genommen.
7 Waitz 408, j6ff. Dazu aber 437, 22.
DIE KATAKOMBEN VON NEAPEL
Die neapolitanischen Katakomben sind dadurch
erhalten geblieben, daß in ihnen die Bischöfe von
Neapel bestattet wurden. In Neapel existierte keine
gemeinsame bischöfliche Grabstätte, wie sie die Päpste
schon seit dem dritten Jahrhundert besaßen; die Bi-
schöfe wurden vielmehr in den verschiedensten Zö-
meterien zur Ruhe gebracht, selten mehr als zwei an
derselben Stelle1. Über ihren Gräbern erbaute man
schon im Altertum Kirchen und Kapellen, die nach
mancherlei Umbauten bis in die Gegenwart erhalten
geblieben sind. Wenn durch diese Kirchbauten auch
Teile der Katakomben zerstört wurden, und vor
allem durch ihre späteren Erweiterungen ganze Kom-
plexe von Gängen und Grabkammern dem Erdboden
gleichgemacht worden sind, so haben sie doch andrer-
seits dazu gedient, die Katakomben zu schützen. Die
Kirchen standen als Wächter vor den Eingängen der
Zömeterien. In ihnen fanden die Gottesdienste statt,
die mit dem Begräbnis und dem Gedächtnis der Toten
verbunden waren. Und die Katakomben sind bis tief
ins Mittelalter hinein zu Begräbnissen benutzt worden,
einzelne wohl - wenn auch in Ausnahmefällen - bis
nahe an die Gegenwart.
Unter diesen Umständen ist es fast auffallend, daß uns
kein einziges Grab eines neapolitanischen Bischofs aus
den ersten neun Jahrhunderten im Original erhalten
ist. Daran sind die Translationen schuld, die mit ihren
Reliquien vorgenommen wurden, und andrerseits die
vielen Umbauten und Restaurationen der Kirchen.
Das Grab des Bischofs Gaudiosus betrifft einen aus-
wärtigen, einen Afrikaner.
Einen gewissen Ersatz für die Bischofgräber aber gibt
die Bischofchronik, die uns wenigstens Nachrichten
über die bischöflichen Grabstätten gibt. Die Chronik
hat die endgültige Redaktion ihrer verschiedenen
Teile, wie wir sahen, zwar erst im neunten und zehnten
Jahrhundert erhalten, aber sie hat viele gleichzeitige
Nachrichten bewahrt, und grade diese ältesten Notizen
sprechen mit Vorliebe von dem Begräbnis der Bi-
schöfe2.
1 Nur in S. Gennaro waren, soviel wir wissen, acht Bischöfe
von Neapel bestattet; s. unten S. 29 und 57. 2 Vgl. oben
S. 2. 3 Die Literatur über S. Gennaro ist ziemlich um-
fangreich. Sie ist bezeichnet durch die Namen Celano, Pelliccia,
Bellermann, Jorio, Scherillo, Garrucci, Schultze und Galante.
Im nächsten Kapitel werden diese Bücher im einzelnen be-
Endlich sind in neuerer Zeit, bei den Arbeiten der
Stadterneuerung, einige Funde gemacht worden, die
vielleicht auf ehemalige christliche Zömeterien schlie-
ßen lassen.
1. S. GENNARO DEI POVERI3
San Gennaro ist bei weitem die größte und die be-
deutendste unter den Katakomben Neapels, und sie
ist es augenscheinlich immer gewesen. Die letzten
Monographien, die dieser Katakombe gewidmet sind4,
unterscheiden vier verschiedene Zömeterien, die alle
in dem gegenwärtigen Komplex von S. Gennaro auf-
gegangen sind. Ihre Zahl ist aber ursprünglich noch
größer gewesen. Vor allem die sogenannte erste und
die zweite Katakombe setzen sich aus einer ganzen
Reihe von ursprünglichen Anlagen zusammen, die in
späterer Zeit durch Verbindungsgänge zu einer kom-
plizierten Einheit verbunden worden sind. Wie groß
die Zahl der ursprünglichen Einheiten gewesen ist,
auf welche Weise und in welchen Zeiten sich ihre
Verbindung vollzogen hat, kann erst eine geologische
Untersuchung klarstellen.
Alle diese Zömeterien gruppieren sich um den Kirch-
bau von S. Gennaro dei Poveri.
Durch die neuesten Nachgrabungen, die unter dem
Fußboden der heutigen Kirche seit 1927 vorgenom-
men wurden, ist festgestellt, daß ein älteres Oratorium
an derselben Stelle lag, dessen Erbauung nur dem
Bischof Johannes I. (f 432) zugeschrieben werden
kann6. Dieser Bischof hat die Reliquien des heiligen
Januarius nach S. Gennaro transferiert, und er wird
ihnen sogleich eine würdige Ruhestätte bereitet haben.
Er selbst hat dann, wie die Bischofchronik erzählt6,
zur Rechten des Märtyrergrabes seine Ruhestätte ge-
funden.
Diese erste Katakombenkirche wird gelegentlich, in
einer Notiz aus dem Ende des fünften Jahrhunderts,
die „ecclesia beati Januarii martyris et sancti Agrip-
pini confessoris“7 genannt. Agrippinus war der sechste
Bischof von Neapel nach der Reihenfolge der Chro-
sprochen. 4 Scherillo und V. Schultze. 6 Vgl. La-
vagnino a. a. O. - Der verdiente Leiter der Ausgrabungen irrt
indessen, wenn er dies Oratorium auf den Bischof Severus
zurückführt. Vgl. Beilage 1. 6 Waitz 406, xyff. - Wir
haben auf dieselbe Stelle schon oben S. 9 Bezug genommen.
7 Waitz 408, j6ff. Dazu aber 437, 22.