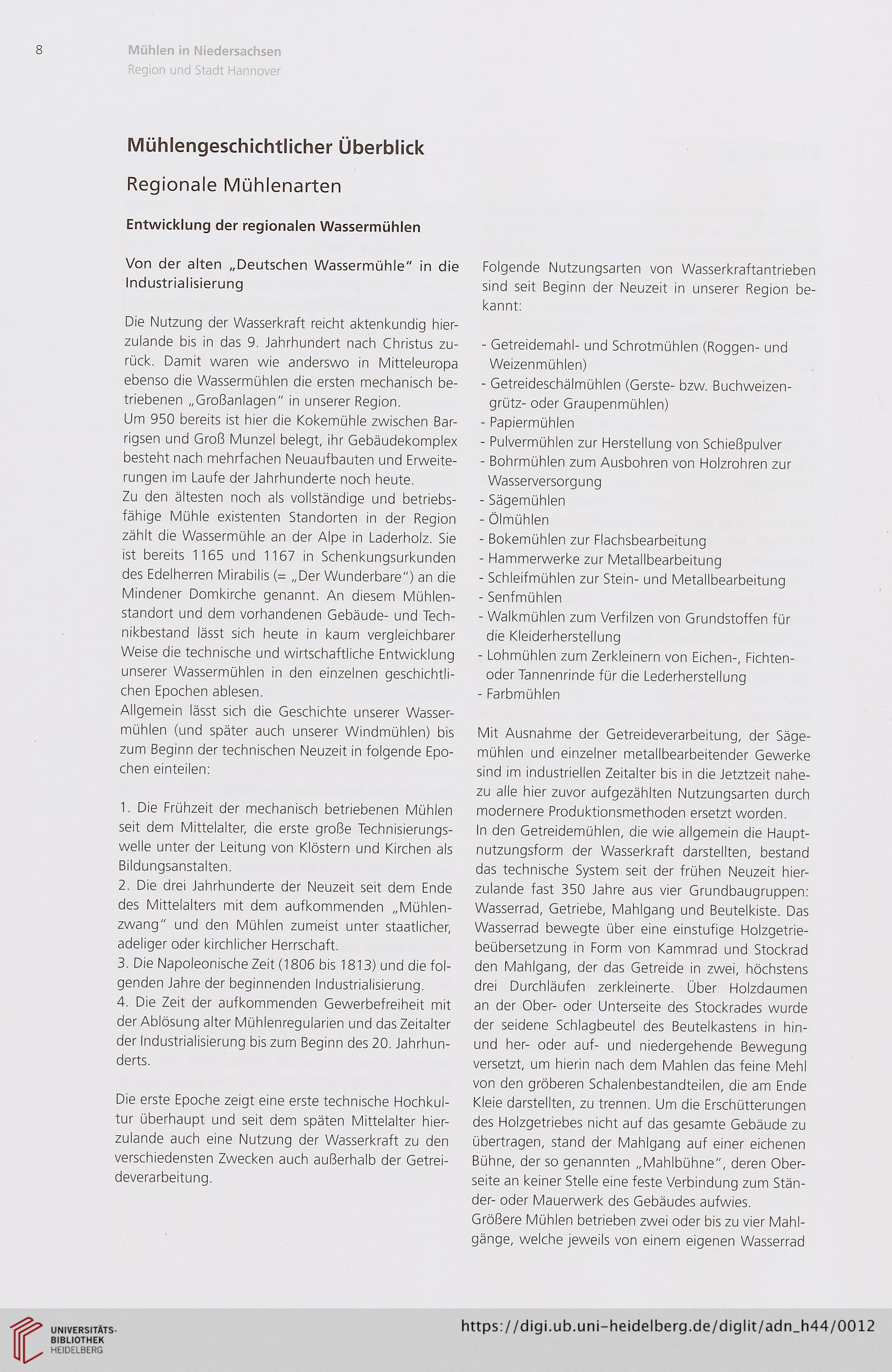8
Mühlen in Niedersachsen
Region und Stadt Hannover
Mühlengeschichtlicher Überblick
Regionale Mühlenarten
Entwicklung der regionalen Wassermühlen
Von der alten „Deutschen Wassermühle" in die
Industrialisierung
Die Nutzung der Wasserkraft reicht aktenkundig hier-
zulande bis in das 9. Jahrhundert nach Christus zu-
rück. Damit waren wie anderswo in Mitteleuropa
ebenso die Wassermühlen die ersten mechanisch be-
triebenen „Großanlagen" in unserer Region.
Um 950 bereits ist hier die Kokemühle zwischen Bar-
rigsen und Groß Munzel belegt, ihr Gebäudekomplex
besteht nach mehrfachen Neuaufbauten und Erweite-
rungen im Laufe der Jahrhunderte noch heute.
Zu den ältesten noch als vollständige und betriebs-
fähige Mühle existenten Standorten in der Region
zählt die Wassermühle an der Alpe in Laderholz. Sie
ist bereits 1165 und 1167 in Schenkungsurkunden
des Edelherren Mirabilis (= „Der Wunderbare") an die
Mindener Domkirche genannt. An diesem Mühlen-
standort und dem vorhandenen Gebäude- und Tech-
nikbestand lässt sich heute in kaum vergleichbarer
Weise die technische und wirtschaftliche Entwicklung
unserer Wassermühlen in den einzelnen geschichtli-
chen Epochen ablesen.
Allgemein lässt sich die Geschichte unserer Wasser-
mühlen (und später auch unserer Windmühlen) bis
zum Beginn der technischen Neuzeit in folgende Epo-
chen einteilen:
1. Die Frühzeit der mechanisch betriebenen Mühlen
seit dem Mittelalter, die erste große Technisierungs-
welle unter der Leitung von Klöstern und Kirchen als
Bildungsanstalten.
2. Die drei Jahrhunderte der Neuzeit seit dem Ende
des Mittelalters mit dem aufkommenden „Mühlen-
zwang" und den Mühlen zumeist unter staatlicher,
adeliger oder kirchlicher Herrschaft.
3. Die Napoleonische Zeit (1806 bis 1813) und die fol-
genden Jahre der beginnenden Industrialisierung.
4. Die Zeit der aufkommenden Gewerbefreiheit mit
der Ablösung alter Mühlenregularien und das Zeitalter
der Industrialisierung bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts.
Die erste Epoche zeigt eine erste technische Hochkul-
tur überhaupt und seit dem späten Mittelalter hier-
zulande auch eine Nutzung der Wasserkraft zu den
verschiedensten Zwecken auch außerhalb der Getrei-
deverarbeitung.
Folgende Nutzungsarten von Wasserkraftantrieben
sind seit Beginn der Neuzeit in unserer Region be-
kannt:
- Getreidemahl- und Schrotmühlen (Roggen- und
Weizenmühlen)
- Getreideschälmühlen (Gerste- bzw. Buchweizen-
grütz- oder Graupenmühlen)
- Papiermühlen
- Pulvermühlen zur Herstellung von Schießpulver
- Bohrmühlen zum Ausbohren von Holzrohren zur
Wasserversorgung
- Sägemühlen
- Ölmühlen
- Bokemühlen zur Flachsbearbeitung
- Hammerwerke zur Metallbearbeitung
- Schleifmühlen zur Stein- und Metallbearbeitung
- Senfmühlen
- Walkmühlen zum Verfilzen von Grundstoffen für
die Kleiderherstellung
- Lohmühlen zum Zerkleinern von Eichen-, Fichten-
oder Tannenrinde für die Lederherstellung
- Farbmühlen
Mit Ausnahme der Getreideverarbeitung, der Säge-
mühlen und einzelner metallbearbeitender Gewerke
sind im industriellen Zeitalter bis in die Jetztzeit nahe-
zu alle hier zuvor aufgezählten Nutzungsarten durch
modernere Produktionsmethoden ersetzt worden.
In den Getreidemühlen, die wie allgemein die Haupt-
nutzungsform der Wasserkraft darstellten, bestand
das technische System seit der frühen Neuzeit hier-
zulande fast 350 Jahre aus vier Grundbaugruppen:
Wasserrad, Getriebe, Mahlgang und Beutelkiste. Das
Wasserrad bewegte über eine einstufige Holzgetrie-
beübersetzung in Form von Kammrad und Stockrad
den Mahlgang, der das Getreide in zwei, höchstens
drei Durchläufen zerkleinerte. Über Holzdaumen
an der Ober- oder Unterseite des Stockrades wurde
der seidene Schlagbeutel des Beutelkastens in hin-
und her- oder auf- und niedergehende Bewegung
versetzt, um hierin nach dem Mahlen das feine Mehl
von den gröberen Schalenbestandteilen, die am Ende
Kleie darstellten, zu trennen. Um die Erschütterungen
des Holzgetriebes nicht auf das gesamte Gebäude zu
übertragen, stand der Mahlgang auf einer eichenen
Bühne, der so genannten „Mahlbühne", deren Ober-
seite an keiner Stelle eine feste Verbindung zum Stän-
der- oder Mauerwerk des Gebäudes aufwies.
Größere Mühlen betrieben zwei oder bis zu vier Mahl-
gänge, welche jeweils von einem eigenen Wasserrad
Mühlen in Niedersachsen
Region und Stadt Hannover
Mühlengeschichtlicher Überblick
Regionale Mühlenarten
Entwicklung der regionalen Wassermühlen
Von der alten „Deutschen Wassermühle" in die
Industrialisierung
Die Nutzung der Wasserkraft reicht aktenkundig hier-
zulande bis in das 9. Jahrhundert nach Christus zu-
rück. Damit waren wie anderswo in Mitteleuropa
ebenso die Wassermühlen die ersten mechanisch be-
triebenen „Großanlagen" in unserer Region.
Um 950 bereits ist hier die Kokemühle zwischen Bar-
rigsen und Groß Munzel belegt, ihr Gebäudekomplex
besteht nach mehrfachen Neuaufbauten und Erweite-
rungen im Laufe der Jahrhunderte noch heute.
Zu den ältesten noch als vollständige und betriebs-
fähige Mühle existenten Standorten in der Region
zählt die Wassermühle an der Alpe in Laderholz. Sie
ist bereits 1165 und 1167 in Schenkungsurkunden
des Edelherren Mirabilis (= „Der Wunderbare") an die
Mindener Domkirche genannt. An diesem Mühlen-
standort und dem vorhandenen Gebäude- und Tech-
nikbestand lässt sich heute in kaum vergleichbarer
Weise die technische und wirtschaftliche Entwicklung
unserer Wassermühlen in den einzelnen geschichtli-
chen Epochen ablesen.
Allgemein lässt sich die Geschichte unserer Wasser-
mühlen (und später auch unserer Windmühlen) bis
zum Beginn der technischen Neuzeit in folgende Epo-
chen einteilen:
1. Die Frühzeit der mechanisch betriebenen Mühlen
seit dem Mittelalter, die erste große Technisierungs-
welle unter der Leitung von Klöstern und Kirchen als
Bildungsanstalten.
2. Die drei Jahrhunderte der Neuzeit seit dem Ende
des Mittelalters mit dem aufkommenden „Mühlen-
zwang" und den Mühlen zumeist unter staatlicher,
adeliger oder kirchlicher Herrschaft.
3. Die Napoleonische Zeit (1806 bis 1813) und die fol-
genden Jahre der beginnenden Industrialisierung.
4. Die Zeit der aufkommenden Gewerbefreiheit mit
der Ablösung alter Mühlenregularien und das Zeitalter
der Industrialisierung bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts.
Die erste Epoche zeigt eine erste technische Hochkul-
tur überhaupt und seit dem späten Mittelalter hier-
zulande auch eine Nutzung der Wasserkraft zu den
verschiedensten Zwecken auch außerhalb der Getrei-
deverarbeitung.
Folgende Nutzungsarten von Wasserkraftantrieben
sind seit Beginn der Neuzeit in unserer Region be-
kannt:
- Getreidemahl- und Schrotmühlen (Roggen- und
Weizenmühlen)
- Getreideschälmühlen (Gerste- bzw. Buchweizen-
grütz- oder Graupenmühlen)
- Papiermühlen
- Pulvermühlen zur Herstellung von Schießpulver
- Bohrmühlen zum Ausbohren von Holzrohren zur
Wasserversorgung
- Sägemühlen
- Ölmühlen
- Bokemühlen zur Flachsbearbeitung
- Hammerwerke zur Metallbearbeitung
- Schleifmühlen zur Stein- und Metallbearbeitung
- Senfmühlen
- Walkmühlen zum Verfilzen von Grundstoffen für
die Kleiderherstellung
- Lohmühlen zum Zerkleinern von Eichen-, Fichten-
oder Tannenrinde für die Lederherstellung
- Farbmühlen
Mit Ausnahme der Getreideverarbeitung, der Säge-
mühlen und einzelner metallbearbeitender Gewerke
sind im industriellen Zeitalter bis in die Jetztzeit nahe-
zu alle hier zuvor aufgezählten Nutzungsarten durch
modernere Produktionsmethoden ersetzt worden.
In den Getreidemühlen, die wie allgemein die Haupt-
nutzungsform der Wasserkraft darstellten, bestand
das technische System seit der frühen Neuzeit hier-
zulande fast 350 Jahre aus vier Grundbaugruppen:
Wasserrad, Getriebe, Mahlgang und Beutelkiste. Das
Wasserrad bewegte über eine einstufige Holzgetrie-
beübersetzung in Form von Kammrad und Stockrad
den Mahlgang, der das Getreide in zwei, höchstens
drei Durchläufen zerkleinerte. Über Holzdaumen
an der Ober- oder Unterseite des Stockrades wurde
der seidene Schlagbeutel des Beutelkastens in hin-
und her- oder auf- und niedergehende Bewegung
versetzt, um hierin nach dem Mahlen das feine Mehl
von den gröberen Schalenbestandteilen, die am Ende
Kleie darstellten, zu trennen. Um die Erschütterungen
des Holzgetriebes nicht auf das gesamte Gebäude zu
übertragen, stand der Mahlgang auf einer eichenen
Bühne, der so genannten „Mahlbühne", deren Ober-
seite an keiner Stelle eine feste Verbindung zum Stän-
der- oder Mauerwerk des Gebäudes aufwies.
Größere Mühlen betrieben zwei oder bis zu vier Mahl-
gänge, welche jeweils von einem eigenen Wasserrad