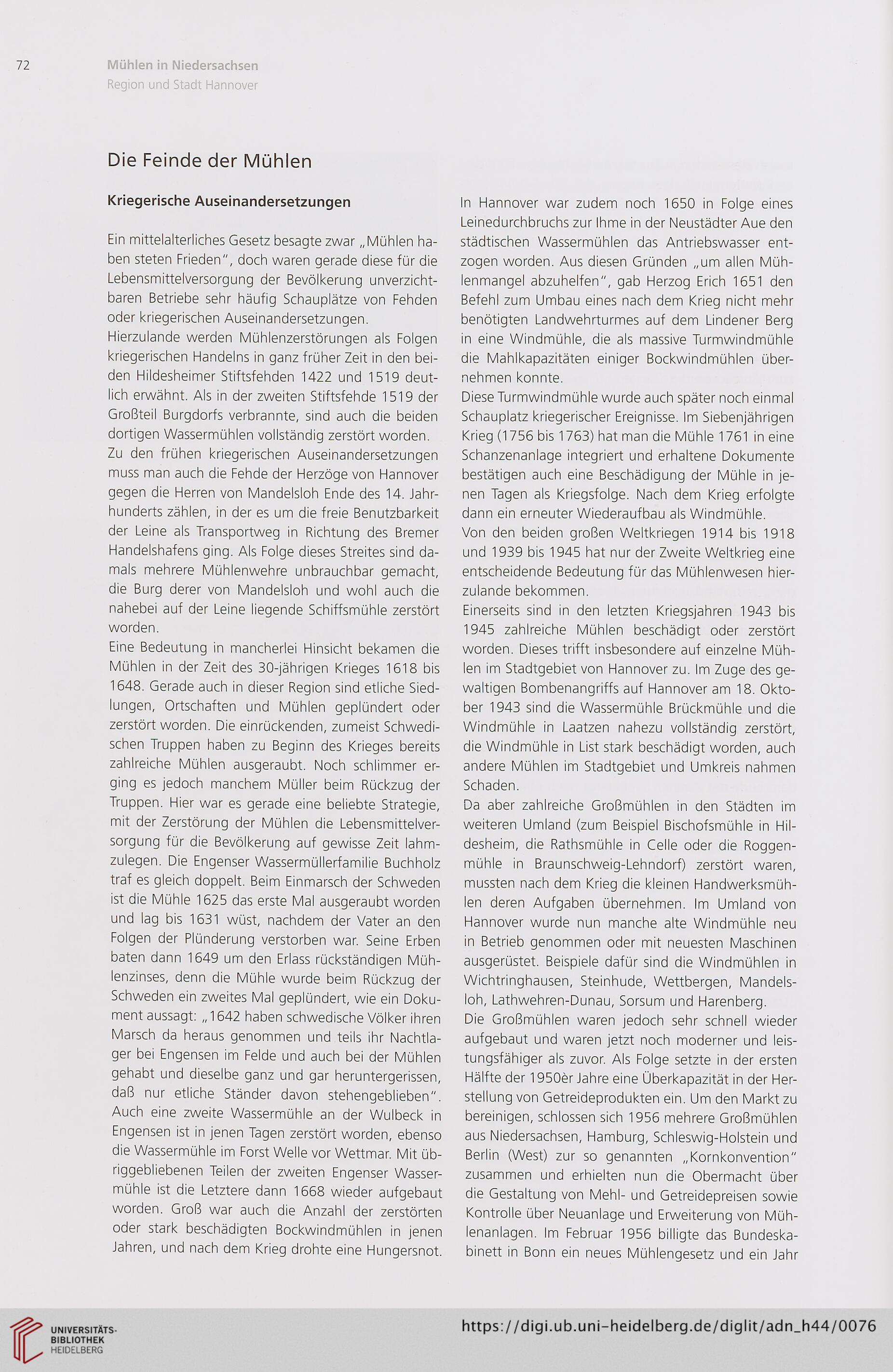72
Mühlen in Niedersachsen
Region und Stadt Hannover
Die Feinde der Mühlen
Kriegerische Auseinandersetzungen
Ein mittelalterliches Gesetz besagte zwar „Mühlen ha-
ben steten Frieden", doch waren gerade diese für die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung unverzicht-
baren Betriebe sehr häufig Schauplätze von Fehden
oder kriegerischen Auseinandersetzungen.
Hierzulande werden Mühlenzerstörungen als Folgen
kriegerischen Handelns in ganz früher Zeit in den bei-
den Hildesheimer Stiftsfehden 1422 und 1519 deut-
lich erwähnt. Als in der zweiten Stiftsfehde 1519 der
Großteil Burgdorfs verbrannte, sind auch die beiden
dortigen Wassermühlen vollständig zerstört worden.
Zu den frühen kriegerischen Auseinandersetzungen
muss man auch die Fehde der Herzöge von Hannover
gegen die Herren von Mandelsloh Ende des 14. Jahr-
hunderts zählen, in der es um die freie Benutzbarkeit
der Leine als Transportweg in Richtung des Bremer
Handelshafens ging. Als Folge dieses Streites sind da-
mals mehrere Mühlenwehre unbrauchbar gemacht,
die Burg derer von Mandelsloh und wohl auch die
nahebei auf der Leine liegende Schiffsmühle zerstört
worden.
Eine Bedeutung in mancherlei Hinsicht bekamen die
Mühlen in der Zeit des 30-jährigen Krieges 1618 bis
1648. Gerade auch in dieser Region sind etliche Sied-
lungen, Ortschaften und Mühlen geplündert oder
zerstört worden. Die einrückenden, zumeist Schwedi-
schen Truppen haben zu Beginn des Krieges bereits
zahlreiche Mühlen ausgeraubt. Noch schlimmer er-
ging es jedoch manchem Müller beim Rückzug der
Truppen. Hier war es gerade eine beliebte Strategie,
mit der Zerstörung der Mühlen die Lebensmittelver-
sorgung für die Bevölkerung auf gewisse Zeit lahm-
zulegen. Die Engenser Wassermüllerfamilie Buchholz
traf es gleich doppelt. Beim Einmarsch der Schweden
ist die Mühle 1625 das erste Mal ausgeraubt worden
und lag bis 1631 wüst, nachdem der Vater an den
Folgen der Plünderung verstorben war. Seine Erben
baten dann 1649 um den Erlass rückständigen Müh-
lenzinses, denn die Mühle wurde beim Rückzug der
Schweden ein zweites Mal geplündert, wie ein Doku-
ment aussagt: „ 1642 haben schwedische Völker ihren
Marsch da heraus genommen und teils ihr Nachtla-
ger bei Engensen im Felde und auch bei der Mühlen
gehabt und dieselbe ganz und gar heruntergerissen,
daß nur etliche Ständer davon stehengeblieben".
Auch eine zweite Wassermühle an der Wulbeck in
Engensen ist in jenen Tagen zerstört worden, ebenso
die Wassermühle im Forst Welle vor Wettmar. Mit üb-
riggebliebenen Teilen der zweiten Engenser Wasser-
mühle ist die Letztere dann 1668 wieder aufgebaut
worden. Groß war auch die Anzahl der zerstörten
oder stark beschädigten Bockwindmühlen in jenen
Jahren, und nach dem Krieg drohte eine Hungersnot.
In Hannover war zudem noch 1650 in Folge eines
Leinedurchbruchs zur Ihme in der Neustädter Aue den
städtischen Wassermühlen das Antriebswasser ent-
zogen worden. Aus diesen Gründen „um allen Müh-
lenmangel abzuhelfen", gab Herzog Erich 1651 den
Befehl zum Umbau eines nach dem Krieg nicht mehr
benötigten Landwehrturmes auf dem Lindener Berg
in eine Windmühle, die als massive Turmwindmühle
die Mahlkapazitäten einiger Bockwindmühlen über-
nehmen konnte.
Diese Turmwindmühle wurde auch später noch einmal
Schauplatz kriegerischer Ereignisse. Im Siebenjährigen
Krieg (1756 bis 1763) hat man die Mühle 1761 in eine
Schanzenanlage integriert und erhaltene Dokumente
bestätigen auch eine Beschädigung der Mühle in je-
nen Tagen als Kriegsfolge. Nach dem Krieg erfolgte
dann ein erneuter Wiederaufbau als Windmühle.
Von den beiden großen Weltkriegen 1914 bis 1918
und 1939 bis 1945 hat nur der Zweite Weltkrieg eine
entscheidende Bedeutung für das Mühlenwesen hier-
zulande bekommen.
Einerseits sind in den letzten Kriegsjahren 1943 bis
1945 zahlreiche Mühlen beschädigt oder zerstört
worden. Dieses trifft insbesondere auf einzelne Müh-
len im Stadtgebiet von Hannover zu. Im Zuge des ge-
waltigen Bombenangriffs auf Hannover am 18. Okto-
ber 1943 sind die Wassermühle Brückmühle und die
Windmühle in Laatzen nahezu vollständig zerstört,
die Windmühle in List stark beschädigt worden, auch
andere Mühlen im Stadtgebiet und Umkreis nahmen
Schaden.
Da aber zahlreiche Großmühlen in den Städten im
weiteren Umland (zum Beispiel Bischofsmühle in Hil-
desheim, die Rathsmühle in Celle oder die Roggen-
mühle in Braunschweig-Lehndorf) zerstört waren,
mussten nach dem Krieg die kleinen Handwerksmüh-
len deren Aufgaben übernehmen. Im Umland von
Hannover wurde nun manche alte Windmühle neu
in Betrieb genommen oder mit neuesten Maschinen
ausgerüstet. Beispiele dafür sind die Windmühlen in
Wichtringhausen, Steinhude, Wettbergen, Mandels-
loh, Lathwehren-Dunau, Sorsum und Harenberg.
Die Großmühlen waren jedoch sehr schnell wieder
aufgebaut und waren jetzt noch moderner und leis-
tungsfähiger als zuvor. Als Folge setzte in der ersten
Hälfte der 1950er Jahre eine Überkapazität in der Her-
stellung von Getreideprodukten ein. Um den Markt zu
bereinigen, schlossen sich 1956 mehrere Großmühlen
aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und
Berlin (West) zur so genannten „Kornkonvention"
zusammen und erhielten nun die Obermacht über
die Gestaltung von Mehl- und Getreidepreisen sowie
Kontrolle über Neuanlage und Erweiterung von Müh-
lenanlagen. Im Februar 1956 billigte das Bundeska-
binett in Bonn ein neues Mühlengesetz und ein Jahr
Mühlen in Niedersachsen
Region und Stadt Hannover
Die Feinde der Mühlen
Kriegerische Auseinandersetzungen
Ein mittelalterliches Gesetz besagte zwar „Mühlen ha-
ben steten Frieden", doch waren gerade diese für die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung unverzicht-
baren Betriebe sehr häufig Schauplätze von Fehden
oder kriegerischen Auseinandersetzungen.
Hierzulande werden Mühlenzerstörungen als Folgen
kriegerischen Handelns in ganz früher Zeit in den bei-
den Hildesheimer Stiftsfehden 1422 und 1519 deut-
lich erwähnt. Als in der zweiten Stiftsfehde 1519 der
Großteil Burgdorfs verbrannte, sind auch die beiden
dortigen Wassermühlen vollständig zerstört worden.
Zu den frühen kriegerischen Auseinandersetzungen
muss man auch die Fehde der Herzöge von Hannover
gegen die Herren von Mandelsloh Ende des 14. Jahr-
hunderts zählen, in der es um die freie Benutzbarkeit
der Leine als Transportweg in Richtung des Bremer
Handelshafens ging. Als Folge dieses Streites sind da-
mals mehrere Mühlenwehre unbrauchbar gemacht,
die Burg derer von Mandelsloh und wohl auch die
nahebei auf der Leine liegende Schiffsmühle zerstört
worden.
Eine Bedeutung in mancherlei Hinsicht bekamen die
Mühlen in der Zeit des 30-jährigen Krieges 1618 bis
1648. Gerade auch in dieser Region sind etliche Sied-
lungen, Ortschaften und Mühlen geplündert oder
zerstört worden. Die einrückenden, zumeist Schwedi-
schen Truppen haben zu Beginn des Krieges bereits
zahlreiche Mühlen ausgeraubt. Noch schlimmer er-
ging es jedoch manchem Müller beim Rückzug der
Truppen. Hier war es gerade eine beliebte Strategie,
mit der Zerstörung der Mühlen die Lebensmittelver-
sorgung für die Bevölkerung auf gewisse Zeit lahm-
zulegen. Die Engenser Wassermüllerfamilie Buchholz
traf es gleich doppelt. Beim Einmarsch der Schweden
ist die Mühle 1625 das erste Mal ausgeraubt worden
und lag bis 1631 wüst, nachdem der Vater an den
Folgen der Plünderung verstorben war. Seine Erben
baten dann 1649 um den Erlass rückständigen Müh-
lenzinses, denn die Mühle wurde beim Rückzug der
Schweden ein zweites Mal geplündert, wie ein Doku-
ment aussagt: „ 1642 haben schwedische Völker ihren
Marsch da heraus genommen und teils ihr Nachtla-
ger bei Engensen im Felde und auch bei der Mühlen
gehabt und dieselbe ganz und gar heruntergerissen,
daß nur etliche Ständer davon stehengeblieben".
Auch eine zweite Wassermühle an der Wulbeck in
Engensen ist in jenen Tagen zerstört worden, ebenso
die Wassermühle im Forst Welle vor Wettmar. Mit üb-
riggebliebenen Teilen der zweiten Engenser Wasser-
mühle ist die Letztere dann 1668 wieder aufgebaut
worden. Groß war auch die Anzahl der zerstörten
oder stark beschädigten Bockwindmühlen in jenen
Jahren, und nach dem Krieg drohte eine Hungersnot.
In Hannover war zudem noch 1650 in Folge eines
Leinedurchbruchs zur Ihme in der Neustädter Aue den
städtischen Wassermühlen das Antriebswasser ent-
zogen worden. Aus diesen Gründen „um allen Müh-
lenmangel abzuhelfen", gab Herzog Erich 1651 den
Befehl zum Umbau eines nach dem Krieg nicht mehr
benötigten Landwehrturmes auf dem Lindener Berg
in eine Windmühle, die als massive Turmwindmühle
die Mahlkapazitäten einiger Bockwindmühlen über-
nehmen konnte.
Diese Turmwindmühle wurde auch später noch einmal
Schauplatz kriegerischer Ereignisse. Im Siebenjährigen
Krieg (1756 bis 1763) hat man die Mühle 1761 in eine
Schanzenanlage integriert und erhaltene Dokumente
bestätigen auch eine Beschädigung der Mühle in je-
nen Tagen als Kriegsfolge. Nach dem Krieg erfolgte
dann ein erneuter Wiederaufbau als Windmühle.
Von den beiden großen Weltkriegen 1914 bis 1918
und 1939 bis 1945 hat nur der Zweite Weltkrieg eine
entscheidende Bedeutung für das Mühlenwesen hier-
zulande bekommen.
Einerseits sind in den letzten Kriegsjahren 1943 bis
1945 zahlreiche Mühlen beschädigt oder zerstört
worden. Dieses trifft insbesondere auf einzelne Müh-
len im Stadtgebiet von Hannover zu. Im Zuge des ge-
waltigen Bombenangriffs auf Hannover am 18. Okto-
ber 1943 sind die Wassermühle Brückmühle und die
Windmühle in Laatzen nahezu vollständig zerstört,
die Windmühle in List stark beschädigt worden, auch
andere Mühlen im Stadtgebiet und Umkreis nahmen
Schaden.
Da aber zahlreiche Großmühlen in den Städten im
weiteren Umland (zum Beispiel Bischofsmühle in Hil-
desheim, die Rathsmühle in Celle oder die Roggen-
mühle in Braunschweig-Lehndorf) zerstört waren,
mussten nach dem Krieg die kleinen Handwerksmüh-
len deren Aufgaben übernehmen. Im Umland von
Hannover wurde nun manche alte Windmühle neu
in Betrieb genommen oder mit neuesten Maschinen
ausgerüstet. Beispiele dafür sind die Windmühlen in
Wichtringhausen, Steinhude, Wettbergen, Mandels-
loh, Lathwehren-Dunau, Sorsum und Harenberg.
Die Großmühlen waren jedoch sehr schnell wieder
aufgebaut und waren jetzt noch moderner und leis-
tungsfähiger als zuvor. Als Folge setzte in der ersten
Hälfte der 1950er Jahre eine Überkapazität in der Her-
stellung von Getreideprodukten ein. Um den Markt zu
bereinigen, schlossen sich 1956 mehrere Großmühlen
aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und
Berlin (West) zur so genannten „Kornkonvention"
zusammen und erhielten nun die Obermacht über
die Gestaltung von Mehl- und Getreidepreisen sowie
Kontrolle über Neuanlage und Erweiterung von Müh-
lenanlagen. Im Februar 1956 billigte das Bundeska-
binett in Bonn ein neues Mühlengesetz und ein Jahr