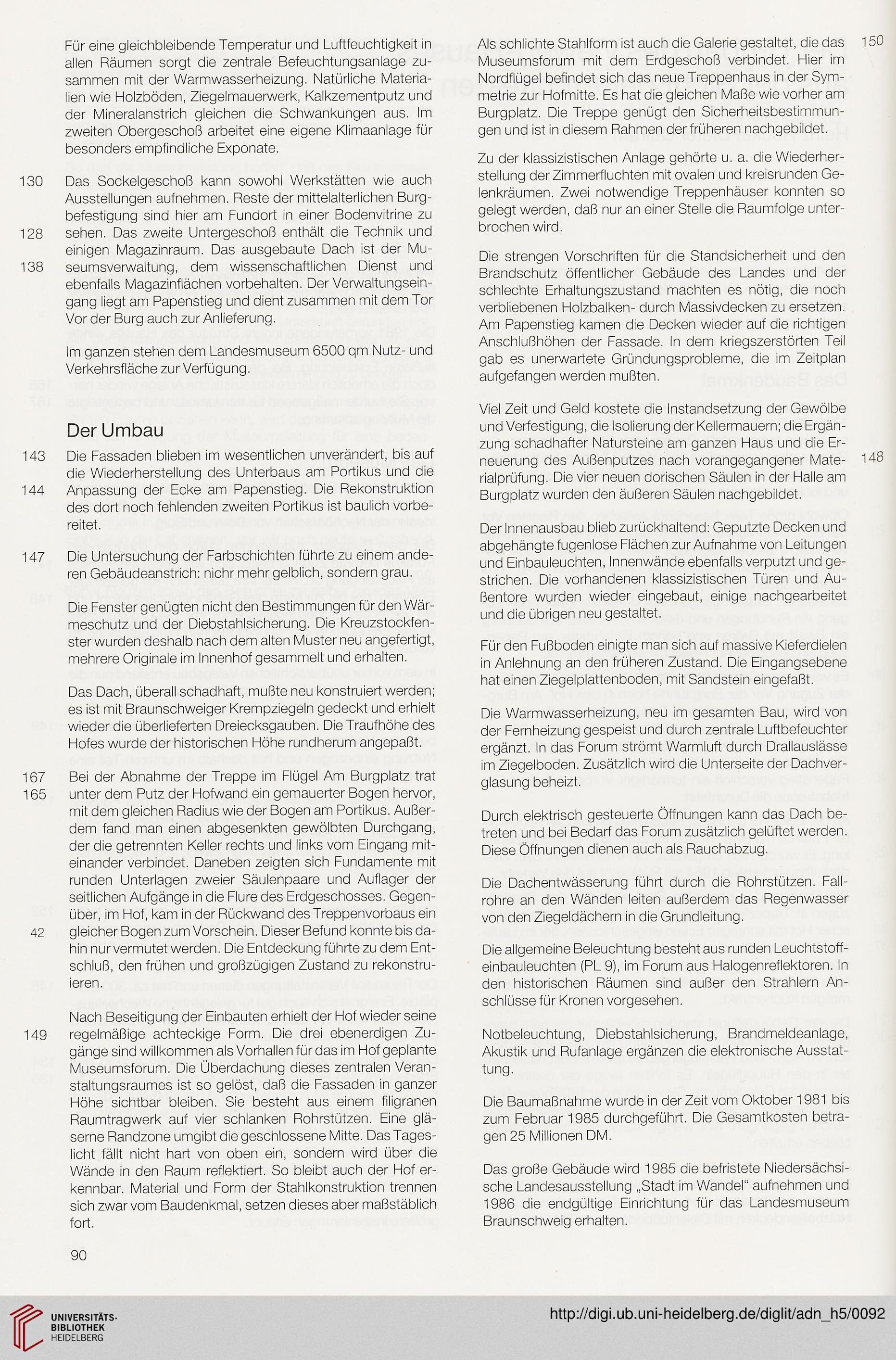Für eine gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit in
allen Räumen sorgt die zentrale Befeuchtungsanlage zu-
sammen mit der Warmwasserheizung. Natürliche Materia-
lien wie Holzböden, Ziegelmauerwerk, Kalkzementputz und
der Mineralanstrich gleichen die Schwankungen aus. Im
zweiten Obergeschoß arbeitet eine eigene Klimaanlage für
besonders empfindliche Exponate.
130 Das Sockelgeschoß kann sowohl Werkstätten wie auch
Ausstellungen aufnehmen. Reste der mittelalterlichen Burg-
befestigung sind hier am Fundort in einer Bodenvitrine zu
128 sehen. Das zweite Untergeschoß enthält die Technik und
einigen Magazinraum. Das ausgebaute Dach ist der Mu-
138 seumsverwaltung, dem wissenschaftlichen Dienst und
ebenfalls Magazinflächen vorbehalten. Der Verwaltungsein-
gang liegt am Papenstieg und dient zusammen mit dem Tor
Vor der Burg auch zur Anlieferung.
Im ganzen stehen dem Landesmuseum 6500 qm Nutz- und
Verkehrsfläche zur Verfügung.
Der Umbau
143 Die Fassaden blieben im wesentlichen unverändert, bis auf
die Wiederherstellung des Unterbaus am Portikus und die
144 Anpassung der Ecke am Papenstieg. Die Rekonstruktion
des dort noch fehlenden zweiten Portikus ist baulich vorbe-
reitet.
147 Die Untersuchung der Farbschichten führte zu einem ande-
ren Gebäudeanstrich: nichr mehr gelblich, sondern grau.
Die Fenster genügten nicht den Bestimmungen für den Wär-
meschutz und der Diebstahlsicherung. Die Kreuzstockfen-
ster wurden deshalb nach dem alten Muster neu angefertigt,
mehrere Originale im Innenhof gesammelt und erhalten.
Das Dach, überall schadhaft, mußte neu konstruiert werden;
es ist mit Braunschweiger Krempziegeln gedeckt und erhielt
wieder die überlieferten Dreiecksgauben. Die Traufhöhe des
Hofes wurde der historischen Höhe rundherum angepaßt.
167 Bei der Abnahme der Treppe im Flügel Am Burgplatz trat
165 unter dem Putz der Hofwand ein gemauerter Bogen hervor,
mit dem gleichen Radius wie der Bogen am Portikus. Außer-
dem fand man einen abgesenkten gewölbten Durchgang,
der die getrennten Keller rechts und links vom Eingang mit-
einander verbindet. Daneben zeigten sich Fundamente mit
runden Unterlagen zweier Säulenpaare und Auflager der
seitlichen Aufgänge in die Flure des Erdgeschosses. Gegen-
über, im Hof, kam in der Rückwand des Treppenvorbaus ein
42 gleicher Bogen zum Vorschein. Dieser Befund konnte bis da-
hin nur vermutet werden. Die Entdeckung führte zu dem Ent-
schluß, den frühen und großzügigen Zustand zu rekonstru-
ieren.
Nach Beseitigung der Einbauten erhielt der Hof wieder seine
149 regelmäßige achteckige Form. Die drei ebenerdigen Zu-
gänge sind willkommen als Vorhallen für das im Hof geplante
Museumsforum. Die Überdachung dieses zentralen Veran-
staltungsraumes ist so gelöst, daß die Fassaden in ganzer
Höhe sichtbar bleiben. Sie besteht aus einem filigranen
Raumtragwerk auf vier schlanken Rohrstützen. Eine glä-
serne Randzone umgibt die geschlossene Mitte. Das Tages-
licht fällt nicht hart von oben ein, sondern wird über die
Wände in den Raum reflektiert. So bleibt auch der Hof er-
kennbar. Material und Form der Stahlkonstruktion trennen
sich zwar vom Baudenkmal, setzen dieses aber maßstäblich
fort.
Als schlichte Stahlform ist auch die Galerie gestaltet, die das 150
Museumsforum mit dem Erdgeschoß verbindet. Hier im
Nordflügel befindet sich das neue Treppenhaus in der Sym-
metrie zur Hofmitte. Es hat die gleichen Maße wie vorher am
Burgplatz. Die Treppe genügt den Sicherheitsbestimmun-
gen und ist in diesem Rahmen der früheren nachgebildet.
Zu der klassizistischen Anlage gehörte u. a. die Wiederher-
stellung der Zimmerfluchten mit ovalen und kreisrunden Ge-
lenkräumen. Zwei notwendige Treppenhäuser konnten so
gelegt werden, daß nur an einer Stelle die Raumfoige unter-
brochen wird.
Die strengen Vorschriften für die Standsicherheit und den
Brandschutz öffentlicher Gebäude des Landes und der
schlechte Erhaltungszustand machten es nötig, die noch
verbliebenen Holzbalken- durch Massivdecken zu ersetzen.
Am Papenstieg kamen die Decken wieder auf die richtigen
Anschlußhöhen der Fassade. In dem kriegszerstörten Teil
gab es unerwartete Gründungsprobleme, die im Zeitplan
aufgefangen werden mußten.
Viel Zeit und Geld kostete die Instandsetzung der Gewölbe
und Verfestigung, die Isolierung der Kellermauern; die Ergän-
zung schadhafter Natursteine am ganzen Haus und die Er-
neuerung des Außenputzes nach vorangegangener Mate- 148
rialprüfung. Die vier neuen dorischen Säulen in der Halle am
Burgplatz wurden den äußeren Säulen nachgebildet.
Der Innenausbau blieb zurückhaltend: Geputzte Decken und
abgehängte fugenlose Flächen zur Aufnahme von Leitungen
und Einbauleuchten, Innenwände ebenfalls verputzt und ge-
strichen. Die vorhandenen klassizistischen Türen und Au-
ßentore wurden wieder eingebaut, einige nachgearbeitet
und die übrigen neu gestaltet.
Für den Fußboden einigte man sich auf massive Kieferdielen
in Anlehnung an den früheren Zustand. Die Eingangsebene
hat einen Ziegelplattenboden, mit Sandstein eingefaßt.
Die Warmwasserheizung, neu im gesamten Bau, wird von
der Fernheizung gespeist und durch zentrale Luftbefeuchter
ergänzt. In das Forum strömt Warmluft durch Drallauslässe
im Ziegelboden. Zusätzlich wird die Unterseite der Dachver-
glasung beheizt.
Durch elektrisch gesteuerte Öffnungen kann das Dach be-
treten und bei Bedarf das Forum zusätzlich gelüftet werden.
Diese Öffnungen dienen auch als Rauchabzug.
Die Dachentwässerung führt durch die Rohrstützen. Fall-
rohre an den Wänden leiten außerdem das Regenwasser
von den Ziegeldächern in die Grundleitung.
Die allgemeine Beleuchtung besteht aus runden Leuchtstoff-
einbauleuchten (PL 9), im Forum aus Halogenreflektoren. In
den historischen Räumen sind außer den Strahlern An-
schlüsse für Kronen vorgesehen.
Notbeleuchtung, Diebstahlsicherung, Brandmeldeanlage,
Akustik und Rufanlage ergänzen die elektronische Ausstat-
tung.
Die Baumaßnahme wurde in der Zeit vom Oktober 1981 bis
zum Februar 1985 durchgeführt. Die Gesamtkosten betra-
gen 25 Millionen DM.
Das große Gebäude wird 1985 die befristete Niedersächsi-
sche Landesausstellung „Stadt im Wandel“ aufnehmen und
1986 die endgültige Einrichtung für das Landesmuseum
Braunschweig erhalten.
90
allen Räumen sorgt die zentrale Befeuchtungsanlage zu-
sammen mit der Warmwasserheizung. Natürliche Materia-
lien wie Holzböden, Ziegelmauerwerk, Kalkzementputz und
der Mineralanstrich gleichen die Schwankungen aus. Im
zweiten Obergeschoß arbeitet eine eigene Klimaanlage für
besonders empfindliche Exponate.
130 Das Sockelgeschoß kann sowohl Werkstätten wie auch
Ausstellungen aufnehmen. Reste der mittelalterlichen Burg-
befestigung sind hier am Fundort in einer Bodenvitrine zu
128 sehen. Das zweite Untergeschoß enthält die Technik und
einigen Magazinraum. Das ausgebaute Dach ist der Mu-
138 seumsverwaltung, dem wissenschaftlichen Dienst und
ebenfalls Magazinflächen vorbehalten. Der Verwaltungsein-
gang liegt am Papenstieg und dient zusammen mit dem Tor
Vor der Burg auch zur Anlieferung.
Im ganzen stehen dem Landesmuseum 6500 qm Nutz- und
Verkehrsfläche zur Verfügung.
Der Umbau
143 Die Fassaden blieben im wesentlichen unverändert, bis auf
die Wiederherstellung des Unterbaus am Portikus und die
144 Anpassung der Ecke am Papenstieg. Die Rekonstruktion
des dort noch fehlenden zweiten Portikus ist baulich vorbe-
reitet.
147 Die Untersuchung der Farbschichten führte zu einem ande-
ren Gebäudeanstrich: nichr mehr gelblich, sondern grau.
Die Fenster genügten nicht den Bestimmungen für den Wär-
meschutz und der Diebstahlsicherung. Die Kreuzstockfen-
ster wurden deshalb nach dem alten Muster neu angefertigt,
mehrere Originale im Innenhof gesammelt und erhalten.
Das Dach, überall schadhaft, mußte neu konstruiert werden;
es ist mit Braunschweiger Krempziegeln gedeckt und erhielt
wieder die überlieferten Dreiecksgauben. Die Traufhöhe des
Hofes wurde der historischen Höhe rundherum angepaßt.
167 Bei der Abnahme der Treppe im Flügel Am Burgplatz trat
165 unter dem Putz der Hofwand ein gemauerter Bogen hervor,
mit dem gleichen Radius wie der Bogen am Portikus. Außer-
dem fand man einen abgesenkten gewölbten Durchgang,
der die getrennten Keller rechts und links vom Eingang mit-
einander verbindet. Daneben zeigten sich Fundamente mit
runden Unterlagen zweier Säulenpaare und Auflager der
seitlichen Aufgänge in die Flure des Erdgeschosses. Gegen-
über, im Hof, kam in der Rückwand des Treppenvorbaus ein
42 gleicher Bogen zum Vorschein. Dieser Befund konnte bis da-
hin nur vermutet werden. Die Entdeckung führte zu dem Ent-
schluß, den frühen und großzügigen Zustand zu rekonstru-
ieren.
Nach Beseitigung der Einbauten erhielt der Hof wieder seine
149 regelmäßige achteckige Form. Die drei ebenerdigen Zu-
gänge sind willkommen als Vorhallen für das im Hof geplante
Museumsforum. Die Überdachung dieses zentralen Veran-
staltungsraumes ist so gelöst, daß die Fassaden in ganzer
Höhe sichtbar bleiben. Sie besteht aus einem filigranen
Raumtragwerk auf vier schlanken Rohrstützen. Eine glä-
serne Randzone umgibt die geschlossene Mitte. Das Tages-
licht fällt nicht hart von oben ein, sondern wird über die
Wände in den Raum reflektiert. So bleibt auch der Hof er-
kennbar. Material und Form der Stahlkonstruktion trennen
sich zwar vom Baudenkmal, setzen dieses aber maßstäblich
fort.
Als schlichte Stahlform ist auch die Galerie gestaltet, die das 150
Museumsforum mit dem Erdgeschoß verbindet. Hier im
Nordflügel befindet sich das neue Treppenhaus in der Sym-
metrie zur Hofmitte. Es hat die gleichen Maße wie vorher am
Burgplatz. Die Treppe genügt den Sicherheitsbestimmun-
gen und ist in diesem Rahmen der früheren nachgebildet.
Zu der klassizistischen Anlage gehörte u. a. die Wiederher-
stellung der Zimmerfluchten mit ovalen und kreisrunden Ge-
lenkräumen. Zwei notwendige Treppenhäuser konnten so
gelegt werden, daß nur an einer Stelle die Raumfoige unter-
brochen wird.
Die strengen Vorschriften für die Standsicherheit und den
Brandschutz öffentlicher Gebäude des Landes und der
schlechte Erhaltungszustand machten es nötig, die noch
verbliebenen Holzbalken- durch Massivdecken zu ersetzen.
Am Papenstieg kamen die Decken wieder auf die richtigen
Anschlußhöhen der Fassade. In dem kriegszerstörten Teil
gab es unerwartete Gründungsprobleme, die im Zeitplan
aufgefangen werden mußten.
Viel Zeit und Geld kostete die Instandsetzung der Gewölbe
und Verfestigung, die Isolierung der Kellermauern; die Ergän-
zung schadhafter Natursteine am ganzen Haus und die Er-
neuerung des Außenputzes nach vorangegangener Mate- 148
rialprüfung. Die vier neuen dorischen Säulen in der Halle am
Burgplatz wurden den äußeren Säulen nachgebildet.
Der Innenausbau blieb zurückhaltend: Geputzte Decken und
abgehängte fugenlose Flächen zur Aufnahme von Leitungen
und Einbauleuchten, Innenwände ebenfalls verputzt und ge-
strichen. Die vorhandenen klassizistischen Türen und Au-
ßentore wurden wieder eingebaut, einige nachgearbeitet
und die übrigen neu gestaltet.
Für den Fußboden einigte man sich auf massive Kieferdielen
in Anlehnung an den früheren Zustand. Die Eingangsebene
hat einen Ziegelplattenboden, mit Sandstein eingefaßt.
Die Warmwasserheizung, neu im gesamten Bau, wird von
der Fernheizung gespeist und durch zentrale Luftbefeuchter
ergänzt. In das Forum strömt Warmluft durch Drallauslässe
im Ziegelboden. Zusätzlich wird die Unterseite der Dachver-
glasung beheizt.
Durch elektrisch gesteuerte Öffnungen kann das Dach be-
treten und bei Bedarf das Forum zusätzlich gelüftet werden.
Diese Öffnungen dienen auch als Rauchabzug.
Die Dachentwässerung führt durch die Rohrstützen. Fall-
rohre an den Wänden leiten außerdem das Regenwasser
von den Ziegeldächern in die Grundleitung.
Die allgemeine Beleuchtung besteht aus runden Leuchtstoff-
einbauleuchten (PL 9), im Forum aus Halogenreflektoren. In
den historischen Räumen sind außer den Strahlern An-
schlüsse für Kronen vorgesehen.
Notbeleuchtung, Diebstahlsicherung, Brandmeldeanlage,
Akustik und Rufanlage ergänzen die elektronische Ausstat-
tung.
Die Baumaßnahme wurde in der Zeit vom Oktober 1981 bis
zum Februar 1985 durchgeführt. Die Gesamtkosten betra-
gen 25 Millionen DM.
Das große Gebäude wird 1985 die befristete Niedersächsi-
sche Landesausstellung „Stadt im Wandel“ aufnehmen und
1986 die endgültige Einrichtung für das Landesmuseum
Braunschweig erhalten.
90