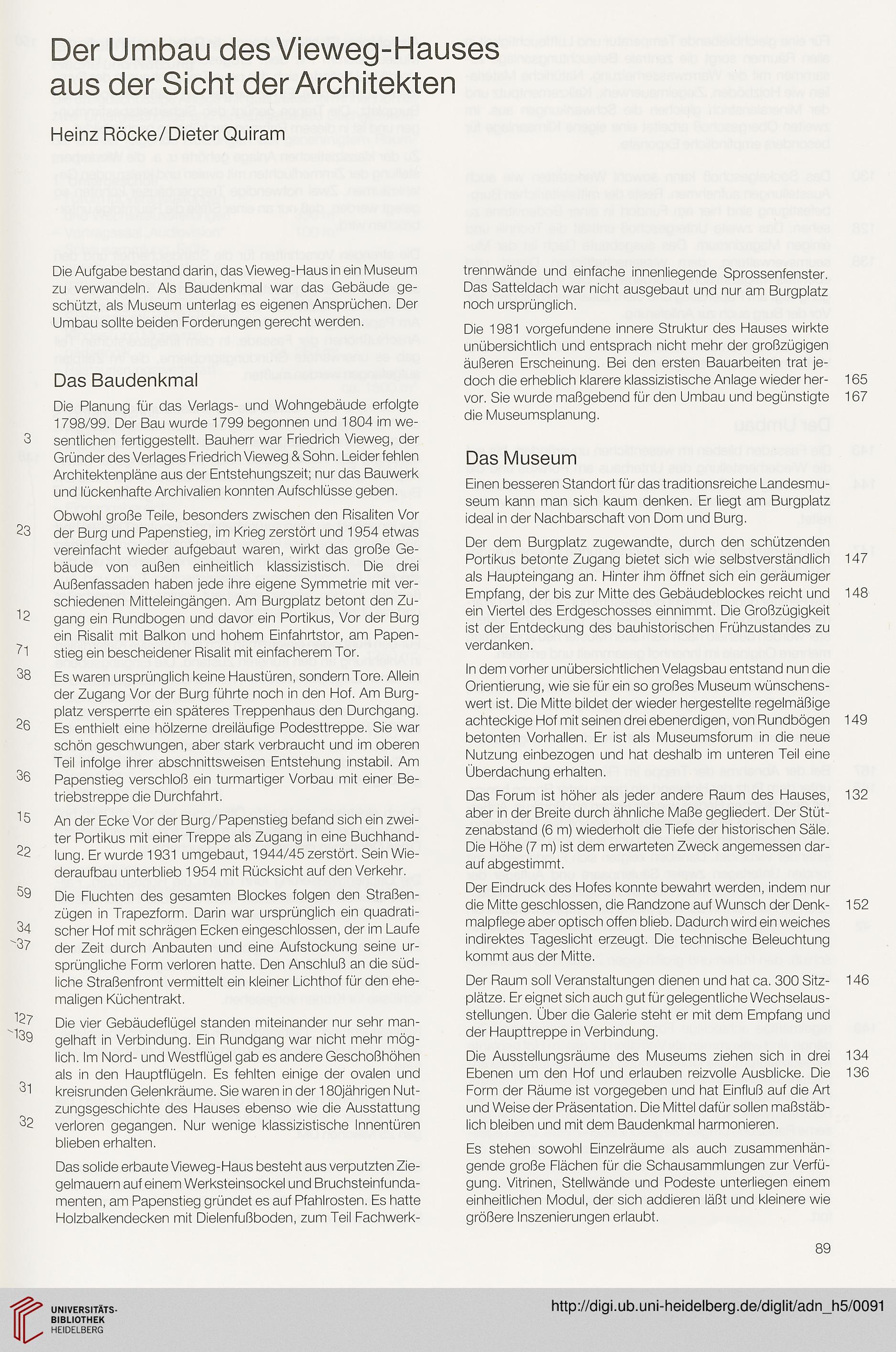3
23
12
71
38
26
36
15
22
59
34
'37
127
139
31
32
89
Der Umbau des Vieweg-Hauses
aus der Sicht der Architekten
Heinz Röcke/Dieter Quiram
Die Aufgabe bestand darin, das Vieweg-Haus in ein Museum
zu verwandeln. Als Baudenkmal war das Gebäude ge-
schützt, als Museum unterlag es eigenen Ansprüchen. Der
Umbau sollte beiden Forderungen gerecht werden.
Das Baudenkmal
Die Planung für das Verlags- und Wohngebäude erfolgte
1798/99. Der Bau wurde 1799 begonnen und 1804 im we-
sentlichen fertiggestellt. Bauherr war Friedrich Vieweg, der
Gründer des Verlages Friedrich Vieweg & Sohn. Leiderfehlen
Architektenpläne aus der Entstehungszeit; nur das Bauwerk
und lückenhafte Archivalien konnten Aufschlüsse geben.
Obwohl große Teile, besonders zwischen den Risaliten Vor
der Burg und Papenstieg, im Krieg zerstört und 1954 etwas
vereinfacht wieder aufgebaut waren, wirkt das große Ge-
bäude von außen einheitlich klassizistisch. Die drei
Außenfassaden haben jede ihre eigene Symmetrie mit ver-
schiedenen Mitteleingängen. Am Burgplatz betont den Zu-
gang ein Rundbogen und davor ein Portikus, Vor der Burg
ein Risalit mit Balkon und hohem Einfahrtstor, am Papen-
stieg ein bescheidener Risalit mit einfacherem Tor.
Es waren ursprünglich keine Haustüren, sondern Tore. Allein
der Zugang Vor der Burg führte noch in den Hof. Am Burg-
platz versperrte ein späteres Treppenhaus den Durchgang.
Es enthielt eine hölzerne dreiläufige Podesttreppe. Sie war
schön geschwungen, aber stark verbraucht und im oberen
Teil infolge ihrer abschnittsweisen Entstehung instabil. Am
Papenstieg verschloß ein turmartiger Vorbau mit einer Be-
triebstreppe die Durchfahrt.
An der Ecke Vor der Burg/Papenstieg befand sich ein zwei-
ter Portikus mit einer Treppe als Zugang in eine Buchhand-
lung. Er wurde 1931 umgebaut, 1944/45 zerstört. Sein Wie-
deraufbau unterblieb 1954 mit Rücksicht auf den Verkehr.
Die Fluchten des gesamten Blockes folgen den Straßen-
zügen in Trapezform. Darin war ursprünglich ein quadrati-
scher Hof mit schrägen Ecken eingeschlossen, der im Laufe
der Zeit durch Anbauten und eine Aufstockung seine ur-
sprüngliche Form verloren hatte. Den Anschluß an die süd-
liche Straßenfront vermittelt ein kleiner Lichthof für den ehe-
maligen Küchentrakt.
Die vier Gebäudeflügel standen miteinander nur sehr man-
gelhaft in Verbindung. Ein Rundgang war nicht mehr mög-
lich. Im Nord- und Westflügel gab es andere Geschoßhöhen
als in den Hauptflügeln. Es fehlten einige der ovalen und
kreisrunden Gelenkräume. Sie waren in der 180jährigen Nut-
zungsgeschichte des Hauses ebenso wie die Ausstattung
verloren gegangen. Nur wenige klassizistische Innentüren
blieben erhalten.
Das solide erbaute Vieweg-Haus besteht aus verputzten Zie-
gelmauern auf einem Werksteinsockel und Bruchsteinfunda-
menten, am Papenstieg gründet es auf Pfahlrosten. Es hatte
Holzbalkendecken mit Dielenfußboden, zum Teil Fachwerk-
trennwände und einfache innenliegende Sprossenfenster.
Das Satteldach war nicht ausgebaut und nur am Burgplatz
noch ursprünglich.
Die 1981 vorgefundene innere Struktur des Hauses wirkte
unübersichtlich und entsprach nicht mehr der großzügigen
äußeren Erscheinung. Bei den ersten Bauarbeiten trat je-
doch die erheblich klarere klassizistische Anlage wieder her-
vor. Sie wurde maßgebend für den Umbau und begünstigte
die Museumsplanung.
Das Museum
Einen besseren Standort für das traditionsreiche Landesmu-
seum kann man sich kaum denken. Er liegt am Burgplatz
ideal in der Nachbarschaft von Dom und Burg.
Der dem Burgplatz zugewandte, durch den schützenden
Portikus betonte Zugang bietet sich wie selbstverständlich
als Haupteingang an. Hinter ihm öffnet sich ein geräumiger
Empfang, der bis zur Mitte des Gebäudeblockes reicht und
ein Viertel des Erdgeschosses einnimmt. Die Großzügigkeit
ist der Entdeckung des bauhistorischen Frühzustandes zu
verdanken.
In dem vorher unübersichtlichen Velagsbau entstand nun die
Orientierung, wie sie für ein so großes Museum wünschens-
wert ist. Die Mitte bildet der wieder hergestellte regelmäßige
achteckige Hof mit seinen drei ebenerdigen, von Rundbögen
betonten Vorhallen. Er ist als Museumsforum in die neue
Nutzung einbezogen und hat deshalb im unteren Teil eine
Überdachung erhalten.
Das Forum ist höher als jeder andere Raum des Hauses,
aber in der Breite durch ähnliche Maße gegliedert. Der Stüt-
zenabstand (6 m) wiederholt die Tiefe der historischen Säle.
Die Höhe (7 m) ist dem erwarteten Zweck angemessen dar-
auf abgestimmt.
Der Eindruck des Hofes konnte bewahrt werden, indem nur
die Mitte geschlossen, die Randzone auf Wunsch der Denk-
malpflege aber optisch offen blieb. Dadurch wird ein weiches
indirektes Tageslicht erzeugt. Die technische Beleuchtung
kommt aus der Mitte.
Der Raum soll Veranstaltungen dienen und hat ca. 300 Sitz-
plätze. Er eignet sich auch gut für gelegentliche Wechselaus-
stellungen. Über die Galerie steht er mit dem Empfang und
der Haupttreppe in Verbindung.
Die Ausstellungsräume des Museums ziehen sich in drei
Ebenen um den Hof und erlauben reizvolle Ausblicke. Die
Form der Räume ist vorgegeben und hat Einfluß auf die Art
und Weise der Präsentation. Die Mittel dafür sollen maßstäb-
lich bleiben und mit dem Baudenkmal harmonieren.
Es stehen sowohl Einzelräume als auch zusammenhän-
gende große Flächen für die Schausammlungen zur Verfü-
gung. Vitrinen, Stellwände und Podeste unterliegen einem
einheitlichen Modul, der sich addieren läßt und kleinere wie
größere Inszenierungen erlaubt.
165
167
147
148
149
132
152
146
134
136
23
12
71
38
26
36
15
22
59
34
'37
127
139
31
32
89
Der Umbau des Vieweg-Hauses
aus der Sicht der Architekten
Heinz Röcke/Dieter Quiram
Die Aufgabe bestand darin, das Vieweg-Haus in ein Museum
zu verwandeln. Als Baudenkmal war das Gebäude ge-
schützt, als Museum unterlag es eigenen Ansprüchen. Der
Umbau sollte beiden Forderungen gerecht werden.
Das Baudenkmal
Die Planung für das Verlags- und Wohngebäude erfolgte
1798/99. Der Bau wurde 1799 begonnen und 1804 im we-
sentlichen fertiggestellt. Bauherr war Friedrich Vieweg, der
Gründer des Verlages Friedrich Vieweg & Sohn. Leiderfehlen
Architektenpläne aus der Entstehungszeit; nur das Bauwerk
und lückenhafte Archivalien konnten Aufschlüsse geben.
Obwohl große Teile, besonders zwischen den Risaliten Vor
der Burg und Papenstieg, im Krieg zerstört und 1954 etwas
vereinfacht wieder aufgebaut waren, wirkt das große Ge-
bäude von außen einheitlich klassizistisch. Die drei
Außenfassaden haben jede ihre eigene Symmetrie mit ver-
schiedenen Mitteleingängen. Am Burgplatz betont den Zu-
gang ein Rundbogen und davor ein Portikus, Vor der Burg
ein Risalit mit Balkon und hohem Einfahrtstor, am Papen-
stieg ein bescheidener Risalit mit einfacherem Tor.
Es waren ursprünglich keine Haustüren, sondern Tore. Allein
der Zugang Vor der Burg führte noch in den Hof. Am Burg-
platz versperrte ein späteres Treppenhaus den Durchgang.
Es enthielt eine hölzerne dreiläufige Podesttreppe. Sie war
schön geschwungen, aber stark verbraucht und im oberen
Teil infolge ihrer abschnittsweisen Entstehung instabil. Am
Papenstieg verschloß ein turmartiger Vorbau mit einer Be-
triebstreppe die Durchfahrt.
An der Ecke Vor der Burg/Papenstieg befand sich ein zwei-
ter Portikus mit einer Treppe als Zugang in eine Buchhand-
lung. Er wurde 1931 umgebaut, 1944/45 zerstört. Sein Wie-
deraufbau unterblieb 1954 mit Rücksicht auf den Verkehr.
Die Fluchten des gesamten Blockes folgen den Straßen-
zügen in Trapezform. Darin war ursprünglich ein quadrati-
scher Hof mit schrägen Ecken eingeschlossen, der im Laufe
der Zeit durch Anbauten und eine Aufstockung seine ur-
sprüngliche Form verloren hatte. Den Anschluß an die süd-
liche Straßenfront vermittelt ein kleiner Lichthof für den ehe-
maligen Küchentrakt.
Die vier Gebäudeflügel standen miteinander nur sehr man-
gelhaft in Verbindung. Ein Rundgang war nicht mehr mög-
lich. Im Nord- und Westflügel gab es andere Geschoßhöhen
als in den Hauptflügeln. Es fehlten einige der ovalen und
kreisrunden Gelenkräume. Sie waren in der 180jährigen Nut-
zungsgeschichte des Hauses ebenso wie die Ausstattung
verloren gegangen. Nur wenige klassizistische Innentüren
blieben erhalten.
Das solide erbaute Vieweg-Haus besteht aus verputzten Zie-
gelmauern auf einem Werksteinsockel und Bruchsteinfunda-
menten, am Papenstieg gründet es auf Pfahlrosten. Es hatte
Holzbalkendecken mit Dielenfußboden, zum Teil Fachwerk-
trennwände und einfache innenliegende Sprossenfenster.
Das Satteldach war nicht ausgebaut und nur am Burgplatz
noch ursprünglich.
Die 1981 vorgefundene innere Struktur des Hauses wirkte
unübersichtlich und entsprach nicht mehr der großzügigen
äußeren Erscheinung. Bei den ersten Bauarbeiten trat je-
doch die erheblich klarere klassizistische Anlage wieder her-
vor. Sie wurde maßgebend für den Umbau und begünstigte
die Museumsplanung.
Das Museum
Einen besseren Standort für das traditionsreiche Landesmu-
seum kann man sich kaum denken. Er liegt am Burgplatz
ideal in der Nachbarschaft von Dom und Burg.
Der dem Burgplatz zugewandte, durch den schützenden
Portikus betonte Zugang bietet sich wie selbstverständlich
als Haupteingang an. Hinter ihm öffnet sich ein geräumiger
Empfang, der bis zur Mitte des Gebäudeblockes reicht und
ein Viertel des Erdgeschosses einnimmt. Die Großzügigkeit
ist der Entdeckung des bauhistorischen Frühzustandes zu
verdanken.
In dem vorher unübersichtlichen Velagsbau entstand nun die
Orientierung, wie sie für ein so großes Museum wünschens-
wert ist. Die Mitte bildet der wieder hergestellte regelmäßige
achteckige Hof mit seinen drei ebenerdigen, von Rundbögen
betonten Vorhallen. Er ist als Museumsforum in die neue
Nutzung einbezogen und hat deshalb im unteren Teil eine
Überdachung erhalten.
Das Forum ist höher als jeder andere Raum des Hauses,
aber in der Breite durch ähnliche Maße gegliedert. Der Stüt-
zenabstand (6 m) wiederholt die Tiefe der historischen Säle.
Die Höhe (7 m) ist dem erwarteten Zweck angemessen dar-
auf abgestimmt.
Der Eindruck des Hofes konnte bewahrt werden, indem nur
die Mitte geschlossen, die Randzone auf Wunsch der Denk-
malpflege aber optisch offen blieb. Dadurch wird ein weiches
indirektes Tageslicht erzeugt. Die technische Beleuchtung
kommt aus der Mitte.
Der Raum soll Veranstaltungen dienen und hat ca. 300 Sitz-
plätze. Er eignet sich auch gut für gelegentliche Wechselaus-
stellungen. Über die Galerie steht er mit dem Empfang und
der Haupttreppe in Verbindung.
Die Ausstellungsräume des Museums ziehen sich in drei
Ebenen um den Hof und erlauben reizvolle Ausblicke. Die
Form der Räume ist vorgegeben und hat Einfluß auf die Art
und Weise der Präsentation. Die Mittel dafür sollen maßstäb-
lich bleiben und mit dem Baudenkmal harmonieren.
Es stehen sowohl Einzelräume als auch zusammenhän-
gende große Flächen für die Schausammlungen zur Verfü-
gung. Vitrinen, Stellwände und Podeste unterliegen einem
einheitlichen Modul, der sich addieren läßt und kleinere wie
größere Inszenierungen erlaubt.
165
167
147
148
149
132
152
146
134
136