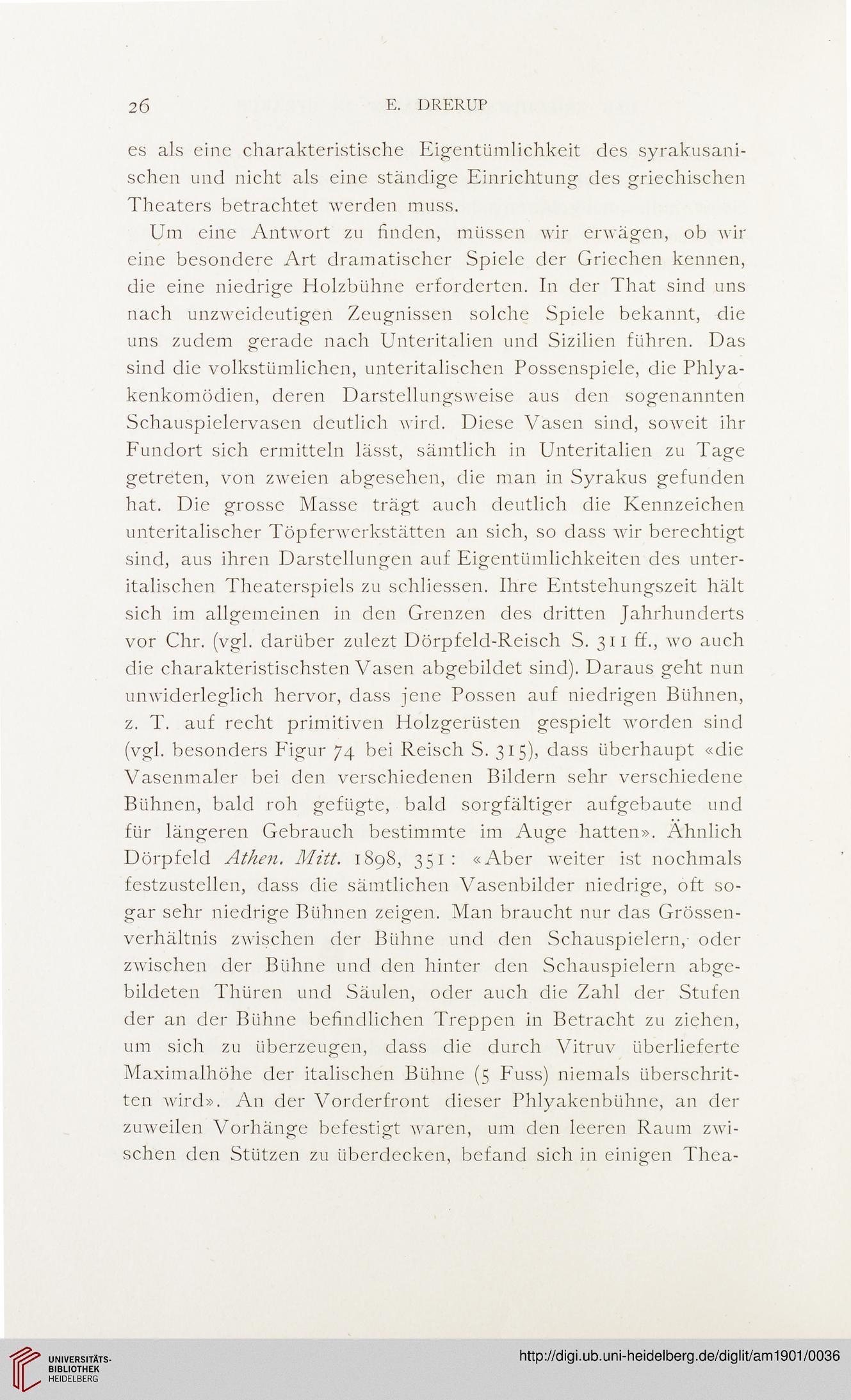2 6
E. DRERUP
es als eine charakteristische Eigentümlichkeit des syrakusani-
schen und nicht als eine ständige Einrichtung des griechischen
Theaters betrachtet werden muss.
Um eine Antwort zu finden, müssen wir erwägen, ob wir
eine besondere Art dramatischer Spiele der Griechen kennen,
die eine niedrige Holzbühne erforderten. In der That sind uns
nach unzweideutigen Zeugnissen solche Spiele bekannt, die
uns zudem gerade nach Unteritalien und Sizilien führen. Das
sind die volkstümlichen, unteritalischen Possenspiele, die Phlya-
kenkomödien, deren Darstellungsweise aus den sogenannten
Schauspielervasen deutlich wird. Diese Vasen sind, soweit ihr
Fundort sich ermitteln lässt, sämtlich in Unteritalien zu Tage
getreten, von zweien abgesehen, die man in Syrakus gefunden
hat. Die grosse Masse trägt auch deutlich die Kennzeichen
unteritalischer Töpferwerkstätten an sich, so dass wir berechtigt
sind, aus ihren Darstellungen auf Eigentümlichkeiten des unter-
italischen Theaterspiels zu schliessen. Ihre Entstehungszeit hält
sich im allgemeinen in den Grenzen des dritten Jahrhunderts
vor Chr. (vgl. darüber zulezt Dörpfeld-Reisch S. 311 ff., wo auch
die charakteristischsten Vasen abgebildet sind). Daraus geht nun
unwiderleglich hervor, dass jene Possen auf niedrigen Bühnen,
z. T. auf recht primitiven Holzgerüsten gespielt worden sind
(vgl. besonders Figur 74 bei Reisch S. 315), dass überhaupt «die
Vasenmaler bei den verschiedenen Bildern sehr verschiedene
Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger aufgebaute und
für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten». Ähnlich
Dörpfeld Athen. Mitt. 1898, 351: «Aber weiter ist nochmals
festzustellen, dass die sämtlichen Vasenbilder niedrige, oft so-
gar sehr niedrige Bühnen zeigen. Man braucht nur das Grössen-
verhältnis zwischen der Bühne und den Schauspielern,· oder
zwischen der Bühne und den hinter den Schauspielern abge-
bildeten Thüren und Säulen, oder auch die Zahl der Stufen
der an der Bühne befindlichen Treppen in Betracht zu ziehen,
um sich zu überzeugen, dass die durch Vitruv überlieferte
Maximalhöhe der italischen Bühne (5 Fuss) niemals überschrit-
ten wird». An der Vorderfront dieser Phlyakenbühne, an der
zuweilen Vorhänge befestigt waren, um den leeren Raum zwi-
schen den Stützen zu überdecken, befand sich in einigen Thea-
E. DRERUP
es als eine charakteristische Eigentümlichkeit des syrakusani-
schen und nicht als eine ständige Einrichtung des griechischen
Theaters betrachtet werden muss.
Um eine Antwort zu finden, müssen wir erwägen, ob wir
eine besondere Art dramatischer Spiele der Griechen kennen,
die eine niedrige Holzbühne erforderten. In der That sind uns
nach unzweideutigen Zeugnissen solche Spiele bekannt, die
uns zudem gerade nach Unteritalien und Sizilien führen. Das
sind die volkstümlichen, unteritalischen Possenspiele, die Phlya-
kenkomödien, deren Darstellungsweise aus den sogenannten
Schauspielervasen deutlich wird. Diese Vasen sind, soweit ihr
Fundort sich ermitteln lässt, sämtlich in Unteritalien zu Tage
getreten, von zweien abgesehen, die man in Syrakus gefunden
hat. Die grosse Masse trägt auch deutlich die Kennzeichen
unteritalischer Töpferwerkstätten an sich, so dass wir berechtigt
sind, aus ihren Darstellungen auf Eigentümlichkeiten des unter-
italischen Theaterspiels zu schliessen. Ihre Entstehungszeit hält
sich im allgemeinen in den Grenzen des dritten Jahrhunderts
vor Chr. (vgl. darüber zulezt Dörpfeld-Reisch S. 311 ff., wo auch
die charakteristischsten Vasen abgebildet sind). Daraus geht nun
unwiderleglich hervor, dass jene Possen auf niedrigen Bühnen,
z. T. auf recht primitiven Holzgerüsten gespielt worden sind
(vgl. besonders Figur 74 bei Reisch S. 315), dass überhaupt «die
Vasenmaler bei den verschiedenen Bildern sehr verschiedene
Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger aufgebaute und
für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten». Ähnlich
Dörpfeld Athen. Mitt. 1898, 351: «Aber weiter ist nochmals
festzustellen, dass die sämtlichen Vasenbilder niedrige, oft so-
gar sehr niedrige Bühnen zeigen. Man braucht nur das Grössen-
verhältnis zwischen der Bühne und den Schauspielern,· oder
zwischen der Bühne und den hinter den Schauspielern abge-
bildeten Thüren und Säulen, oder auch die Zahl der Stufen
der an der Bühne befindlichen Treppen in Betracht zu ziehen,
um sich zu überzeugen, dass die durch Vitruv überlieferte
Maximalhöhe der italischen Bühne (5 Fuss) niemals überschrit-
ten wird». An der Vorderfront dieser Phlyakenbühne, an der
zuweilen Vorhänge befestigt waren, um den leeren Raum zwi-
schen den Stützen zu überdecken, befand sich in einigen Thea-