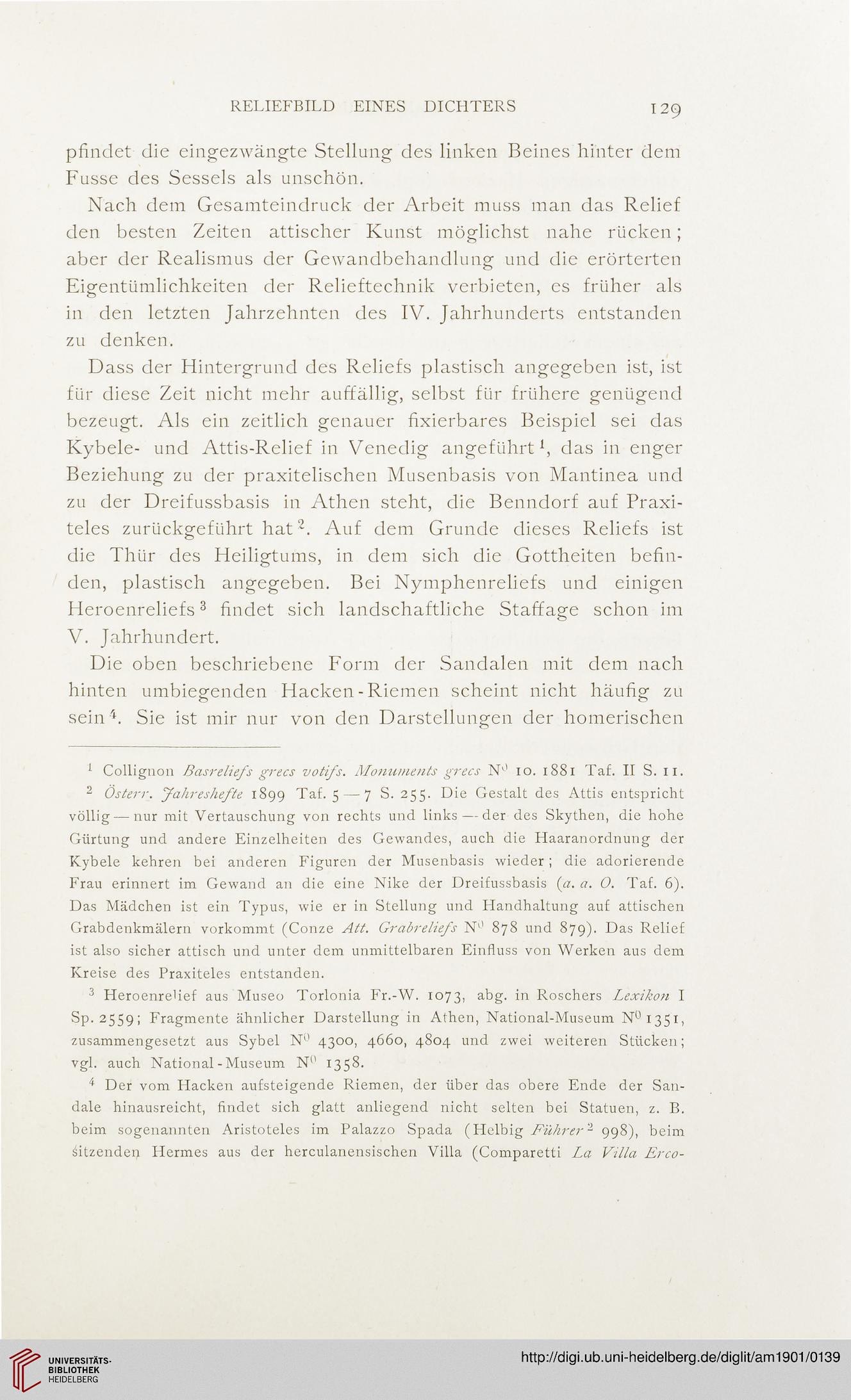RELIEFBILD EINES DICHTERS
129
pfinclet die eingezwängte Stellung des linken Beines hinter dem
Fusse des Sessels als unschön.
Nach dem Gesamteindruck der Arbeit muss man das Relief
den besten Zeiten attischer Kunst möglichst nahe rücken;
aber der Realismus der Gewandbehandlung und die erörterten
Eigentümlichkeiten der Relieftechnik verbieten, es früher als
in den letzten Jahrzehnten des IV. Jahrhunderts entstanden
zu denken.
Dass der Hintergrund des Reliefs plastisch angegeben ist, ist
für diese Zeit nicht mehr auffällig, selbst für frühere genügend
bezeugt. Als ein zeitlich genauer fixierbares Beispiel sei das
Ivybele- und Attis-Relief in Venedig angeführt1, das in enger
Beziehung zu der praxitelischen Musenbasis von Mantinea und
zu der Dreifussbasis in Athen steht, die Benndorf auf Praxi-
teles zurückgeführt hat2. Auf dem Grunde dieses Reliefs ist
die Thür des Heiligtums, in dem sich die Gottheiten befin-
den, plastisch angegeben. Bei Nymphenreliefs und einigen
Heroenreliefs3 findet sich landschaftliche Staffage schon im
V. Jahrhundert.
Die oben beschriebene Form der Sandalen mit dem nach
hinten umbiegenden Hacken - Riemen scheint nicht häufig zu
sein4. Sie ist mir nur von den Darstellungen der homerischen
1 Collignon Basreliefs grecs votifs. Monuments grecs N'-' 10. 1881 Taf. II S. 11.
2 Österr. Jahreshefte 1899 Taf. 5 — 7 S. 255. Die Gestalt des Attis entspricht
völlig — nur mit Vertauschung von rechts und links — der des Skythen, die hohe
Gurtung und andere Einzelheiten des Gewandes, auch die Haaranordnung der
Kybele kehren bei anderen Figuren der Musenbasis wieder; die adorierende
Frau erinnert im Gewand an die eine Nike der Dreifussbasis (a. a. 0. Taf. 6).
Das Mädchen ist ein Typus, wie er in Stellung und Handhaltung auf attischen
Grabdenkmälern vorkommt (Conze Att. Grabreliefs N° 878 und 879). Das Relief
ist also sicher attisch und unter dem unmittelbaren Einfluss von Werken aus dem
Kreise des Praxiteles entstanden.
3 Heroenrelief aus Museo Torlonia Fr.-W. 1073, abg. in Roschers Lexikon I
Sp. 2559; Fragmente ähnlicher Darstellung in Athen, National-Museum N°I35i,
zusammengesetzt aus Sybel N° 4300, 4660, 4804 und zwei weiteren Stücken;
vgl. auch National-Museum N° 135S·
4 Der vom Placken aufsteigende Riemen, der über das obere Ende der San-
dale hinausreicht, findet sich glatt anliegend nicht selten bei Statuen, z. B.
beim sogenannten Aristoteles im Palazzo Spada (Helbig Führer2 998), beim
Ritzenden Hermes aus der herculanensischen Villa (Comparetti La Villa Erco-
129
pfinclet die eingezwängte Stellung des linken Beines hinter dem
Fusse des Sessels als unschön.
Nach dem Gesamteindruck der Arbeit muss man das Relief
den besten Zeiten attischer Kunst möglichst nahe rücken;
aber der Realismus der Gewandbehandlung und die erörterten
Eigentümlichkeiten der Relieftechnik verbieten, es früher als
in den letzten Jahrzehnten des IV. Jahrhunderts entstanden
zu denken.
Dass der Hintergrund des Reliefs plastisch angegeben ist, ist
für diese Zeit nicht mehr auffällig, selbst für frühere genügend
bezeugt. Als ein zeitlich genauer fixierbares Beispiel sei das
Ivybele- und Attis-Relief in Venedig angeführt1, das in enger
Beziehung zu der praxitelischen Musenbasis von Mantinea und
zu der Dreifussbasis in Athen steht, die Benndorf auf Praxi-
teles zurückgeführt hat2. Auf dem Grunde dieses Reliefs ist
die Thür des Heiligtums, in dem sich die Gottheiten befin-
den, plastisch angegeben. Bei Nymphenreliefs und einigen
Heroenreliefs3 findet sich landschaftliche Staffage schon im
V. Jahrhundert.
Die oben beschriebene Form der Sandalen mit dem nach
hinten umbiegenden Hacken - Riemen scheint nicht häufig zu
sein4. Sie ist mir nur von den Darstellungen der homerischen
1 Collignon Basreliefs grecs votifs. Monuments grecs N'-' 10. 1881 Taf. II S. 11.
2 Österr. Jahreshefte 1899 Taf. 5 — 7 S. 255. Die Gestalt des Attis entspricht
völlig — nur mit Vertauschung von rechts und links — der des Skythen, die hohe
Gurtung und andere Einzelheiten des Gewandes, auch die Haaranordnung der
Kybele kehren bei anderen Figuren der Musenbasis wieder; die adorierende
Frau erinnert im Gewand an die eine Nike der Dreifussbasis (a. a. 0. Taf. 6).
Das Mädchen ist ein Typus, wie er in Stellung und Handhaltung auf attischen
Grabdenkmälern vorkommt (Conze Att. Grabreliefs N° 878 und 879). Das Relief
ist also sicher attisch und unter dem unmittelbaren Einfluss von Werken aus dem
Kreise des Praxiteles entstanden.
3 Heroenrelief aus Museo Torlonia Fr.-W. 1073, abg. in Roschers Lexikon I
Sp. 2559; Fragmente ähnlicher Darstellung in Athen, National-Museum N°I35i,
zusammengesetzt aus Sybel N° 4300, 4660, 4804 und zwei weiteren Stücken;
vgl. auch National-Museum N° 135S·
4 Der vom Placken aufsteigende Riemen, der über das obere Ende der San-
dale hinausreicht, findet sich glatt anliegend nicht selten bei Statuen, z. B.
beim sogenannten Aristoteles im Palazzo Spada (Helbig Führer2 998), beim
Ritzenden Hermes aus der herculanensischen Villa (Comparetti La Villa Erco-