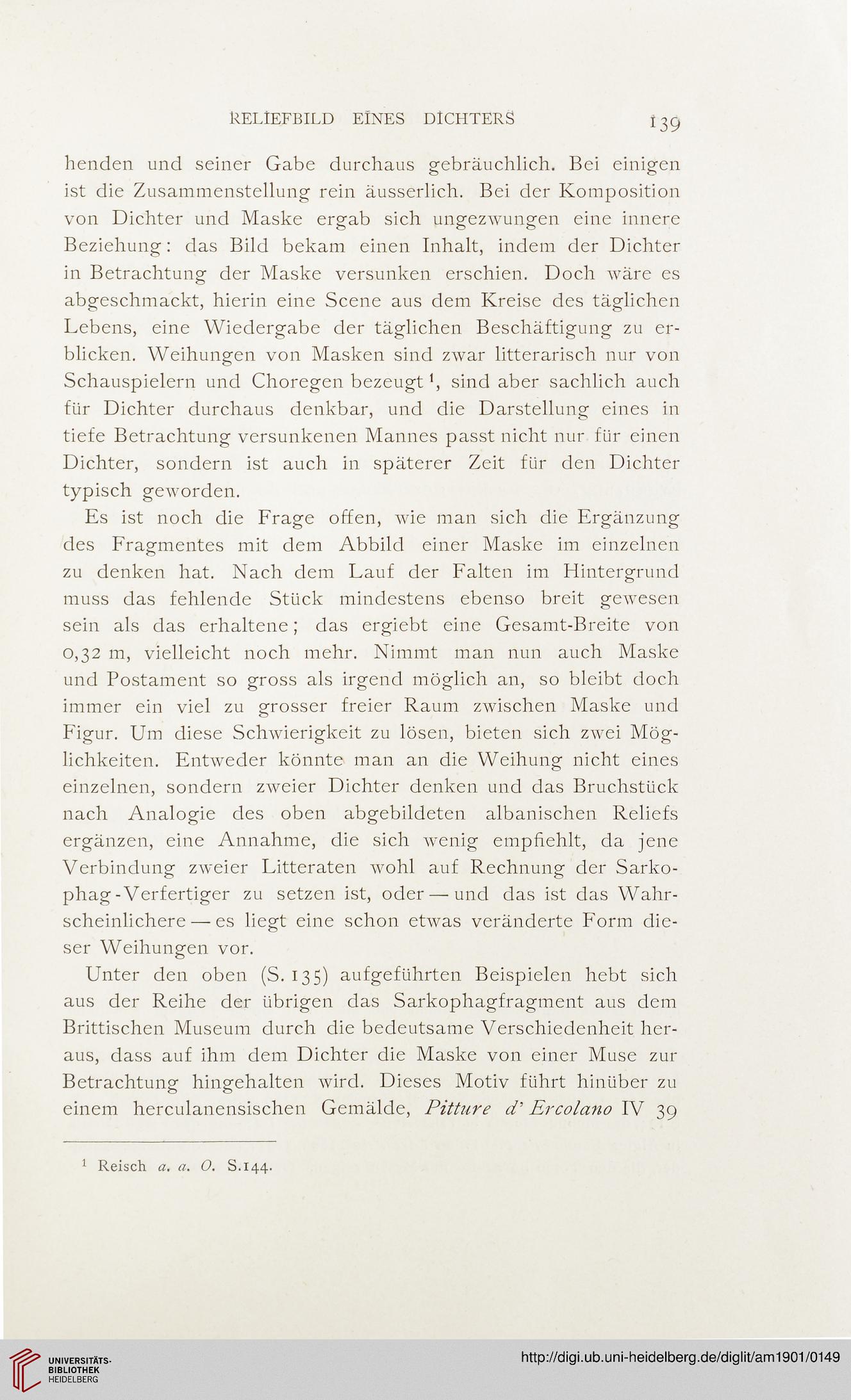RELIEFBILD EINES DICHTERS
139
henden und seiner Gabe durchaus gebräuchlich. Bei einigen
ist die Zusammenstellung rein äusserlich. Bei der Komposition
von Dichter und Maske ergab sich ungezwungen eine innere
Beziehung: das Bild bekam einen Inhalt, indem der Dichter
in Betrachtung der Maske versunken erschien. Doch wäre es
abgeschmackt, hierin eine Scene aus dem Kreise des täglichen
Lebens, eine Wiedergabe der täglichen Beschäftigung zu er-
blicken. Weihungen von Masken sind zwar litterarisch nur von
Schauspielern und Choregen bezeugt ’, sind aber sachlich auch
für Dichter durchaus denkbar, und die Darstellung eines in
tiefe Betrachtung versunkenen Mannes passt nicht nur für einen
Dichter, sondern ist auch in späterer Zeit für den Dichter
typisch geworden.
Es ist noch die Frage offen, wie man sich die Ergänzung
des Fragmentes mit dem Abbild einer Maske im einzelnen
zu denken hat. Nach dem Lauf der Falten im Hintergrund
muss das fehlende Stück mindestens ebenso breit gewesen
sein als das erhaltene; das ergiebt eine Gesamt-Breite von
0,32 m, vielleicht noch mehr. Nimmt man nun auch Maske
und Postament so gross als irgend möglich an, so bleibt doch
immer ein viel zu grosser freier Raum zwischen Maske und
Figur. Um diese Schwierigkeit zu lösen, bieten sich zwei Mög-
lichkeiten. Entweder könnte man an die Weihung nicht eines
einzelnen, sondern zweier Dichter denken und das Bruchstück
nach Analogie des oben abgebildeten albanischen Reliefs
ergänzen, eine Annahme, die sich wenig empfiehlt, da jene
Verbindung zweier Litteraten wohl auf Rechnung der Sarko-
phag-Verfertiger zu setzen ist, oder — und das ist das Wahr-
scheinlichere·— es liegt eine schon etwas veränderte Form die-
ser Weihungen vor.
Unter den oben (S. 135) aufgeführten Beispielen hebt sich
aus der Reihe der übrigen das Sarkophagfragment aus dem
Brittischen Museum durch die bedeutsame Verschiedenheit her-
aus, dass auf ihm dem Dichter die Maske von einer Muse zur
Betrachtung hingehalten wird. Dieses Motiv führt hinüber zu
einem herculanensischen Gemälde, Pitture d’ Ercolano IV 39
1 Reisch a. a. O. 8.144.
139
henden und seiner Gabe durchaus gebräuchlich. Bei einigen
ist die Zusammenstellung rein äusserlich. Bei der Komposition
von Dichter und Maske ergab sich ungezwungen eine innere
Beziehung: das Bild bekam einen Inhalt, indem der Dichter
in Betrachtung der Maske versunken erschien. Doch wäre es
abgeschmackt, hierin eine Scene aus dem Kreise des täglichen
Lebens, eine Wiedergabe der täglichen Beschäftigung zu er-
blicken. Weihungen von Masken sind zwar litterarisch nur von
Schauspielern und Choregen bezeugt ’, sind aber sachlich auch
für Dichter durchaus denkbar, und die Darstellung eines in
tiefe Betrachtung versunkenen Mannes passt nicht nur für einen
Dichter, sondern ist auch in späterer Zeit für den Dichter
typisch geworden.
Es ist noch die Frage offen, wie man sich die Ergänzung
des Fragmentes mit dem Abbild einer Maske im einzelnen
zu denken hat. Nach dem Lauf der Falten im Hintergrund
muss das fehlende Stück mindestens ebenso breit gewesen
sein als das erhaltene; das ergiebt eine Gesamt-Breite von
0,32 m, vielleicht noch mehr. Nimmt man nun auch Maske
und Postament so gross als irgend möglich an, so bleibt doch
immer ein viel zu grosser freier Raum zwischen Maske und
Figur. Um diese Schwierigkeit zu lösen, bieten sich zwei Mög-
lichkeiten. Entweder könnte man an die Weihung nicht eines
einzelnen, sondern zweier Dichter denken und das Bruchstück
nach Analogie des oben abgebildeten albanischen Reliefs
ergänzen, eine Annahme, die sich wenig empfiehlt, da jene
Verbindung zweier Litteraten wohl auf Rechnung der Sarko-
phag-Verfertiger zu setzen ist, oder — und das ist das Wahr-
scheinlichere·— es liegt eine schon etwas veränderte Form die-
ser Weihungen vor.
Unter den oben (S. 135) aufgeführten Beispielen hebt sich
aus der Reihe der übrigen das Sarkophagfragment aus dem
Brittischen Museum durch die bedeutsame Verschiedenheit her-
aus, dass auf ihm dem Dichter die Maske von einer Muse zur
Betrachtung hingehalten wird. Dieses Motiv führt hinüber zu
einem herculanensischen Gemälde, Pitture d’ Ercolano IV 39
1 Reisch a. a. O. 8.144.