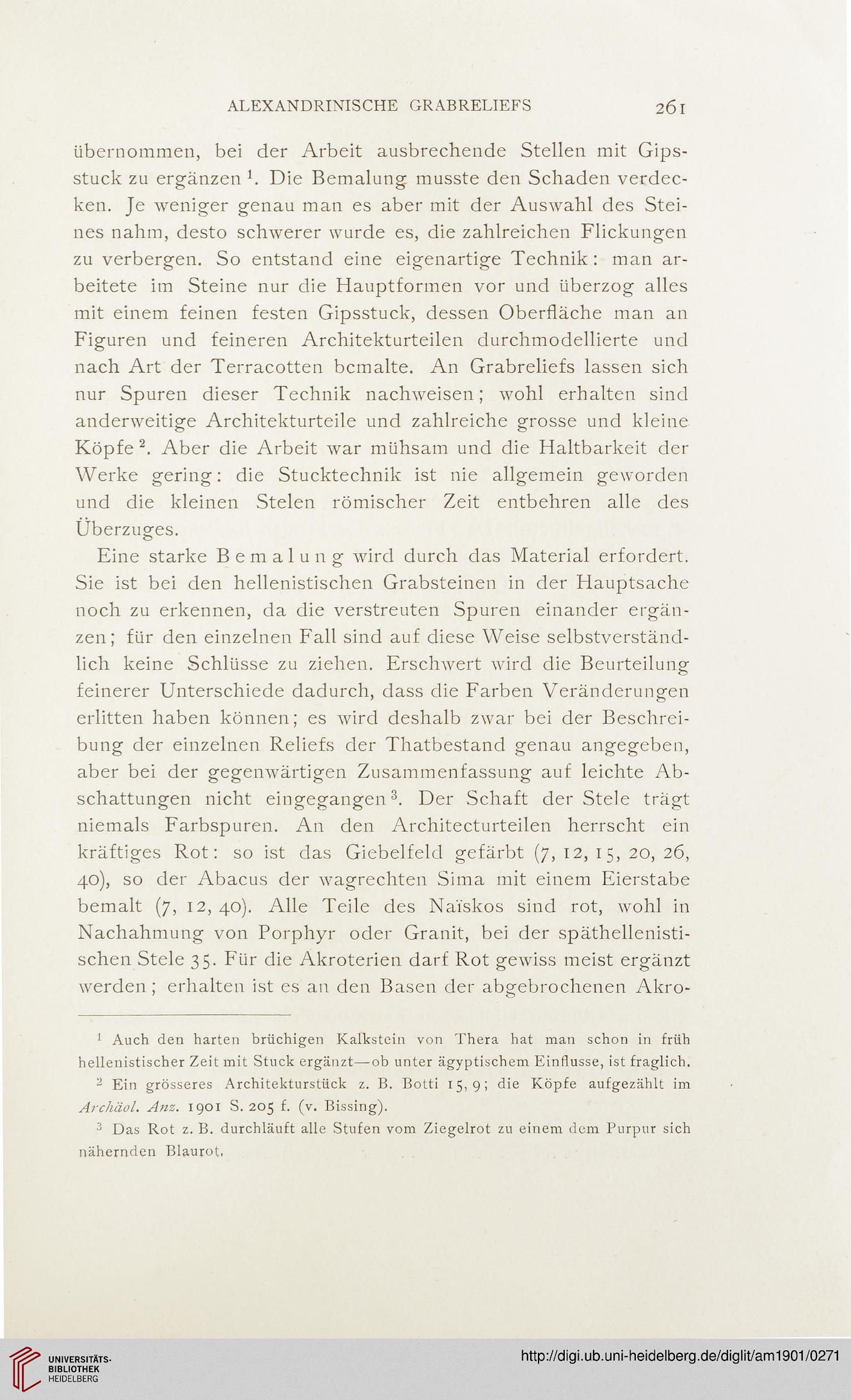ALEXANDRINISCHE GRABRELIEFS
201
übernommen, bei der Arbeit ausbrechende Stellen mit Gips-
stuck zu ergänzen 1. Die Bemalung musste den Schaden verdec-
ken. Je weniger genau man es aber mit der Auswahl des Stei-
nes nahm, desto schwerer wurde es, die zahlreichen Flickungen
zu verbergen. So entstand eine eigenartige Technik: man ar-
beitete im Steine nur die Hauptformen vor und überzog alles
mit einem feinen festen Gipsstuck, dessen Oberfläche man an
Figuren und feineren Architekturteilen durchmodellierte und
nach Art der Terracotten bemalte. An Grabreliefs lassen sich
nur Spuren dieser Technik nachweisen; wohl erhalten sind
anderweitige Architekturteile und zahlreiche grosse und kleine
Köpfe 2. Aber die Arbeit war mühsam und die Haltbarkeit der
Werke gering: die Stucktechnik ist nie allgemein geworden
und die kleinen Stelen römischer Zeit entbehren alle des
Überzuges.
Eine starke Bemalung wird durch das Material erfordert.
Sie ist bei den hellenistischen Grabsteinen in der Flauptsache
noch zu erkennen, da die verstreuten Spuren einander ergän-
zen; für den einzelnen Fall sind auf diese Weise selbstverständ-
lich keine Schlüsse zu ziehen. Erschwert wird die Beurteilung
feinerer Unterschiede dadurch, dass die Farben Veränderungen
erlitten haben können; es wird deshalb zwar bei der Beschrei-
bung der einzelnen Reliefs der Thatbestand genau angegeben,
aber bei der gegenwärtigen Zusammenfassung auf leichte Ab-
schattungen nicht eingegangen3. Der Schaft der Stele trägt
niemals Farbspuren. A11 den Architecturteilen herrscht ein
kräftiges Rot: so ist das Giebelfeld gefärbt (7, 12, 15, 20, 26,
40), so der Abacus der wagrechten Sima mit einem Eierstabe
bemalt (7, 12,40). Alle Teile des Nai'skos sind rot, wohl in
Nachahmung von Porphyr oder Granit, bei der späthellenisti-
schen Stele 35. Für die Akroterien darf Rot gewiss meist ergänzt
werden ; erhalten ist es an den Basen der abgebrochenen Akro-
1 Auch den harten brüchigen Kalkstein von Thera hat man schon in früh
hellenistischer Zeit mit Stuck ergänzt—ob unter ägyptischem Einflüsse, ist fraglich.
2 Ein grösseres Architekturstück z. B. Botti 15,9; die Köpfe aufgezählt im
Archäol. Anz. 1901 S. 205 f. (v. Bissing).
3 Das Rot z. B. durchläuft alle Stufen vom Ziegelrot zu einem dem Purpur sich
nähernden Blaurot.
201
übernommen, bei der Arbeit ausbrechende Stellen mit Gips-
stuck zu ergänzen 1. Die Bemalung musste den Schaden verdec-
ken. Je weniger genau man es aber mit der Auswahl des Stei-
nes nahm, desto schwerer wurde es, die zahlreichen Flickungen
zu verbergen. So entstand eine eigenartige Technik: man ar-
beitete im Steine nur die Hauptformen vor und überzog alles
mit einem feinen festen Gipsstuck, dessen Oberfläche man an
Figuren und feineren Architekturteilen durchmodellierte und
nach Art der Terracotten bemalte. An Grabreliefs lassen sich
nur Spuren dieser Technik nachweisen; wohl erhalten sind
anderweitige Architekturteile und zahlreiche grosse und kleine
Köpfe 2. Aber die Arbeit war mühsam und die Haltbarkeit der
Werke gering: die Stucktechnik ist nie allgemein geworden
und die kleinen Stelen römischer Zeit entbehren alle des
Überzuges.
Eine starke Bemalung wird durch das Material erfordert.
Sie ist bei den hellenistischen Grabsteinen in der Flauptsache
noch zu erkennen, da die verstreuten Spuren einander ergän-
zen; für den einzelnen Fall sind auf diese Weise selbstverständ-
lich keine Schlüsse zu ziehen. Erschwert wird die Beurteilung
feinerer Unterschiede dadurch, dass die Farben Veränderungen
erlitten haben können; es wird deshalb zwar bei der Beschrei-
bung der einzelnen Reliefs der Thatbestand genau angegeben,
aber bei der gegenwärtigen Zusammenfassung auf leichte Ab-
schattungen nicht eingegangen3. Der Schaft der Stele trägt
niemals Farbspuren. A11 den Architecturteilen herrscht ein
kräftiges Rot: so ist das Giebelfeld gefärbt (7, 12, 15, 20, 26,
40), so der Abacus der wagrechten Sima mit einem Eierstabe
bemalt (7, 12,40). Alle Teile des Nai'skos sind rot, wohl in
Nachahmung von Porphyr oder Granit, bei der späthellenisti-
schen Stele 35. Für die Akroterien darf Rot gewiss meist ergänzt
werden ; erhalten ist es an den Basen der abgebrochenen Akro-
1 Auch den harten brüchigen Kalkstein von Thera hat man schon in früh
hellenistischer Zeit mit Stuck ergänzt—ob unter ägyptischem Einflüsse, ist fraglich.
2 Ein grösseres Architekturstück z. B. Botti 15,9; die Köpfe aufgezählt im
Archäol. Anz. 1901 S. 205 f. (v. Bissing).
3 Das Rot z. B. durchläuft alle Stufen vom Ziegelrot zu einem dem Purpur sich
nähernden Blaurot.