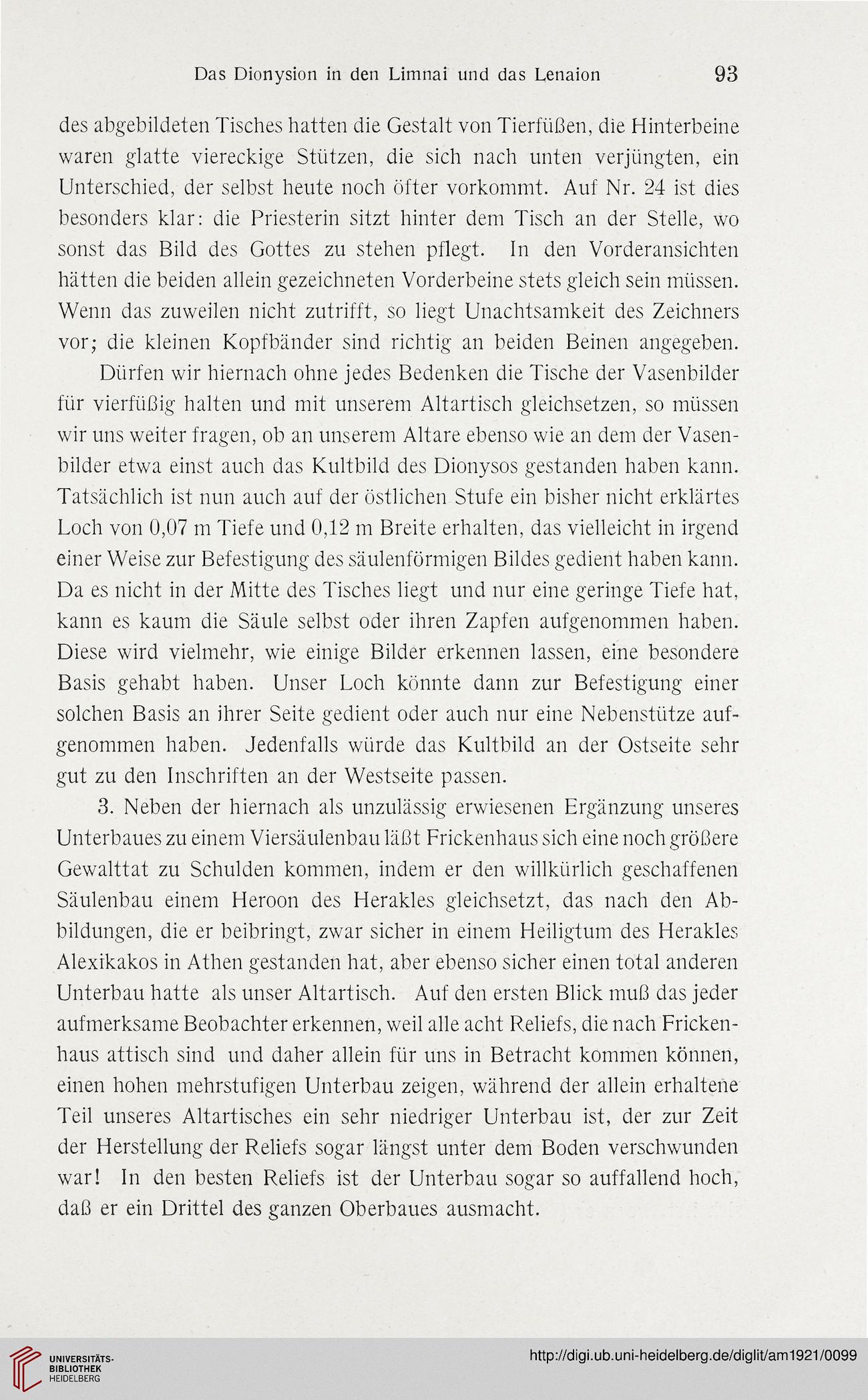Das Dionysion in den Limnai und das Lenaion
93
des abgebildeten Tisches hatten die Gestalt von Tierfüßen, die Hinterbeine
waren glatte viereckige Stützen, die sich nach unten verjüngten, ein
Unterschied, der selbst heute noch öfter vorkommt. Auf Nr. 24 ist dies
besonders klar: die Priesterin sitzt hinter dem Tisch an der Stelle, wo
sonst das Bild des Gottes zu stehen pflegt. In den Vorderansichten
hätten die beiden allein gezeichneten Vorderbeine stets gleich sein müssen.
Wenn das zuweilen nicht zutrifft, so liegt Unachtsamkeit des Zeichners
vor; die kleinen Kopfbänder sind richtig an beiden Beinen angegeben.
Dürfen wir hiernach ohne jedes Bedenken die Tische der Vasenbilder
für vierfüßig halten und mit unserem Altartisch gleichsetzen, so müssen
wir uns weiter fragen, ob an unserem Altare ebenso wie an dem der Vasen-
bilder etwa einst auch das Kultbild des Dionysos gestanden haben kann.
Tatsächlich ist nun auch auf der östlichen Stufe ein bisher nicht erklärtes
Loch von 0,07 m Tiefe und 0,12 m Breite erhalten, das vielleicht in irgend
einer Weise zur Befestigung des säulenförmigen Bildes gedient haben kann.
Da es nicht in der Mitte des Tisches liegt und nur eine geringe Tiefe hat,
kann es kaum die Säule selbst oder ihren Zapfen aufgenommen haben.
Diese wird vielmehr, wie einige Bilder erkennen lassen, eine besondere
Basis gehabt haben. Unser Loch könnte dann zur Befestigung einer
solchen Basis an ihrer Seite gedient oder auch nur eine Nebenstütze auf-
genommen haben. Jedenfalls würde das Kultbild an der Ostseite sehr
gut zu den Inschriften an der Westseite passen.
3. Neben der hiernach als unzulässig erwiesenen Ergänzung unseres
Unterbaues zu einem Viersäulenbau läßt Frickenhaus sich eine noch größere
Gewalttat zu Schulden kommen, indem er den willkürlich geschaffenen
Säulenbau einem Heroon des Herakles gleichsetzt, das nach den Ab-
bildungen, die er beibringt, zwar sicher in einem Heiligtum des Herakles
Alexikakos in Athen gestanden hat, aber ebenso sicher einen total anderen
Unterbau hatte als unser Altartisch. Auf den ersten Blick muß das jeder
aufmerksame Beobachter erkennen, weil alle acht Reliefs, die nach Fricken-
haus attisch sind und daher allein für uns in Betracht kommen können,
einen hohen mehrstufigen Unterbau zeigen, während der allein erhaltene
Teil unseres Altartisches ein sehr niedriger Unterbau ist, der zur Zeit
der Herstellung der Reliefs sogar längst unter dem Boden verschwunden
war! In den besten Reliefs ist der Unterbau sogar so auffallend hoch,
daß er ein Drittel des ganzen Oberbaues ausmacht.
93
des abgebildeten Tisches hatten die Gestalt von Tierfüßen, die Hinterbeine
waren glatte viereckige Stützen, die sich nach unten verjüngten, ein
Unterschied, der selbst heute noch öfter vorkommt. Auf Nr. 24 ist dies
besonders klar: die Priesterin sitzt hinter dem Tisch an der Stelle, wo
sonst das Bild des Gottes zu stehen pflegt. In den Vorderansichten
hätten die beiden allein gezeichneten Vorderbeine stets gleich sein müssen.
Wenn das zuweilen nicht zutrifft, so liegt Unachtsamkeit des Zeichners
vor; die kleinen Kopfbänder sind richtig an beiden Beinen angegeben.
Dürfen wir hiernach ohne jedes Bedenken die Tische der Vasenbilder
für vierfüßig halten und mit unserem Altartisch gleichsetzen, so müssen
wir uns weiter fragen, ob an unserem Altare ebenso wie an dem der Vasen-
bilder etwa einst auch das Kultbild des Dionysos gestanden haben kann.
Tatsächlich ist nun auch auf der östlichen Stufe ein bisher nicht erklärtes
Loch von 0,07 m Tiefe und 0,12 m Breite erhalten, das vielleicht in irgend
einer Weise zur Befestigung des säulenförmigen Bildes gedient haben kann.
Da es nicht in der Mitte des Tisches liegt und nur eine geringe Tiefe hat,
kann es kaum die Säule selbst oder ihren Zapfen aufgenommen haben.
Diese wird vielmehr, wie einige Bilder erkennen lassen, eine besondere
Basis gehabt haben. Unser Loch könnte dann zur Befestigung einer
solchen Basis an ihrer Seite gedient oder auch nur eine Nebenstütze auf-
genommen haben. Jedenfalls würde das Kultbild an der Ostseite sehr
gut zu den Inschriften an der Westseite passen.
3. Neben der hiernach als unzulässig erwiesenen Ergänzung unseres
Unterbaues zu einem Viersäulenbau läßt Frickenhaus sich eine noch größere
Gewalttat zu Schulden kommen, indem er den willkürlich geschaffenen
Säulenbau einem Heroon des Herakles gleichsetzt, das nach den Ab-
bildungen, die er beibringt, zwar sicher in einem Heiligtum des Herakles
Alexikakos in Athen gestanden hat, aber ebenso sicher einen total anderen
Unterbau hatte als unser Altartisch. Auf den ersten Blick muß das jeder
aufmerksame Beobachter erkennen, weil alle acht Reliefs, die nach Fricken-
haus attisch sind und daher allein für uns in Betracht kommen können,
einen hohen mehrstufigen Unterbau zeigen, während der allein erhaltene
Teil unseres Altartisches ein sehr niedriger Unterbau ist, der zur Zeit
der Herstellung der Reliefs sogar längst unter dem Boden verschwunden
war! In den besten Reliefs ist der Unterbau sogar so auffallend hoch,
daß er ein Drittel des ganzen Oberbaues ausmacht.