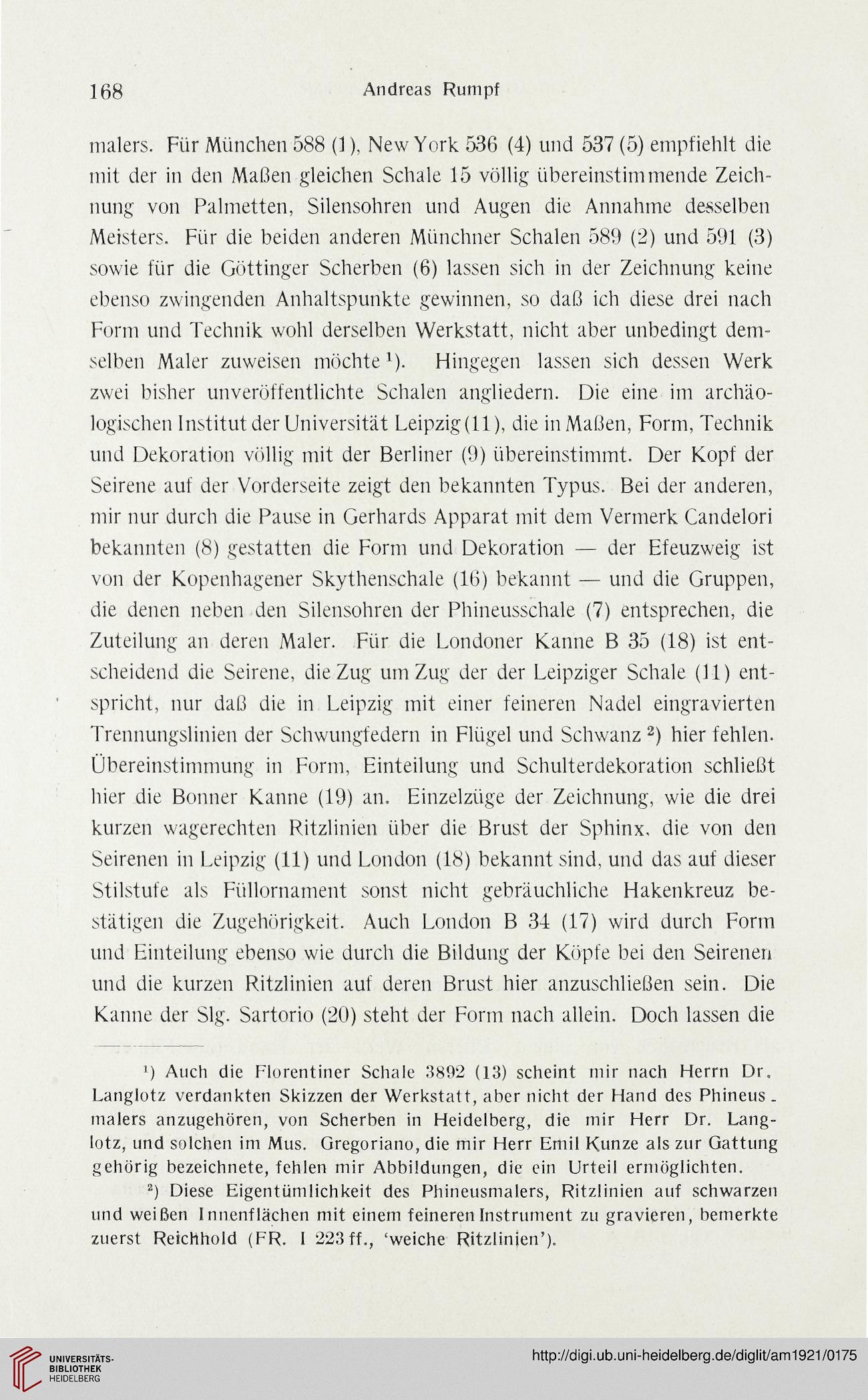168
Andreas Rumpf
malers. Fiir München 588 (1), New York 536 (4) und 537 (5) empfiehlt die
mit der in den Maßen gleichen Schale 15 völlig übereinstimmende Zeich-
nung von Palmetten, Silensohren utid Augen die Annahme desselben
Meisters. Fiir die beiden anderen Münchner Schalen 589 (2) und 591 (3)
sowie fiir die Göttinger Scherben (6) lassen sich in der Zeichnung keine
ebenso zwingenden Anhaltspunkte gewinnen, so daß ich diese drei nach
Form und Technik wohl derselben Werkstatt, nicht aber unbedingt dem-
selben Maler zuweisen möchte1). Hingegen lassen sich dessen Werk
zwei bisher unveröffentlichte Schalen angliedern. Die eine im archäo-
logischen Institut der Universität Leipzig(ll), die inMaßen, Form, Technik
und Dekoration völlig mit der Berliner (9) übereinstimmt. Der Kopf der
Seirene auf der Vorderseite zeigt den bekannten Typus. Bei der anderen,
mir nur durch die Pause in Gerhards Apparat mit dem Vermerk Candelori
bekannten (8) gestatten die Form und Dekoration — der Efeuzweig ist
von der Kopenhagener Skythenschale (16) bekannt — und die Gruppen,
die denen neben den Silensohren der Phineusschale (7) entsprechen, die
Zuteilung an deren Maler. Für die Londoner Kanne B 35 (18) ist ent-
scheidend die Seirene, dieZug um Zug der der Leipziger Schale (11) ent-
spricht, nur daß die in Leipzig mit einer feineren Nadel eingravierten
Trennungslinien der Schwungfedern in Flügel und Schwanz 2) hier fehlen.
Übereinstimmung in Form, Einteilung und Schulterdekoration schließt
hier die Bonner Kanne (19) an. Einzelzüge der Zeichnung, wie die drei
kurzen wagerechten Ritzlinien über die Brust der Sphinx, die von den
Seirenen in Leipzig (11) und London (18) bekannt sind, und das auf dieser
Stilstufe als Füllornament sonst nicht gebräuchliche Hakenkreuz be-
stätigen die Zugehörigkeit. Auch London B 34 (17) wird durch Fortu
und Einteilung ebenso wie durch die Bildung der Köpfe bei den Seirenen
und die kurzen Ritzlinien auf deren Brust hier anzuschließen sein. Die
Kanne der Slg. Sartorio (20) steht der Form nach allein. Doch lassen die
ü Auch die Florentiner Schale 3892 (13) scheint mir nach Herrn Dr.
Langlotz verdankten Skizzen der Werkstatt, aber nicht der Hand des Phineus .
tnalers anzugehören, von Scherben in Heidelberg, die mir Herr Dr. Lang-
lotz, und solchen im Mus. Gregoriano, die mir Herr Emil Kunze als zur Gattung
gehörig bezeichnete, fehlen mir Abbildtingen, die ein Urteil ermöglichten.
2) Diese Eigentümlichkeit des Phineusmalers, Ritzlinien auf schwarzen
und weißen Innenflächen mit einem feineren Instrument zu gravieren, bemerkte
zuerst Reichhold (FR. I 223 ff., ‘weiche Ritzlinien’).
Andreas Rumpf
malers. Fiir München 588 (1), New York 536 (4) und 537 (5) empfiehlt die
mit der in den Maßen gleichen Schale 15 völlig übereinstimmende Zeich-
nung von Palmetten, Silensohren utid Augen die Annahme desselben
Meisters. Fiir die beiden anderen Münchner Schalen 589 (2) und 591 (3)
sowie fiir die Göttinger Scherben (6) lassen sich in der Zeichnung keine
ebenso zwingenden Anhaltspunkte gewinnen, so daß ich diese drei nach
Form und Technik wohl derselben Werkstatt, nicht aber unbedingt dem-
selben Maler zuweisen möchte1). Hingegen lassen sich dessen Werk
zwei bisher unveröffentlichte Schalen angliedern. Die eine im archäo-
logischen Institut der Universität Leipzig(ll), die inMaßen, Form, Technik
und Dekoration völlig mit der Berliner (9) übereinstimmt. Der Kopf der
Seirene auf der Vorderseite zeigt den bekannten Typus. Bei der anderen,
mir nur durch die Pause in Gerhards Apparat mit dem Vermerk Candelori
bekannten (8) gestatten die Form und Dekoration — der Efeuzweig ist
von der Kopenhagener Skythenschale (16) bekannt — und die Gruppen,
die denen neben den Silensohren der Phineusschale (7) entsprechen, die
Zuteilung an deren Maler. Für die Londoner Kanne B 35 (18) ist ent-
scheidend die Seirene, dieZug um Zug der der Leipziger Schale (11) ent-
spricht, nur daß die in Leipzig mit einer feineren Nadel eingravierten
Trennungslinien der Schwungfedern in Flügel und Schwanz 2) hier fehlen.
Übereinstimmung in Form, Einteilung und Schulterdekoration schließt
hier die Bonner Kanne (19) an. Einzelzüge der Zeichnung, wie die drei
kurzen wagerechten Ritzlinien über die Brust der Sphinx, die von den
Seirenen in Leipzig (11) und London (18) bekannt sind, und das auf dieser
Stilstufe als Füllornament sonst nicht gebräuchliche Hakenkreuz be-
stätigen die Zugehörigkeit. Auch London B 34 (17) wird durch Fortu
und Einteilung ebenso wie durch die Bildung der Köpfe bei den Seirenen
und die kurzen Ritzlinien auf deren Brust hier anzuschließen sein. Die
Kanne der Slg. Sartorio (20) steht der Form nach allein. Doch lassen die
ü Auch die Florentiner Schale 3892 (13) scheint mir nach Herrn Dr.
Langlotz verdankten Skizzen der Werkstatt, aber nicht der Hand des Phineus .
tnalers anzugehören, von Scherben in Heidelberg, die mir Herr Dr. Lang-
lotz, und solchen im Mus. Gregoriano, die mir Herr Emil Kunze als zur Gattung
gehörig bezeichnete, fehlen mir Abbildtingen, die ein Urteil ermöglichten.
2) Diese Eigentümlichkeit des Phineusmalers, Ritzlinien auf schwarzen
und weißen Innenflächen mit einem feineren Instrument zu gravieren, bemerkte
zuerst Reichhold (FR. I 223 ff., ‘weiche Ritzlinien’).