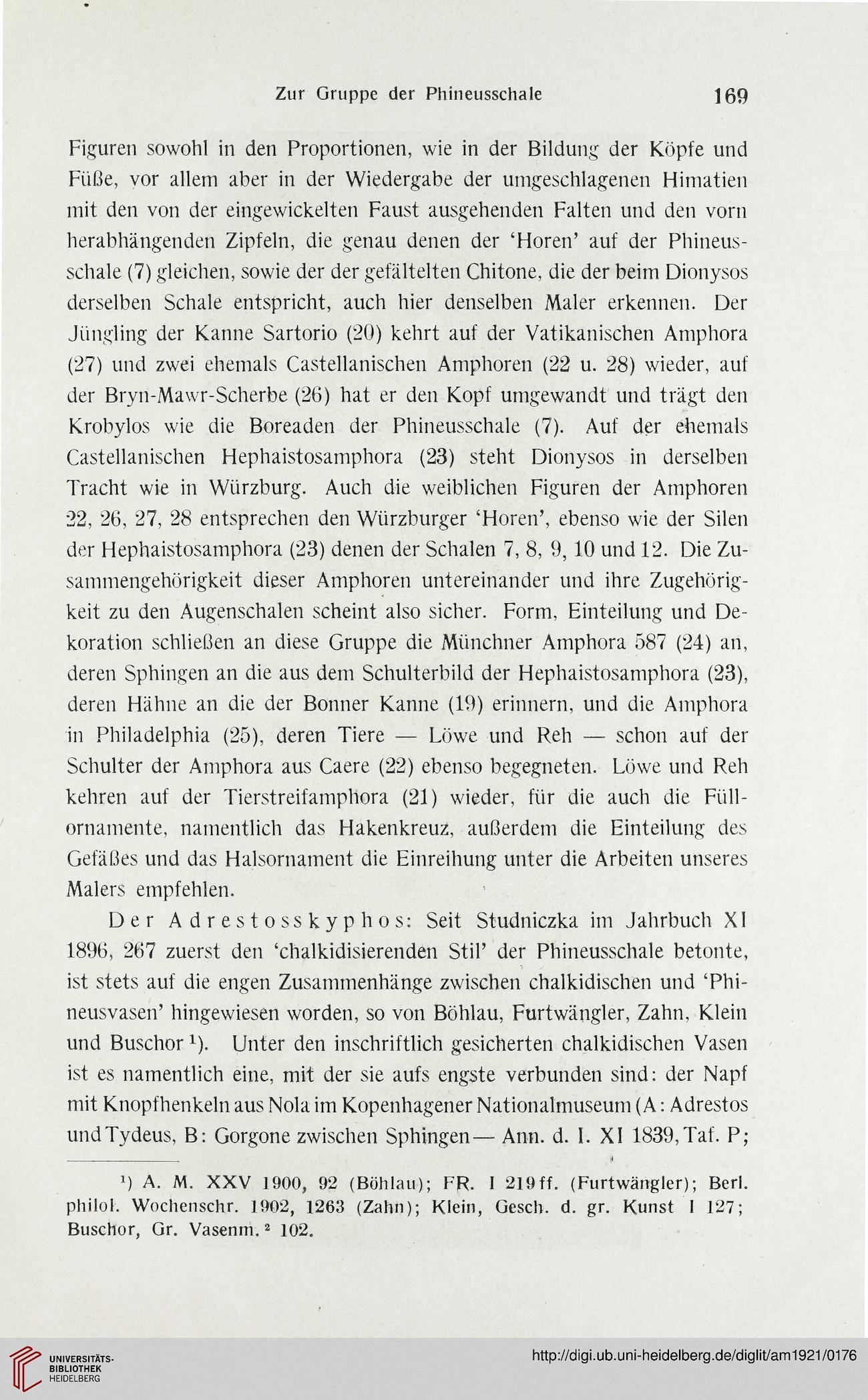Zur Gruppe der Phineusschale
169
Figuren sowohl in den Proportionen, wie in der Bildung der Köpfe und
Füße, vor allem aber in der Wiedergabe der umgeschlagenen Himatien
mit den von der eingewickelten Faust ausgehenden Falten und den vorn
herabhängenden Zipfeln, die genau denen der ‘Horen’ auf der Phineus-
schale (7) gleichen, sowie der der gefältelten Chitone, die der beim Dionysos
derselben Schale entspricht, auch hier denselben Maler erkennen. Der
Jüngling der Kanne Sartorio (20) kehrt auf der Vatikanischen Amphora
(27) und zwei ehemals Castellanischen Amphoren (22 u. 28) wieder, auf
der Bryn-Mawr-Scherbe (26) hat er den Kopf umgewandt und trägt den
Krobylos wie die Boreaden der Phineusschale (7). Auf der ehemals
Castellanischen Hephaistosamphora (23) steht Dionysos in derselben
Tracht wie in Würzburg. Auch die weiblichen Figuren der Amphoren
22, 26, 27, 28 entsprechen den Würzburger ‘Horen’, ebenso wie der Sileti
der Hephaistosamphora (23) denen der Schalen 7, 8, 9,10 und 12. Die Zu-
sammengehörigkeit dieser Amphoren untereinander und ihre Zugehörig-
keit zu den Augenschalen scheint also sicher. Form, Einteilung und De-
koration schließen an diese Gruppe die Münchner Amphora 587 (24) an,
deren Sphingen an die aus dem Schulterbild der Hephaistosamphora (23),
deren Hähne an die der Bonner Kanne (19) erinnern, und die Amphora
in Philadelphia (25), deren Tiere — Löwe und Reh — schon auf der
Schulter der Amphora aus Caere (22) ebenso begegneten. Löwe und Reh
kehren auf der Tierstreifamphora (21) wieder, für die auch die Fiill-
ornamente, namentlich das Hakenkreuz, außerdem die Einteilung des
Gefäßes und das Halsornament die Einreihung unter die Arbeiten unseres
Malers empfehlen.
Der Adrestosskyphos: Seit Studniczka iin Jahrbuch XI
1896, 267 zuerst den ‘chalkidisierenden Stil’ der Phineusschale betonte,
ist stets auf die engen Zusammenhänge zwischen chalkidischen und ‘Phi-
neusvasen’ hingewiesen worden, so von Böhlau, Furtwängler, Zahn, Klein
und Buschorr). Unter den inschriftlich gesicherten chalkidischen Vasen
ist es namentlich eine, mit der sie aufs engste verbunden sind: der Napf
mit Knopfhenkeln aus Nola im Kopenhagener Nationalmuseum (A: Adrestos
undTydeus, B: Gorgone zwischen Sphingen— Ann. d. I. XI 1839, Taf. P;
x) A. M. XXV 1900, 92 (Böhlau); FR. 1 219 ff. (Furtwängler); Berl.
philol. Wochenschr. 1902, 1263 (Zahn); Kiein, Gesch. d. gr. Kunst i 127;
Buschor, Gr. Vasenm.2 102.
169
Figuren sowohl in den Proportionen, wie in der Bildung der Köpfe und
Füße, vor allem aber in der Wiedergabe der umgeschlagenen Himatien
mit den von der eingewickelten Faust ausgehenden Falten und den vorn
herabhängenden Zipfeln, die genau denen der ‘Horen’ auf der Phineus-
schale (7) gleichen, sowie der der gefältelten Chitone, die der beim Dionysos
derselben Schale entspricht, auch hier denselben Maler erkennen. Der
Jüngling der Kanne Sartorio (20) kehrt auf der Vatikanischen Amphora
(27) und zwei ehemals Castellanischen Amphoren (22 u. 28) wieder, auf
der Bryn-Mawr-Scherbe (26) hat er den Kopf umgewandt und trägt den
Krobylos wie die Boreaden der Phineusschale (7). Auf der ehemals
Castellanischen Hephaistosamphora (23) steht Dionysos in derselben
Tracht wie in Würzburg. Auch die weiblichen Figuren der Amphoren
22, 26, 27, 28 entsprechen den Würzburger ‘Horen’, ebenso wie der Sileti
der Hephaistosamphora (23) denen der Schalen 7, 8, 9,10 und 12. Die Zu-
sammengehörigkeit dieser Amphoren untereinander und ihre Zugehörig-
keit zu den Augenschalen scheint also sicher. Form, Einteilung und De-
koration schließen an diese Gruppe die Münchner Amphora 587 (24) an,
deren Sphingen an die aus dem Schulterbild der Hephaistosamphora (23),
deren Hähne an die der Bonner Kanne (19) erinnern, und die Amphora
in Philadelphia (25), deren Tiere — Löwe und Reh — schon auf der
Schulter der Amphora aus Caere (22) ebenso begegneten. Löwe und Reh
kehren auf der Tierstreifamphora (21) wieder, für die auch die Fiill-
ornamente, namentlich das Hakenkreuz, außerdem die Einteilung des
Gefäßes und das Halsornament die Einreihung unter die Arbeiten unseres
Malers empfehlen.
Der Adrestosskyphos: Seit Studniczka iin Jahrbuch XI
1896, 267 zuerst den ‘chalkidisierenden Stil’ der Phineusschale betonte,
ist stets auf die engen Zusammenhänge zwischen chalkidischen und ‘Phi-
neusvasen’ hingewiesen worden, so von Böhlau, Furtwängler, Zahn, Klein
und Buschorr). Unter den inschriftlich gesicherten chalkidischen Vasen
ist es namentlich eine, mit der sie aufs engste verbunden sind: der Napf
mit Knopfhenkeln aus Nola im Kopenhagener Nationalmuseum (A: Adrestos
undTydeus, B: Gorgone zwischen Sphingen— Ann. d. I. XI 1839, Taf. P;
x) A. M. XXV 1900, 92 (Böhlau); FR. 1 219 ff. (Furtwängler); Berl.
philol. Wochenschr. 1902, 1263 (Zahn); Kiein, Gesch. d. gr. Kunst i 127;
Buschor, Gr. Vasenm.2 102.