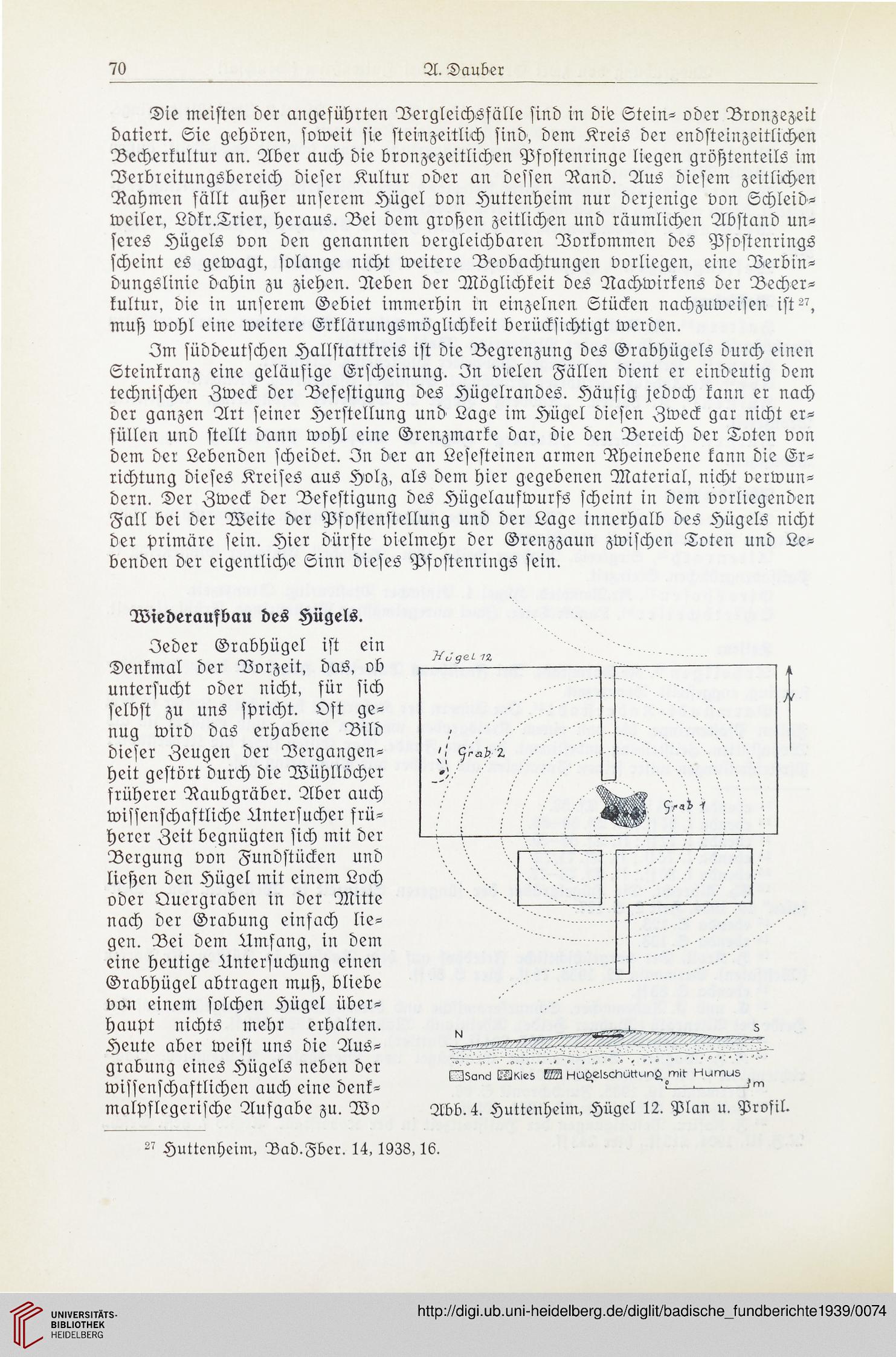70
2l. Dauber
Die meisten der angeführten Vergleichsfälle sind in dip Stein- oder Bronzezeit
datiert. Sie gehören, soweit sie steinzeitlich sind, dem Kreis der endsteinzeitlichen
Becherkultur an. Aber auch die bronzezeitlichen Psostenringe liegen größtenteils im
Berbreitungsbereich dieser Kultur oder an dessen Rand. Aus diesem zeitlichen
Rahmen sällt außer unserem Hügel von Huttenheim nur derjenige von Schleid-
weiler, Ldkr.Trier, heraus. Bei dem großen zeitlichen und räumlichen Abstand un-
seres Hügels von den genannten vergleichbaren Borkommen des Pfostenrings
scheint es gewagt, solange nicht weitere Beobachtungen vorliegen, eine Verbin-
dungslinie dahin zu ziehen. Neben der Möglichkeit des Nachwirkens der Becher-
kultur, die in unserem Gebiet immerhin in einzelnen Stücken nachzuweisen ist 27,
muß wohl eine weitere Erklärungsmöglichkeit berücksichtigt werden.
Im süddeutschen Hallstattkreis ist die Begrenzung des Grabhügels durch einen
Steinkranz eine geläufige Erscheinung. In vielen Fällen dient er eindeutig dem
technischen Zweck der Befestigung des Hügelrandes. Häufig jedoch kann er nach
der ganzen Art seiner Herstellung und Lage im Hügel diesen Zweck gar nicht er-
füllen und stellt dann Wohl eine Grenzmarke dar, die den Bereich der Toten von
dem der Lebenden scheidet. In der an Lesesteinen armen Rheinebene kann die Er-
richtung dieses Kreises aus Holz, als dem hier gegebenen Material, nicht verwun-
dern. Der Zweck der Befestigung des Hügelaufwurss scheint in dem vorliegenden
Fall bei der Weite der Pfostenstellung und der Lage innerhalb des Hügels nicht
der primäre sein. Hier dürfte vielmehr der Grenzzaun zwischen Toten und Le-
benden der eigentliche Sinn dieses Pfoftenrings sein.
Wiederaufbau des Hügels.
Ieder Grabhügel ist ein
Denkmal der Vorzeit, das, ob
untersucht oder nicht, für sich
selbst zu uns spricht. Oft ge-
nug wird das erhabene Bild
dieser Zeugen der Vergangen-
heit gestört durch die Wühllöcher
früherer Raubgräber. Aber auch
wissenschaftliche Antersucher frü-
herer Zeit begnügten sich mit der
Bergung von Fundstücken und
ließen den Hügel mit einem Loch
oder Quergraben in der Mitte
nach der Grabung einfach lie-
gen. Bei dem Amfang, in dem
eine heutige Untersuchung einen
Grabhügel abtragen muh, bliebe
von einem solchen Hügel über-
haupt nichts mehr erhalten.
Heute aber weist uns die Aus-
grabung eines Hügels neben der
wissenschaftlichen auch eine denk-
malpflegerische Aufgabe zu. Wo
Abb. 4. Huttenheim, Hügel 12. Plan u. Profil.
2? Huttenheim, Vad.Fber. 14,1938,16.
2l. Dauber
Die meisten der angeführten Vergleichsfälle sind in dip Stein- oder Bronzezeit
datiert. Sie gehören, soweit sie steinzeitlich sind, dem Kreis der endsteinzeitlichen
Becherkultur an. Aber auch die bronzezeitlichen Psostenringe liegen größtenteils im
Berbreitungsbereich dieser Kultur oder an dessen Rand. Aus diesem zeitlichen
Rahmen sällt außer unserem Hügel von Huttenheim nur derjenige von Schleid-
weiler, Ldkr.Trier, heraus. Bei dem großen zeitlichen und räumlichen Abstand un-
seres Hügels von den genannten vergleichbaren Borkommen des Pfostenrings
scheint es gewagt, solange nicht weitere Beobachtungen vorliegen, eine Verbin-
dungslinie dahin zu ziehen. Neben der Möglichkeit des Nachwirkens der Becher-
kultur, die in unserem Gebiet immerhin in einzelnen Stücken nachzuweisen ist 27,
muß wohl eine weitere Erklärungsmöglichkeit berücksichtigt werden.
Im süddeutschen Hallstattkreis ist die Begrenzung des Grabhügels durch einen
Steinkranz eine geläufige Erscheinung. In vielen Fällen dient er eindeutig dem
technischen Zweck der Befestigung des Hügelrandes. Häufig jedoch kann er nach
der ganzen Art seiner Herstellung und Lage im Hügel diesen Zweck gar nicht er-
füllen und stellt dann Wohl eine Grenzmarke dar, die den Bereich der Toten von
dem der Lebenden scheidet. In der an Lesesteinen armen Rheinebene kann die Er-
richtung dieses Kreises aus Holz, als dem hier gegebenen Material, nicht verwun-
dern. Der Zweck der Befestigung des Hügelaufwurss scheint in dem vorliegenden
Fall bei der Weite der Pfostenstellung und der Lage innerhalb des Hügels nicht
der primäre sein. Hier dürfte vielmehr der Grenzzaun zwischen Toten und Le-
benden der eigentliche Sinn dieses Pfoftenrings sein.
Wiederaufbau des Hügels.
Ieder Grabhügel ist ein
Denkmal der Vorzeit, das, ob
untersucht oder nicht, für sich
selbst zu uns spricht. Oft ge-
nug wird das erhabene Bild
dieser Zeugen der Vergangen-
heit gestört durch die Wühllöcher
früherer Raubgräber. Aber auch
wissenschaftliche Antersucher frü-
herer Zeit begnügten sich mit der
Bergung von Fundstücken und
ließen den Hügel mit einem Loch
oder Quergraben in der Mitte
nach der Grabung einfach lie-
gen. Bei dem Amfang, in dem
eine heutige Untersuchung einen
Grabhügel abtragen muh, bliebe
von einem solchen Hügel über-
haupt nichts mehr erhalten.
Heute aber weist uns die Aus-
grabung eines Hügels neben der
wissenschaftlichen auch eine denk-
malpflegerische Aufgabe zu. Wo
Abb. 4. Huttenheim, Hügel 12. Plan u. Profil.
2? Huttenheim, Vad.Fber. 14,1938,16.