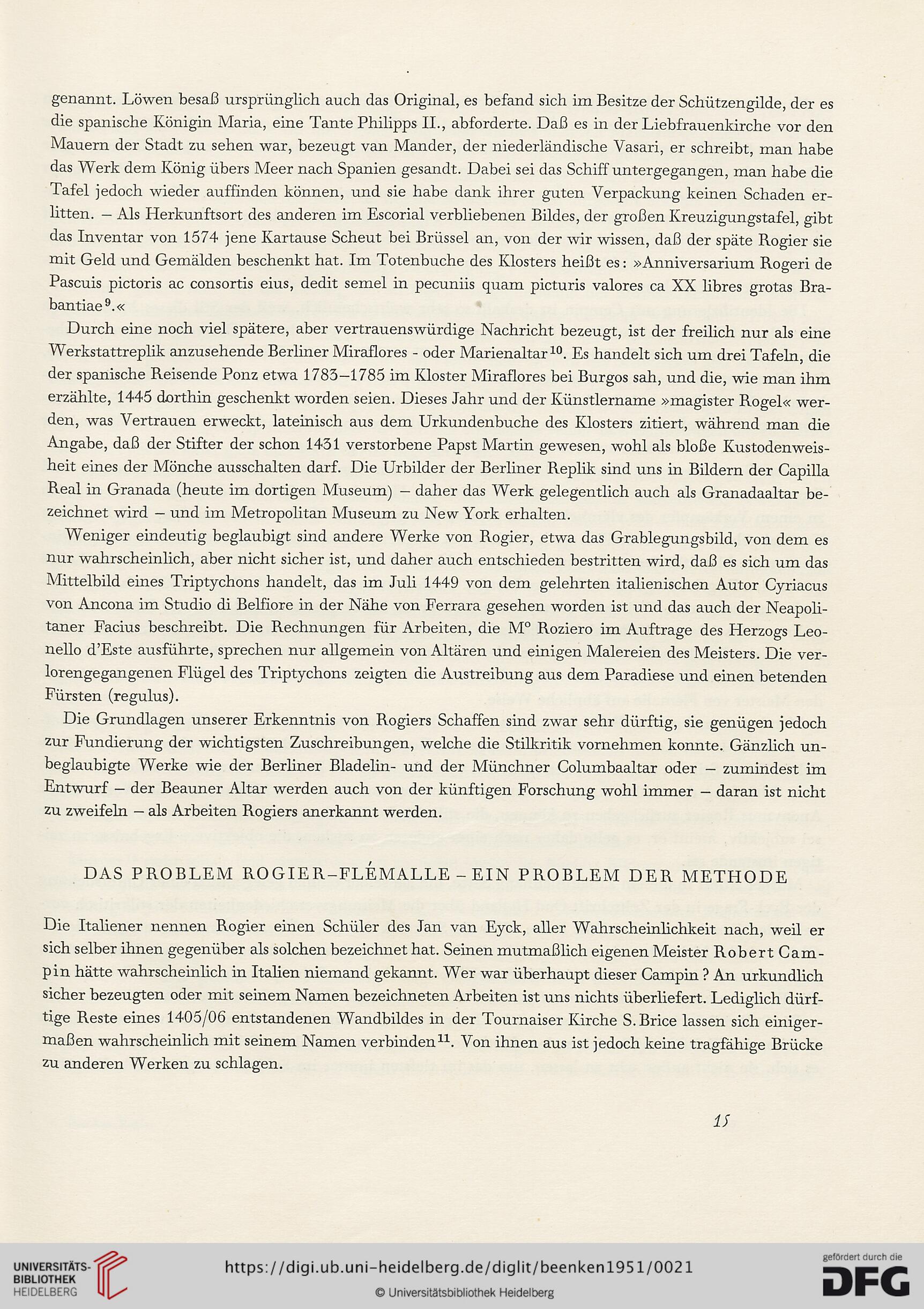genannt. Löwen besaß ursprünglich auch das Original, es befand sich im Besitze der Schützengilde, der es
die spanische Königin Maria, eine Tante Philipps II., abforderte. Daß es in der Liebfrauenkirche vor den
Mauern der Stadt zu sehen war, bezeugt van Mander, der niederländische Vasari, er schreibt, man habe
das Werk dem König übers Meer nach Spanien gesandt. Dabei sei das Schiff untergegangen, man habe die
Tafel jedoch wieder auffinden können, und sie habe dank ihrer guten Verpackung keinen Schaden er-
litten. — Als Herkunftsort des anderen im Escorial verbliebenen Bildes, der großen Kreuzigungstafel, gibt
das Inventar von 1574 jene Kartause Scheut bei Brüssel an, von der wir wissen, daß der späte Rogier sie
mit Geld und Gemälden beschenkt hat. Im Totenbuche des Klosters heißt es: »Anniversarium Rogeri de
Pascuis pictoris ac consortis eius, dedit semel in pecuniis quam picturis valores ca XX libres grotas Bra-
bantiae9.«
Durch eine noch viel spätere, aber vertrauenswürdige Nachricht bezeugt, ist der freilich nur als eine
Werkstattreplik anzusehende Berliner Miraflores - oder Marienaltar10. Es handelt sich um drei Tafeln, die
der spanische Reisende Ponz etwa 1783—1785 im Kloster Miraflores bei Burgos sah, und die, wie man ihm
erzählte, 1445 dorthin geschenkt worden seien. Dieses Jahr und der Künstlername »magister Rogel« wer-
den, was Vertrauen erweckt, lateinisch aus dem Urkundenbuche des Klosters zitiert, während man die
Angabe, daß der Stifter der schon 1431 verstorbene Papst Martin gewesen, wohl als bloße Kustodenweis-
heit eines der Mönche ausschalten darf. Die Urbilder der Berliner Replik sind uns in Bildern der Capilla
Real in Granada (heute im dortigen Museum) — daher das Werk gelegentlich auch als Granadaaltar be-
zeichnet wird — und im Metropolitan Museum zu New York erhalten.
Weniger eindeutig beglaubigt sind andere Werke von Rogier, etwa das Grablegungsbild, von dem es
nur wahrscheinlich, aber nicht sicher ist, und daher auch entschieden bestritten wird, daß es sich um das
Mittelbild eines Triptychons handelt, das im Juli 1449 von dem gelehrten italienischen Autor Cyriacus
von Ancona im Studio di Belfiore in der Nähe von Ferrara gesehen worden ist und das auch der Neapoli-
taner Facius beschreibt. Die Rechnungen für Arbeiten, die M° Roziero im Auftrage des Herzogs Leo-
nello d’Este ausführte, sprechen nur allgemein von Altären und einigen Malereien des Meisters. Die ver-
lorengegangenen Flügel des Triptychons zeigten die Austreibung aus dem Paradiese und einen betenden
Fürsten (regulus).
Die Grundlagen unserer Erkenntnis von Rogiers Schaffen sind zwar sehr dürftig, sie genügen jedoch
zur Fundierung der wichtigsten Zuschreibungen, welche die Stilkritik vornehmen konnte. Gänzlich un-
beglaubigte Werke wie der Berliner Bladelin- und der Münchner Columbaaltar oder — zumindest im
Entwurf — der Beauner Altar werden auch von der künftigen Forschung wohl immer — daran ist nicht
zu zweifeln — als Arbeiten Rogiers anerkannt werden.
DAS PROBLEM ROGIER-FLEMALLE - EIN PROBLEM DER METHODE
Die Italiener nennen Rogier einen Schüler des Jan van Eyck, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil er
sich selber ihnen gegenüber als solchen bezeichnet hat. Seinen mutmaßlich eigenen Meister Robert Cam-
pin hätte wahrscheinlich in Italien niemand gekannt. Wer war überhaupt dieser Campin ? An urkundlich
sicher bezeugten oder mit seinem Namen bezeichneten Arbeiten ist uns nichts überliefert. Lediglich dürf-
tige Reste eines 1405/06 entstandenen Wandbildes in der Tournaiser Kirche S.Brice lassen sich einiger-
maßen wahrscheinlich mit seinem Namen verbinden11. Von ihnen aus ist jedoch keine tragfähige Brücke
zu anderen Werken zu schlagen.
die spanische Königin Maria, eine Tante Philipps II., abforderte. Daß es in der Liebfrauenkirche vor den
Mauern der Stadt zu sehen war, bezeugt van Mander, der niederländische Vasari, er schreibt, man habe
das Werk dem König übers Meer nach Spanien gesandt. Dabei sei das Schiff untergegangen, man habe die
Tafel jedoch wieder auffinden können, und sie habe dank ihrer guten Verpackung keinen Schaden er-
litten. — Als Herkunftsort des anderen im Escorial verbliebenen Bildes, der großen Kreuzigungstafel, gibt
das Inventar von 1574 jene Kartause Scheut bei Brüssel an, von der wir wissen, daß der späte Rogier sie
mit Geld und Gemälden beschenkt hat. Im Totenbuche des Klosters heißt es: »Anniversarium Rogeri de
Pascuis pictoris ac consortis eius, dedit semel in pecuniis quam picturis valores ca XX libres grotas Bra-
bantiae9.«
Durch eine noch viel spätere, aber vertrauenswürdige Nachricht bezeugt, ist der freilich nur als eine
Werkstattreplik anzusehende Berliner Miraflores - oder Marienaltar10. Es handelt sich um drei Tafeln, die
der spanische Reisende Ponz etwa 1783—1785 im Kloster Miraflores bei Burgos sah, und die, wie man ihm
erzählte, 1445 dorthin geschenkt worden seien. Dieses Jahr und der Künstlername »magister Rogel« wer-
den, was Vertrauen erweckt, lateinisch aus dem Urkundenbuche des Klosters zitiert, während man die
Angabe, daß der Stifter der schon 1431 verstorbene Papst Martin gewesen, wohl als bloße Kustodenweis-
heit eines der Mönche ausschalten darf. Die Urbilder der Berliner Replik sind uns in Bildern der Capilla
Real in Granada (heute im dortigen Museum) — daher das Werk gelegentlich auch als Granadaaltar be-
zeichnet wird — und im Metropolitan Museum zu New York erhalten.
Weniger eindeutig beglaubigt sind andere Werke von Rogier, etwa das Grablegungsbild, von dem es
nur wahrscheinlich, aber nicht sicher ist, und daher auch entschieden bestritten wird, daß es sich um das
Mittelbild eines Triptychons handelt, das im Juli 1449 von dem gelehrten italienischen Autor Cyriacus
von Ancona im Studio di Belfiore in der Nähe von Ferrara gesehen worden ist und das auch der Neapoli-
taner Facius beschreibt. Die Rechnungen für Arbeiten, die M° Roziero im Auftrage des Herzogs Leo-
nello d’Este ausführte, sprechen nur allgemein von Altären und einigen Malereien des Meisters. Die ver-
lorengegangenen Flügel des Triptychons zeigten die Austreibung aus dem Paradiese und einen betenden
Fürsten (regulus).
Die Grundlagen unserer Erkenntnis von Rogiers Schaffen sind zwar sehr dürftig, sie genügen jedoch
zur Fundierung der wichtigsten Zuschreibungen, welche die Stilkritik vornehmen konnte. Gänzlich un-
beglaubigte Werke wie der Berliner Bladelin- und der Münchner Columbaaltar oder — zumindest im
Entwurf — der Beauner Altar werden auch von der künftigen Forschung wohl immer — daran ist nicht
zu zweifeln — als Arbeiten Rogiers anerkannt werden.
DAS PROBLEM ROGIER-FLEMALLE - EIN PROBLEM DER METHODE
Die Italiener nennen Rogier einen Schüler des Jan van Eyck, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil er
sich selber ihnen gegenüber als solchen bezeichnet hat. Seinen mutmaßlich eigenen Meister Robert Cam-
pin hätte wahrscheinlich in Italien niemand gekannt. Wer war überhaupt dieser Campin ? An urkundlich
sicher bezeugten oder mit seinem Namen bezeichneten Arbeiten ist uns nichts überliefert. Lediglich dürf-
tige Reste eines 1405/06 entstandenen Wandbildes in der Tournaiser Kirche S.Brice lassen sich einiger-
maßen wahrscheinlich mit seinem Namen verbinden11. Von ihnen aus ist jedoch keine tragfähige Brücke
zu anderen Werken zu schlagen.