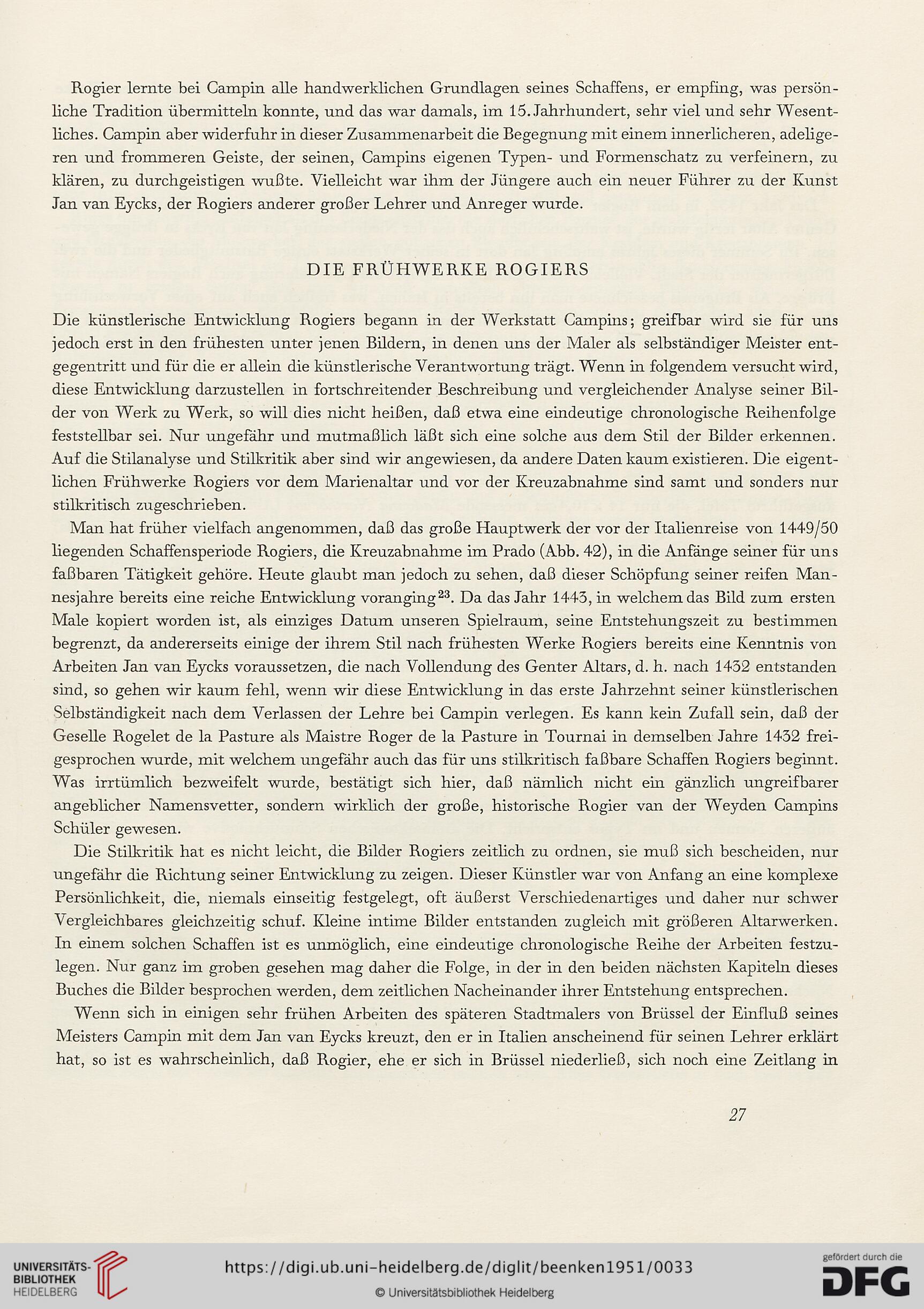Rogier lernte bei Campin alle handwerklichen Grundlagen seines Schaffens, er empfing, was persön-
liche Tradition übermitteln konnte, und das war damals, im 15. Jahrhundert, sehr viel und sehr Wesent-
liches. Campin aber widerfuhr in dieser Zusammenarbeit die Begegnung mit einem innerlicheren, adelige-
ren und frommeren Geiste, der seinen, Campins eigenen Typen- und Formenschatz zu verfeinern, zu
klären, zu durchgeistigen wußte. Vielleicht war ihm der Jüngere auch ein neuer Führer zu der Kunst
Jan van Eycks, der Rogiers anderer großer Lehrer und Anreger wurde.
DIE FRÜHWERKE ROGIERS
Die künstlerische Entwicklung Rogiers begann in der Werkstatt Campins; greifbar wird sie für uns
jedoch erst in den frühesten unter jenen Bildern, in denen uns der Maler als selbständiger Meister ent-
gegentritt und für die er allein die künstlerische Verantwortung trägt. Wenn in folgendem versucht wird,
diese Entwicklung darzustellen in fortschreitender Beschreibung und vergleichender Analyse seiner Bil-
der von Werk zu Werk, so will dies nicht heißen, daß etwa eine eindeutige chronologische Reihenfolge
feststellbar sei. Nur ungefähr und mutmaßlich läßt sich eine solche aus dem Stil der Bilder erkennen.
Auf die Stilanalyse und Stilkritik aber sind wir angewiesen, da andere Daten kaum existieren. Die eigent-
lichen Frühwerke Rogiers vor dem Marienaltar und vor der Kreuzabnahme sind samt und sonders nur
stilkritisch zugeschrieben.
Man hat früher vielfach angenommen, daß das große Hauptwerk der vor der Italienreise von 1449/50
liegenden Schaffensperiode Rogiers, die Kreuzabnahme im Prado (Abb. 42), in die Anfänge seiner für uns
faßbaren Tätigkeit gehöre. Heute glaubt man jedoch zu sehen, daß dieser Schöpfung seiner reifen Man-
nesjahre bereits eine reiche Entwicklung voranging23. Da das Jahr 1443, in welchem das Bild zum ersten
Male kopiert worden ist, als einziges Datum unseren Spielraum, seine Entstehungszeit zu bestimmen
begrenzt, da andererseits einige der ihrem Stil nach frühesten Werke Rogiers bereits eine Kenntnis von
Arbeiten Jan van Eycks voraussetzen, die nach Vollendung des Genter Altars, d. h. nach 1432 entstanden
sind, so gehen wir kaum fehl, wenn wir diese Entwicklung in das erste Jahrzehnt seiner künstlerischen
Selbständigkeit nach dem Verlassen der Lehre bei Campin verlegen. Es kann kein Zufall sein, daß der
Geselle Rogelet de la Pasture als Maistre Roger de la Pasture in Tournai in demselben Jahre 1432 frei-
gesprochen wurde, mit welchem ungefähr auch das für uns stilkritisch faßbare Schaffen Rogiers beginnt.
Was irrtümlich bezweifelt wurde, bestätigt sich hier, daß nämlich nicht ein gänzlich ungreifbarer
angeblicher Namensvetter, sondern wirklich der große, historische Rogier van der Weyden Campins
Schüler gewesen.
Die Stilkritik hat es nicht leicht, die Bilder Rogiers zeitlich zu ordnen, sie muß sich bescheiden, nur
ungefähr die Richtung seiner Entwicklung zu zeigen. Dieser Künstler war von Anfang an eine komplexe
Persönlichkeit, die, niemals einseitig festgelegt, oft äußerst Verschiedenartiges und daher nur schwer
Vergleichbares gleichzeitig schuf. Kleine intime Bilder entstanden zugleich mit größeren Altarwerken.
In einem solchen Schaffen ist es unmöglich, eine eindeutige chronologische Reihe der Arbeiten festzu-
legen. Nur ganz im groben gesehen mag daher die Folge, in der in den beiden nächsten Kapiteln dieses
Buches die Bilder besprochen werden, dem zeitlichen Nacheinander ihrer Entstehung entsprechen.
Wenn sich in einigen sehr frühen Arbeiten des späteren Stadtmalers von Brüssel der Einfluß seines
Meisters Campin mit dem Jan van Eycks kreuzt, den er in Italien anscheinend für seinen Lehrer erklärt
hat, so ist es wahrscheinlich, daß Rogier, ehe er sich in Brüssel niederließ, sich noch eine Zeitlang in
27
liche Tradition übermitteln konnte, und das war damals, im 15. Jahrhundert, sehr viel und sehr Wesent-
liches. Campin aber widerfuhr in dieser Zusammenarbeit die Begegnung mit einem innerlicheren, adelige-
ren und frommeren Geiste, der seinen, Campins eigenen Typen- und Formenschatz zu verfeinern, zu
klären, zu durchgeistigen wußte. Vielleicht war ihm der Jüngere auch ein neuer Führer zu der Kunst
Jan van Eycks, der Rogiers anderer großer Lehrer und Anreger wurde.
DIE FRÜHWERKE ROGIERS
Die künstlerische Entwicklung Rogiers begann in der Werkstatt Campins; greifbar wird sie für uns
jedoch erst in den frühesten unter jenen Bildern, in denen uns der Maler als selbständiger Meister ent-
gegentritt und für die er allein die künstlerische Verantwortung trägt. Wenn in folgendem versucht wird,
diese Entwicklung darzustellen in fortschreitender Beschreibung und vergleichender Analyse seiner Bil-
der von Werk zu Werk, so will dies nicht heißen, daß etwa eine eindeutige chronologische Reihenfolge
feststellbar sei. Nur ungefähr und mutmaßlich läßt sich eine solche aus dem Stil der Bilder erkennen.
Auf die Stilanalyse und Stilkritik aber sind wir angewiesen, da andere Daten kaum existieren. Die eigent-
lichen Frühwerke Rogiers vor dem Marienaltar und vor der Kreuzabnahme sind samt und sonders nur
stilkritisch zugeschrieben.
Man hat früher vielfach angenommen, daß das große Hauptwerk der vor der Italienreise von 1449/50
liegenden Schaffensperiode Rogiers, die Kreuzabnahme im Prado (Abb. 42), in die Anfänge seiner für uns
faßbaren Tätigkeit gehöre. Heute glaubt man jedoch zu sehen, daß dieser Schöpfung seiner reifen Man-
nesjahre bereits eine reiche Entwicklung voranging23. Da das Jahr 1443, in welchem das Bild zum ersten
Male kopiert worden ist, als einziges Datum unseren Spielraum, seine Entstehungszeit zu bestimmen
begrenzt, da andererseits einige der ihrem Stil nach frühesten Werke Rogiers bereits eine Kenntnis von
Arbeiten Jan van Eycks voraussetzen, die nach Vollendung des Genter Altars, d. h. nach 1432 entstanden
sind, so gehen wir kaum fehl, wenn wir diese Entwicklung in das erste Jahrzehnt seiner künstlerischen
Selbständigkeit nach dem Verlassen der Lehre bei Campin verlegen. Es kann kein Zufall sein, daß der
Geselle Rogelet de la Pasture als Maistre Roger de la Pasture in Tournai in demselben Jahre 1432 frei-
gesprochen wurde, mit welchem ungefähr auch das für uns stilkritisch faßbare Schaffen Rogiers beginnt.
Was irrtümlich bezweifelt wurde, bestätigt sich hier, daß nämlich nicht ein gänzlich ungreifbarer
angeblicher Namensvetter, sondern wirklich der große, historische Rogier van der Weyden Campins
Schüler gewesen.
Die Stilkritik hat es nicht leicht, die Bilder Rogiers zeitlich zu ordnen, sie muß sich bescheiden, nur
ungefähr die Richtung seiner Entwicklung zu zeigen. Dieser Künstler war von Anfang an eine komplexe
Persönlichkeit, die, niemals einseitig festgelegt, oft äußerst Verschiedenartiges und daher nur schwer
Vergleichbares gleichzeitig schuf. Kleine intime Bilder entstanden zugleich mit größeren Altarwerken.
In einem solchen Schaffen ist es unmöglich, eine eindeutige chronologische Reihe der Arbeiten festzu-
legen. Nur ganz im groben gesehen mag daher die Folge, in der in den beiden nächsten Kapiteln dieses
Buches die Bilder besprochen werden, dem zeitlichen Nacheinander ihrer Entstehung entsprechen.
Wenn sich in einigen sehr frühen Arbeiten des späteren Stadtmalers von Brüssel der Einfluß seines
Meisters Campin mit dem Jan van Eycks kreuzt, den er in Italien anscheinend für seinen Lehrer erklärt
hat, so ist es wahrscheinlich, daß Rogier, ehe er sich in Brüssel niederließ, sich noch eine Zeitlang in
27