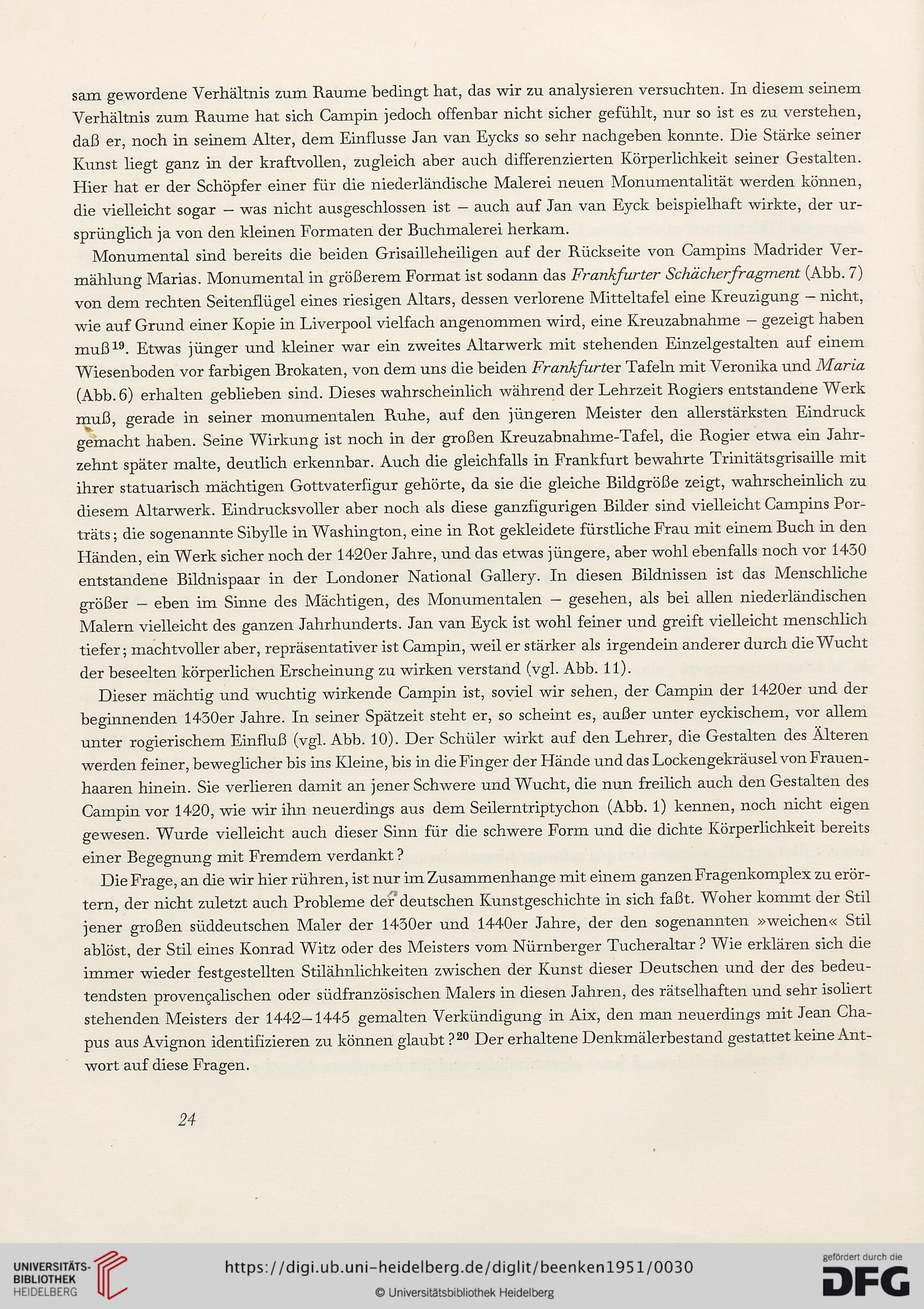sam gewordene Verhältnis zum Raume bedingt hat, das wir zu analysieren versuchten. In diesem seinem
Verhältnis zum Raume hat sich Campin jedoch offenbar nicht sicher gefühlt, nur so ist es zu verstehen,
daß er, noch in seinem Alter, dem Einflüsse Jan van Eycks so sehr nachgeben konnte. Die Stärke seiner
Kunst liegt ganz in der kraftvollen, zugleich aber auch differenzierten Körperlichkeit seiner Gestalten.
Hier hat er der Schöpfer einer für die niederländische Malerei neuen Monumentalität werden können,
die vielleicht sogar — was nicht ausgeschlossen ist — auch auf Jan van Eyck beispielhaft wirkte, der ur-
sprünglich ja von den kleinen Formaten der Buchmalerei herkam.
Monumental sind bereits die beiden Grisailleheiligen auf der Rückseite von Campins Madrider Ver-
mählung Marias. Monumental in größerem Format ist sodann das Frankfurter Schächerfragment (Abb. 7)
von dem rechten Seitenflügel eines riesigen Altars, dessen verlorene Mitteltafel eine Kreuzigung — nicht,
wie auf Grund einer Kopie in Liverpool vielfach angenommen wird, eine Kreuzabnahme — gezeigt haben
muß19. Etwas jünger und kleiner war ein zweites Altarwerk mit stehenden Einzelgestalten auf einem
Wiesenboden vor farbigen Brokaten, von dem uns die beiden Frankfurter: Tafeln mit Veronika und Maria
(Abb. 6) erhalten geblieben sind. Dieses wahrscheinlich während der Lehrzeit Rogiers entstandene Werk
muß, gerade in seiner monumentalen Ruhe, auf den jüngeren Meister den allerstärksten Eindruck
gemacht haben. Seine Wirkung ist noch in der großen Kreuzabnahme-Tafel, die Rogier etwa ein Jahr-
zehnt später malte, deutlich erkennbar. Auch die gleichfalls in Frankfurt bewahrte Trinitätsgrisaille mit
ihrer statuarisch mächtigen Gottvaterfigur gehörte, da sie die gleiche Bildgröße zeigt, wahrscheinlich zu
diesem Altarwerk. Eindrucksvoller aber noch als diese ganzfigurigen Bilder sind vielleicht Campins Por-
träts ; die sogenannte Sibylle in Washington, eine in Rot gekleidete fürstliche Frau mit einem Buch in den
Händen, ein Werk sicher noch der 1420er Jahre, und das etwas jüngere, aber wohl ebenfalls noch vor 1430
entstandene Bildnispaar in der Londoner National Gallery. In diesen Bildnissen ist das Menschliche
größer — eben im Sinne des Mächtigen, des Monumentalen — gesehen, als bei allen niederländischen
Malern vielleicht des ganzen Jahrhunderts. Jan van Eyck ist wohl feiner und greift vielleicht menschlich
tiefer; machtvoller aber, repräsentativer ist Campin, weil er stärker als irgendein anderer durch die Wucht
der beseelten körperlichen Erscheinung zu wirken verstand (vgl. Abb. 11).
Dieser mächtig und wuchtig wirkende Campin ist, soviel wir sehen, der Campin der 1420er und der
beginnenden 1430er Jahre. In seiner Spätzeit steht er, so scheint es, außer unter eyckischem, vor allem
unter rogierischem Einfluß (vgl. Abb. 10). Der Schüler wirkt auf den Lehrer, die Gestalten des Älteren
werden feiner, beweglicher bis ins Kleine, bis in die Finger der Hände und das Lockengekräusel von Frauen-
haaren hinein. Sie verlieren damit an jener Schwere und Wucht, die nun freilich auch den Gestalten des
Campin vor 1420, wie wir ihn neuerdings aus dem Seilerntriptychon (Abb. 1) kennen, noch nicht eigen
gewesen. Wurde vielleicht auch dieser Sinn für die schwere Form und die dichte Körperlichkeit bereits
einer Begegnung mit Fremdem verdankt ?
Die Frage, an die wir hier rühren, ist nur im Zusammenhänge mit einem ganzen Fragenkomplex zu erör-
tern, der nicht zuletzt auch Probleme der deutschen Kunstgeschichte in sich faßt. Woher kommt der Stil
jener großen süddeutschen Maler der 1430er und 1440er Jahre, der den sogenannten »weichen« Stil
ablöst, der Stil eines Konrad Witz oder des Meisters vom Nürnberger Tucheraltar ? Wie erklären sich die
immer wieder festgestellten Stilähnlichkeiten zwischen der Kunst dieser Deutschen und der des bedeu-
tendsten provengalischen oder südfranzösischen Malers in diesen Jahren, des rätselhaften und sehr isoliert
stehenden Meisters der 1442—1445 gemalten Verkündigung in Aix, den man neuerdings mit Jean Cha-
pus aus Avignon identifizieren zu können glaubt ? 20 Der erhaltene Denkmälerbestand gestattet keine Ant-
wort auf diese Fragen.
24
Verhältnis zum Raume hat sich Campin jedoch offenbar nicht sicher gefühlt, nur so ist es zu verstehen,
daß er, noch in seinem Alter, dem Einflüsse Jan van Eycks so sehr nachgeben konnte. Die Stärke seiner
Kunst liegt ganz in der kraftvollen, zugleich aber auch differenzierten Körperlichkeit seiner Gestalten.
Hier hat er der Schöpfer einer für die niederländische Malerei neuen Monumentalität werden können,
die vielleicht sogar — was nicht ausgeschlossen ist — auch auf Jan van Eyck beispielhaft wirkte, der ur-
sprünglich ja von den kleinen Formaten der Buchmalerei herkam.
Monumental sind bereits die beiden Grisailleheiligen auf der Rückseite von Campins Madrider Ver-
mählung Marias. Monumental in größerem Format ist sodann das Frankfurter Schächerfragment (Abb. 7)
von dem rechten Seitenflügel eines riesigen Altars, dessen verlorene Mitteltafel eine Kreuzigung — nicht,
wie auf Grund einer Kopie in Liverpool vielfach angenommen wird, eine Kreuzabnahme — gezeigt haben
muß19. Etwas jünger und kleiner war ein zweites Altarwerk mit stehenden Einzelgestalten auf einem
Wiesenboden vor farbigen Brokaten, von dem uns die beiden Frankfurter: Tafeln mit Veronika und Maria
(Abb. 6) erhalten geblieben sind. Dieses wahrscheinlich während der Lehrzeit Rogiers entstandene Werk
muß, gerade in seiner monumentalen Ruhe, auf den jüngeren Meister den allerstärksten Eindruck
gemacht haben. Seine Wirkung ist noch in der großen Kreuzabnahme-Tafel, die Rogier etwa ein Jahr-
zehnt später malte, deutlich erkennbar. Auch die gleichfalls in Frankfurt bewahrte Trinitätsgrisaille mit
ihrer statuarisch mächtigen Gottvaterfigur gehörte, da sie die gleiche Bildgröße zeigt, wahrscheinlich zu
diesem Altarwerk. Eindrucksvoller aber noch als diese ganzfigurigen Bilder sind vielleicht Campins Por-
träts ; die sogenannte Sibylle in Washington, eine in Rot gekleidete fürstliche Frau mit einem Buch in den
Händen, ein Werk sicher noch der 1420er Jahre, und das etwas jüngere, aber wohl ebenfalls noch vor 1430
entstandene Bildnispaar in der Londoner National Gallery. In diesen Bildnissen ist das Menschliche
größer — eben im Sinne des Mächtigen, des Monumentalen — gesehen, als bei allen niederländischen
Malern vielleicht des ganzen Jahrhunderts. Jan van Eyck ist wohl feiner und greift vielleicht menschlich
tiefer; machtvoller aber, repräsentativer ist Campin, weil er stärker als irgendein anderer durch die Wucht
der beseelten körperlichen Erscheinung zu wirken verstand (vgl. Abb. 11).
Dieser mächtig und wuchtig wirkende Campin ist, soviel wir sehen, der Campin der 1420er und der
beginnenden 1430er Jahre. In seiner Spätzeit steht er, so scheint es, außer unter eyckischem, vor allem
unter rogierischem Einfluß (vgl. Abb. 10). Der Schüler wirkt auf den Lehrer, die Gestalten des Älteren
werden feiner, beweglicher bis ins Kleine, bis in die Finger der Hände und das Lockengekräusel von Frauen-
haaren hinein. Sie verlieren damit an jener Schwere und Wucht, die nun freilich auch den Gestalten des
Campin vor 1420, wie wir ihn neuerdings aus dem Seilerntriptychon (Abb. 1) kennen, noch nicht eigen
gewesen. Wurde vielleicht auch dieser Sinn für die schwere Form und die dichte Körperlichkeit bereits
einer Begegnung mit Fremdem verdankt ?
Die Frage, an die wir hier rühren, ist nur im Zusammenhänge mit einem ganzen Fragenkomplex zu erör-
tern, der nicht zuletzt auch Probleme der deutschen Kunstgeschichte in sich faßt. Woher kommt der Stil
jener großen süddeutschen Maler der 1430er und 1440er Jahre, der den sogenannten »weichen« Stil
ablöst, der Stil eines Konrad Witz oder des Meisters vom Nürnberger Tucheraltar ? Wie erklären sich die
immer wieder festgestellten Stilähnlichkeiten zwischen der Kunst dieser Deutschen und der des bedeu-
tendsten provengalischen oder südfranzösischen Malers in diesen Jahren, des rätselhaften und sehr isoliert
stehenden Meisters der 1442—1445 gemalten Verkündigung in Aix, den man neuerdings mit Jean Cha-
pus aus Avignon identifizieren zu können glaubt ? 20 Der erhaltene Denkmälerbestand gestattet keine Ant-
wort auf diese Fragen.
24