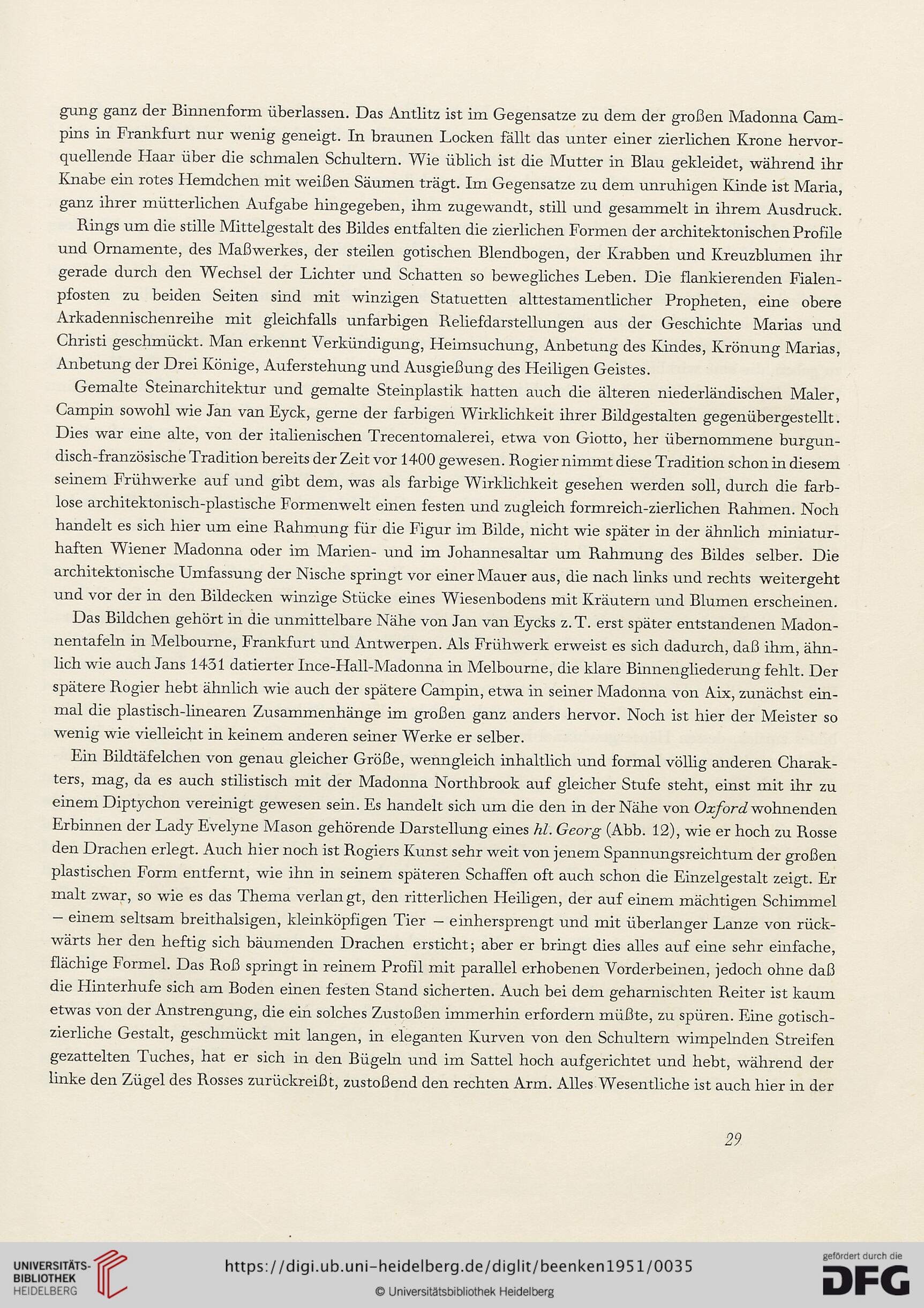gung ganz der Binnenform überlassen. Das Antlitz ist im Gegensätze zu dem der großen Madonna Cam-
pins in Frankfurt nur wenig geneigt. In braunen Locken fällt das unter einer zierlichen Krone hervor-
quellende Haar über die schmalen Schultern. Wie üblich ist die Mutter in Blau gekleidet, während ihr
Knabe ein rotes Hemdchen mit weißen Säumen trägt. Im Gegensätze zu dem unruhigen Kinde ist Maria,
ganz ihrer mütterlichen Aufgabe hingegeben, ihm zugewandt, still und gesammelt in ihrem Ausdruck.
Rings um die stille Mittelgestalt des Bildes entfalten die zierlichen Formen der architektonischen Profile
und Ornamente, des Maßwerkes, der steilen gotischen Blendbogen, der Krabben und Kreuzblumen ihr
gerade durch den Wechsel der Lichter und Schatten so bewegliches Leben. Die flankierenden Fialen-
pfosten zu beiden Seiten sind mit winzigen Statuetten alttestamentlicher Propheten, eine obere
Arkadennischenreihe mit gleichfalls unfarbigen Reliefdarstellungen aus der Geschichte Marias und
Christi geschmückt. Man erkennt Verkündigung, Heimsuchung, Anbetung des Kindes, Krönung Marias,
Anbetung der Drei Könige, Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes.
Gemalte Steinarchitektur und gemalte Steinplastik hatten auch die älteren niederländischen Maler,
Campin sowohl wie Jan van Eyck, gerne der farbigen Wirklichkeit ihrer Bildgestalten gegenübergestellt.
Dies war eine alte, von der italienischen Trecentomalerei, etwa von Giotto, her übernommene burgun-
disch-französische Tradition bereits der Zeit vor 1400 gewesen. Rogier nimmt diese Tradition schon in diesem
seinem Frühwerke auf und gibt dem, was als farbige Wirklichkeit gesehen werden soll, durch die farb-
lose architektonisch-plastische Formenwelt einen festen und zugleich formreich-zierlichen Rahmen. Noch
handelt es sich hier um eine Rahmung für die Figur im Bilde, nicht wie später in der ähnlich miniatur-
haften Wiener Madonna oder im Marien- und im Johannesaltar um Rahmung des Bildes selber. Die
architektonische Umfassung der Nische springt vor einer Mauer aus, die nach links und rechts weitergeht
und vor der in den Bildecken winzige Stücke eines Wiesenbodens mit Kräutern und Blumen erscheinen.
Das Bildchen gehört in die unmittelbare Nähe von Jan van Eycks z.T. erst später entstandenen Madon-
nentafeln in Melbourne, Frankfurt und Antwerpen. Als Frühwerk erweist es sich dadurch, daß ihm, ähn-
lich wie auch Jans 1431 datierter Ince-Hall-Madonna in Melbourne, die klare Binnengliederung fehlt. Der
spätere Rogier hebt ähnlich wie auch der spätere Campin, etwa in seiner Madonna von Aix, zunächst ein-
mal die plastisch-linearen Zusammenhänge im großen ganz anders hervor. Noch ist hier der Meister so
wenig wie vielleicht in keinem anderen seiner Werke er selber.
Ein Bildtäfelchen von genau gleicher Größe, wenngleich inhaltlich und formal völlig anderen Charak-
ters, mag, da es auch stilistisch mit der Madonna Northbrook auf gleicher Stufe steht, einst mit ihr zu
einem Diptychon vereinigt gewesen sein. Es handelt sich um die den in der Nähe von Oxford, wohnenden
Erbinnen der Lady Evelyne Mason gehörende Darstellung eines hl. Georg (Abb. 12), wie er hoch zu Rosse
den Drachen erlegt. Auch hier noch ist Rogiers Kunst sehr weit von jenem Spannungsreichtum der großen
plastischen Form entfernt, wie ihn in seinem späteren Schaffen oft auch schon die Einzelgestalt zeigt. Er
malt zwar, so wie es das Thema verlangt, den ritterlichen Heiligen, der auf einem mächtigen Schimmel
— einem seltsam breithalsigen, kleinköpfigen Tier — einhersprengt und mit überlanger Lanze von rück-
wärts her den heftig sich bäumenden Drachen ersticht; aber er bringt dies alles auf eine sehr einfache,
flächige Formel. Das Roß springt in reinem Profil mit parallel erhobenen Vorderbeinen, jedoch ohne daß
die Hinterhufe sich am Boden einen festen Stand sicherten. Auch bei dem geharnischten Reiter ist kaum
etwas von der Anstrengung, die ein solches Zustoßen immerhin erfordern müßte, zu spüren. Eine gotisch-
zierliche Gestalt, geschmückt mit langen, in eleganten Kurven von den Schultern wimpelnden Streifen
gezattelten Tuches, hat er sich in den Bügeln und im Sattel hoch aufgerichtet und hebt, während der
linke den Zügel des Rosses zurückreißt, zustoßend den rechten Arm. Alles Wesentliche ist auch hier in der
29
pins in Frankfurt nur wenig geneigt. In braunen Locken fällt das unter einer zierlichen Krone hervor-
quellende Haar über die schmalen Schultern. Wie üblich ist die Mutter in Blau gekleidet, während ihr
Knabe ein rotes Hemdchen mit weißen Säumen trägt. Im Gegensätze zu dem unruhigen Kinde ist Maria,
ganz ihrer mütterlichen Aufgabe hingegeben, ihm zugewandt, still und gesammelt in ihrem Ausdruck.
Rings um die stille Mittelgestalt des Bildes entfalten die zierlichen Formen der architektonischen Profile
und Ornamente, des Maßwerkes, der steilen gotischen Blendbogen, der Krabben und Kreuzblumen ihr
gerade durch den Wechsel der Lichter und Schatten so bewegliches Leben. Die flankierenden Fialen-
pfosten zu beiden Seiten sind mit winzigen Statuetten alttestamentlicher Propheten, eine obere
Arkadennischenreihe mit gleichfalls unfarbigen Reliefdarstellungen aus der Geschichte Marias und
Christi geschmückt. Man erkennt Verkündigung, Heimsuchung, Anbetung des Kindes, Krönung Marias,
Anbetung der Drei Könige, Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes.
Gemalte Steinarchitektur und gemalte Steinplastik hatten auch die älteren niederländischen Maler,
Campin sowohl wie Jan van Eyck, gerne der farbigen Wirklichkeit ihrer Bildgestalten gegenübergestellt.
Dies war eine alte, von der italienischen Trecentomalerei, etwa von Giotto, her übernommene burgun-
disch-französische Tradition bereits der Zeit vor 1400 gewesen. Rogier nimmt diese Tradition schon in diesem
seinem Frühwerke auf und gibt dem, was als farbige Wirklichkeit gesehen werden soll, durch die farb-
lose architektonisch-plastische Formenwelt einen festen und zugleich formreich-zierlichen Rahmen. Noch
handelt es sich hier um eine Rahmung für die Figur im Bilde, nicht wie später in der ähnlich miniatur-
haften Wiener Madonna oder im Marien- und im Johannesaltar um Rahmung des Bildes selber. Die
architektonische Umfassung der Nische springt vor einer Mauer aus, die nach links und rechts weitergeht
und vor der in den Bildecken winzige Stücke eines Wiesenbodens mit Kräutern und Blumen erscheinen.
Das Bildchen gehört in die unmittelbare Nähe von Jan van Eycks z.T. erst später entstandenen Madon-
nentafeln in Melbourne, Frankfurt und Antwerpen. Als Frühwerk erweist es sich dadurch, daß ihm, ähn-
lich wie auch Jans 1431 datierter Ince-Hall-Madonna in Melbourne, die klare Binnengliederung fehlt. Der
spätere Rogier hebt ähnlich wie auch der spätere Campin, etwa in seiner Madonna von Aix, zunächst ein-
mal die plastisch-linearen Zusammenhänge im großen ganz anders hervor. Noch ist hier der Meister so
wenig wie vielleicht in keinem anderen seiner Werke er selber.
Ein Bildtäfelchen von genau gleicher Größe, wenngleich inhaltlich und formal völlig anderen Charak-
ters, mag, da es auch stilistisch mit der Madonna Northbrook auf gleicher Stufe steht, einst mit ihr zu
einem Diptychon vereinigt gewesen sein. Es handelt sich um die den in der Nähe von Oxford, wohnenden
Erbinnen der Lady Evelyne Mason gehörende Darstellung eines hl. Georg (Abb. 12), wie er hoch zu Rosse
den Drachen erlegt. Auch hier noch ist Rogiers Kunst sehr weit von jenem Spannungsreichtum der großen
plastischen Form entfernt, wie ihn in seinem späteren Schaffen oft auch schon die Einzelgestalt zeigt. Er
malt zwar, so wie es das Thema verlangt, den ritterlichen Heiligen, der auf einem mächtigen Schimmel
— einem seltsam breithalsigen, kleinköpfigen Tier — einhersprengt und mit überlanger Lanze von rück-
wärts her den heftig sich bäumenden Drachen ersticht; aber er bringt dies alles auf eine sehr einfache,
flächige Formel. Das Roß springt in reinem Profil mit parallel erhobenen Vorderbeinen, jedoch ohne daß
die Hinterhufe sich am Boden einen festen Stand sicherten. Auch bei dem geharnischten Reiter ist kaum
etwas von der Anstrengung, die ein solches Zustoßen immerhin erfordern müßte, zu spüren. Eine gotisch-
zierliche Gestalt, geschmückt mit langen, in eleganten Kurven von den Schultern wimpelnden Streifen
gezattelten Tuches, hat er sich in den Bügeln und im Sattel hoch aufgerichtet und hebt, während der
linke den Zügel des Rosses zurückreißt, zustoßend den rechten Arm. Alles Wesentliche ist auch hier in der
29