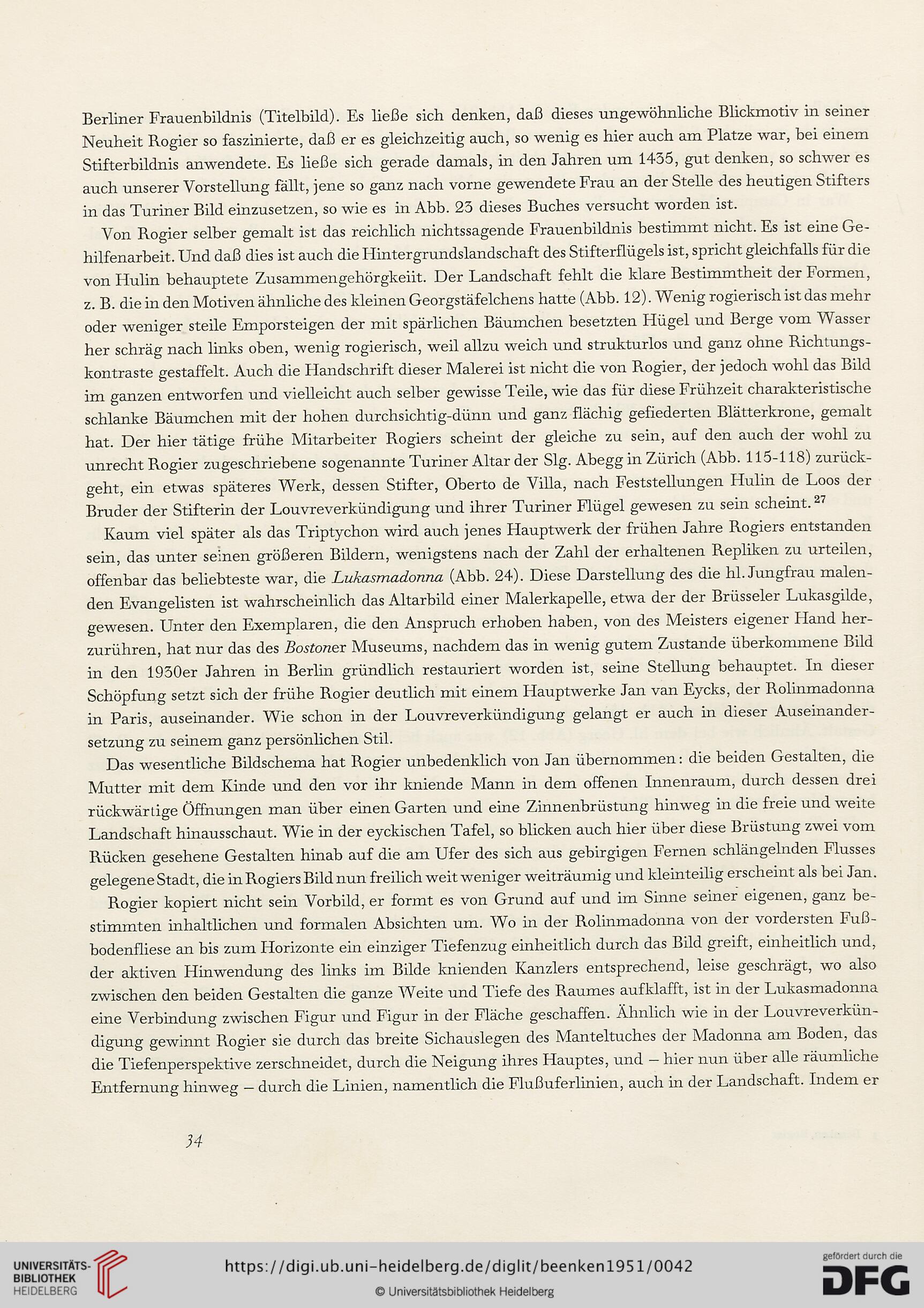Berliner Frauenbildnis (Titelbild). Es ließe sich denken, daß dieses ungewöhnliche Blickmotiv in seiner
Neuheit Rogier so faszinierte, daß er es gleichzeitig auch, so wenig es hier auch am Platze war, bei einem
Stifterbildnis anwendete. Es ließe sich gerade damals, in den Jahren um 1435, gut denken, so schwer es
auch unserer Vorstellung fällt, jene so ganz nach vorne gewendete Frau an der Stelle des heutigen Stifters
in das Turiner Bild einzusetzen, so wie es in Abb. 23 dieses Buches versucht worden ist.
Von Rogier selber gemalt ist das reichlich nichtssagende Frauenbildnis bestimmt nicht. Es ist eine Ge-
hilfenarbeit. Und daß dies ist auch die Hintergrundslandschaft des Stifterflügels ist, spricht gleichfalls für die
von Hulin behauptete Zusammengehörgkeiit. Der Landschaft fehlt die klare Bestimmtheit der Formen,
z. B. die in den Motiven ähnliche des kleinen Georgstäfelchens hatte (Abb. 12). Wenig rogierisch ist das mehr
oder weniger steile Emporsteigen der mit spärlichen Bäumchen besetzten Hügel und Berge vom Wasser
her schräg nach links oben, wenig rogierisch, weil allzu weich und strukturlos und ganz ohne Richtungs-
kontraste gestaffelt. Auch die Handschrift dieser Malerei ist nicht die von Rogier, der jedoch wohl das Bild
im ganzen entworfen und vielleicht auch selber gewisse Teile, wie das für diese Frühzeit charakteristische
schlanke Bäumchen mit der hohen durchsichtig-dünn und ganz flächig gefiederten Blätterkrone, gemalt
hat. Der hier tätige frühe Mitarbeiter Rogiers scheint der gleiche zu sein, auf den auch der wohl zu
unrecht Rogier zugeschriebene sogenannte Turiner Altar der Slg. Abegg in Zürich (Abb. 115-118) zurück-
geht, ein etwas späteres Werk, dessen Stifter, Oberto de Villa, nach Feststellungen Hulin de Loos der
Bruder der Stifterin der Louvreverkündigung und ihrer Turiner Flügel gewesen zu sein scheint.27
Kaum viel später als das Triptychon wird auch jenes Hauptwerk der frühen Jahre Rogiers entstanden
sein, das unter seinen größeren Bildern, wenigstens nach der Zahl der erhaltenen Repliken zu urteilen,
offenbar das beliebteste war, die Lukasmadonna (Abb. 24). Diese Darstellung des die hl. Jungfrau malen-
den Evangelisten ist wahrscheinlich das Altarbild einer Malerkapelle, etwa der der Brüsseler Lukasgilde,
gewesen. Unter den Exemplaren, die den Anspruch erhoben haben, von des Meisters eigener Hand her-
zurühren, hat nur das des Bostoner Museums, nachdem das in wenig gutem Zustande überkommene Bild
in den 1930er Jahren in Berlin gründlich restauriert worden ist, seine Stellung behauptet. In dieser
Schöpfung setzt sich der frühe Rogier deutlich mit einem Hauptwerke Jan van Eycks, der Rolinmadonna
in Paris, auseinander. Wie schon in der Louvreverkündigung gelangt er auch in dieser Auseinander-
setzung zu seinem ganz persönlichen Stil.
Das wesentliche Bildschema hat Rogier unbedenklich von Jan übernommen: die beiden Gestalten, die
Mutter mit dem Kinde und den vor ihr kniende Mann in dem offenen Innenraum, durch dessen drei
rückwärtige Öffnungen man über einen Garten und eine Zinnenbrüstung hinweg in die freie und weite
Landschaft hinausschaut. Wie in der eyckischen Tafel, so blicken auch hier über diese Brüstung zwei vom
Rücken gesehene Gestalten hinab auf die am Ufer des sich aus gebirgigen Fernen schlängelnden Flusses
gelegene Stadt, die in Rogiers Bild nun freilich weit weniger weiträumig und kleinteilig erscheint als bei Jan.
Rogier kopiert nicht sein Vorbild, er formt es von Grund auf und im Sinne seiner eigenen, ganz be-
stimmten inhaltlichen und formalen Absichten um. Wo in der Rolinmadonna von der vordersten Fuß-
bodenfliese an bis zum Horizonte ein einziger Tiefenzug einheitlich durch das Bild greift, einheitlich und,
der aktiven Hinwendung des links im Bilde knienden Kanzlers entsprechend, leise geschrägt, wo also
zwischen den beiden Gestalten die ganze Weite und Tiefe des Raumes aufklafft, ist in der Lukasmadonna
eine Verbindung zwischen Figur und Figur in der Fläche geschaffen. Ähnlich wie in der Louvreverkün-
digung gewinnt Rogier sie durch das breite Sichauslegen des Manteltuches der Madonna am Boden, das
die Tiefenperspektive zerschneidet, durch die Neigung ihres Hauptes, und — hier nun über alle räumliche
Entfernung hinweg — durch die Linien, namentlich die Flußuferlinien, auch in der Landschaft. Indem er
34
Neuheit Rogier so faszinierte, daß er es gleichzeitig auch, so wenig es hier auch am Platze war, bei einem
Stifterbildnis anwendete. Es ließe sich gerade damals, in den Jahren um 1435, gut denken, so schwer es
auch unserer Vorstellung fällt, jene so ganz nach vorne gewendete Frau an der Stelle des heutigen Stifters
in das Turiner Bild einzusetzen, so wie es in Abb. 23 dieses Buches versucht worden ist.
Von Rogier selber gemalt ist das reichlich nichtssagende Frauenbildnis bestimmt nicht. Es ist eine Ge-
hilfenarbeit. Und daß dies ist auch die Hintergrundslandschaft des Stifterflügels ist, spricht gleichfalls für die
von Hulin behauptete Zusammengehörgkeiit. Der Landschaft fehlt die klare Bestimmtheit der Formen,
z. B. die in den Motiven ähnliche des kleinen Georgstäfelchens hatte (Abb. 12). Wenig rogierisch ist das mehr
oder weniger steile Emporsteigen der mit spärlichen Bäumchen besetzten Hügel und Berge vom Wasser
her schräg nach links oben, wenig rogierisch, weil allzu weich und strukturlos und ganz ohne Richtungs-
kontraste gestaffelt. Auch die Handschrift dieser Malerei ist nicht die von Rogier, der jedoch wohl das Bild
im ganzen entworfen und vielleicht auch selber gewisse Teile, wie das für diese Frühzeit charakteristische
schlanke Bäumchen mit der hohen durchsichtig-dünn und ganz flächig gefiederten Blätterkrone, gemalt
hat. Der hier tätige frühe Mitarbeiter Rogiers scheint der gleiche zu sein, auf den auch der wohl zu
unrecht Rogier zugeschriebene sogenannte Turiner Altar der Slg. Abegg in Zürich (Abb. 115-118) zurück-
geht, ein etwas späteres Werk, dessen Stifter, Oberto de Villa, nach Feststellungen Hulin de Loos der
Bruder der Stifterin der Louvreverkündigung und ihrer Turiner Flügel gewesen zu sein scheint.27
Kaum viel später als das Triptychon wird auch jenes Hauptwerk der frühen Jahre Rogiers entstanden
sein, das unter seinen größeren Bildern, wenigstens nach der Zahl der erhaltenen Repliken zu urteilen,
offenbar das beliebteste war, die Lukasmadonna (Abb. 24). Diese Darstellung des die hl. Jungfrau malen-
den Evangelisten ist wahrscheinlich das Altarbild einer Malerkapelle, etwa der der Brüsseler Lukasgilde,
gewesen. Unter den Exemplaren, die den Anspruch erhoben haben, von des Meisters eigener Hand her-
zurühren, hat nur das des Bostoner Museums, nachdem das in wenig gutem Zustande überkommene Bild
in den 1930er Jahren in Berlin gründlich restauriert worden ist, seine Stellung behauptet. In dieser
Schöpfung setzt sich der frühe Rogier deutlich mit einem Hauptwerke Jan van Eycks, der Rolinmadonna
in Paris, auseinander. Wie schon in der Louvreverkündigung gelangt er auch in dieser Auseinander-
setzung zu seinem ganz persönlichen Stil.
Das wesentliche Bildschema hat Rogier unbedenklich von Jan übernommen: die beiden Gestalten, die
Mutter mit dem Kinde und den vor ihr kniende Mann in dem offenen Innenraum, durch dessen drei
rückwärtige Öffnungen man über einen Garten und eine Zinnenbrüstung hinweg in die freie und weite
Landschaft hinausschaut. Wie in der eyckischen Tafel, so blicken auch hier über diese Brüstung zwei vom
Rücken gesehene Gestalten hinab auf die am Ufer des sich aus gebirgigen Fernen schlängelnden Flusses
gelegene Stadt, die in Rogiers Bild nun freilich weit weniger weiträumig und kleinteilig erscheint als bei Jan.
Rogier kopiert nicht sein Vorbild, er formt es von Grund auf und im Sinne seiner eigenen, ganz be-
stimmten inhaltlichen und formalen Absichten um. Wo in der Rolinmadonna von der vordersten Fuß-
bodenfliese an bis zum Horizonte ein einziger Tiefenzug einheitlich durch das Bild greift, einheitlich und,
der aktiven Hinwendung des links im Bilde knienden Kanzlers entsprechend, leise geschrägt, wo also
zwischen den beiden Gestalten die ganze Weite und Tiefe des Raumes aufklafft, ist in der Lukasmadonna
eine Verbindung zwischen Figur und Figur in der Fläche geschaffen. Ähnlich wie in der Louvreverkün-
digung gewinnt Rogier sie durch das breite Sichauslegen des Manteltuches der Madonna am Boden, das
die Tiefenperspektive zerschneidet, durch die Neigung ihres Hauptes, und — hier nun über alle räumliche
Entfernung hinweg — durch die Linien, namentlich die Flußuferlinien, auch in der Landschaft. Indem er
34